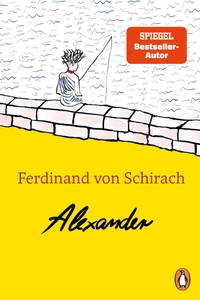Im Kino
Herrenwitz des Narzissten
Die Filmkolumne. Von Janis El-Bira, Lukas Foerster
29.11.2018. Lars von Trier zimmert in seinem Serienkillerfilm "The House That Jack Built" Dekadenzmetaphern aus dem alteuropäischen Herrenzimmer. Marie Wilkes Dokumentarfilm "Aggregat" zeigt, wie die Pegidademonstranten, ihre Mitstreiter und Gegner zu politischen Akteuren werden.
Zu den eher geistesschlichten Überzeugungen konservativer Kulturkritik zählt, dass eine Gesellschaft immer genau jene Psychopathen produziere, die sie auch verdient. Erst die Wüstungen der Moderne, heißt es dann, machten den Mann (und es geht eigentlich immer um Männer) zum Arschloch, Waldgänger, Misanthropen, Chauvinisten und schließlich zum Killer. Als solcher durchstreift er die Texte kleinerer und größerer Weltliteraten - von Bloy bis Huysmans, von Céline bis Jünger, von Houellebecq bis Bret Easton Ellis. Tragisch ist dabei nichts an diesen Männerfiguren, denn ein echter Dekadenzler behauptet stets, genau jenen Durchblick zu haben, der allen Tragikern notwendigerweise abgeht. Das exakte Wissen um das eigene Arschlochsein ist eine ausgeklügelte Strategie im Rachefeldzug gegen die Moderne, der inszenierte Selbsthass eine seiner wichtigsten Waffen. Auch deshalb siedeln diese devianten Männerhelden so häufig im Intellektuellenmilieu, erscheinen als Hochbegabte, Neurotiker und Zwangsgestörte. Ihre Fähigkeiten könnten anders als im Hassen oder Morden zur Geltung kommen, doch alles Mühen verstehen sie als Vergeudung an einer Welt im Niedergang. So potenzieren Selbst- und Weltekel einander wie in einem Spiegel.
In einer Schlüsselszene in Lars von Triers neuem Film "The House That Jack Built" sitzt Jack (Matt Dillon) mit seinem bald 61. Opfer, einer jungen Frau (Riley Keough), die er verächtlich Simple nennt, auf dem Sofa. Als er ihre nackten Brüste mit einem roten Filzstift markiert wie ein Chirurg, der ein Implantat einsetzen will, schaut Simple ihm noch gelassen dabei zu. Erst eine Auseinandersetzung mit dem vermeintlichen Freund lässt Todesangst in ihr aufsteigen. Jack reißt das Wohnzimmerfenster auf. Sie soll lauter schreien, vielleicht hört sie jemand. Dann stellt er selbst sich ans Fenster, während die Kamera einen Außenblick auf den tristen Apartmentblock wirft. "Nobody is helping!", brüllt Jack in die Nacht - und tatsächlich: Kein Licht geht an, keine Tür öffnet sich. So bestätigt, greift Jack zum Küchenmesser und schneidet Simple die Brüste ab. Mit den ersten Blut- und Fettspritzern springt der Film gnädig zur nächsten Szene.

Vieles von dem, was Lars von Triers Filme und seinen persönlichen Markenwert als Global Player des Autorenkinos ausmacht, kommt in diesen Minuten zusammen: Der schier endlose "build-up", bis die Gewalt sich endlich entlädt, das nervenzehrende Vor und Zurück im Spiel mit dem unterstellten Voyeurismus der Zuschauer, vor allem aber jene schillernde Ineinssetzung von Autor und Figur(en), die spätestens seit Triers Bekenntnisfilm "Antichrist" immer wieder und vor allem von ihm selbst suggeriert wird. In "The House That Jack Built" erreicht diese Selbstbezüglichkeit ihre bisher befremdlichste Dimension. Das liegt nicht so sehr daran, dass dieser Jack ein Serienmörder ist, der seine zumeist weiblichen, "gut mitarbeitenden" Opfer becirct oder als "Mr. Sophistication" intellektuell unterwirft, bevor er sie quält, verstümmelt und tötet. Es liegt auch nicht daran, dass in diesem Film zu sehen ist, wie eine ganze Familie samt kleiner Kinder von Jack im Stil eines großbürgerlichen Jagdvergnügens vom Hochsitz aus zur Strecke gebracht wird, und auch nicht daran, dass gezeigt wird, wie Jack als Junge ein Entenküken misshandelt - auch wenn das Aufstöhnen im Kinosaal nicht zu überhören war. All das ist wohlkalkulierte Provokation. Wirklich verstörend ist hingegen, dass Lars von Trier mit diesem Film vorerst seinen Platz unter jenen jammerlappigen männlichen Künstlerbiografien einnimmt, die ihr Verhältnis zur untergangsgeweihten Welt nur noch im Sinne einer hyperästhetisierten Uneigentlichkeit begreifen wollen. Edelfäule ist der entsprechende Aggregatszustand. Der Film widmet ihr inmitten des Mordens einen vielsagenden Exkurs entlang der unterschiedlichen Qualitäten von Dessertweinen. Eine Dekadenzmetapher aus dem alteuropäischen Herrenzimmer.
Derlei Abschweifungen sind wie schon in "Nymphomaniac" auch in "The House That Jack Built" zahlreich. Ein umfangreiches Brimborium aus Allusionen, Referenzen und Fremdmaterial soll unter Verwendung von Einblendungen und Splitscreens eine Art kritischen Kommentar zum Serienkillerplot bilden. Im Kern steht dabei die Frage nach einer maximal transgressiven Kunst. Genauer: Haben Jacks ausgetüftelte Tötungsmethoden oder die Art, wie er mittels aufwändiger Präparationen die Leichen seiner Opfer in einen annähernd lebensechten Zustand zurückverwandelt, irgendetwas gemein mit den häufig eingeblendeten Fingern Glenn Goulds, wenn diese am Klavier Musik von Bach spielen? Oder, andersherum aufgezogen: Haben die zahllosen misshandelten und geschundenen Frauenfiguren aus Lars von Triers eigenen Filmen, wie sie in einem lustvollen Selbstzitat einmal durchs Bild paradieren, etwas zu tun mit den realen Leichenbergen aus dem KZ Buchenwald, die "The House That Jack Built" ihnen in einem tatsächlich bemerkenswert geschmacklosen Scherz an die Seite stellt?
Die Antwort kommt aus dem Off und mit der Stimme von Bruno Ganz, der als Höllenführer Verge einwirft: Natürlich nicht! Und weil Kunstwille allein nicht strafmildernd ist, muss Jack nach fast zweieinhalb Stunden wie Dante an der Seite Vergils hinab in die Unterwelt. Dort allerdings fährt Lars von Trier ganz groß auf, entwirft schöne Abgründe aus Glut und schwarzem Stein wie von Gustave Doré oder William Blake gemalt. Jack wirkt plötzlich klein in diesem Orkus. Lars dagegen langt gewaltig zu und macht seine Kunst erhaben über alle Schuld, indem er den Killer lässig von der Klippe stößt. So geht der letzte Herrenwitz des Narzissten: Ich bin mir selbst noch immer der würdigste Gegner.
Janis El-Bira
The House That Jack Built - Dänemark 2018 - Regie: Lars von Trier - Darsteller: Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie Gråbøl, Riley Keough - Laufzeit: 152 Minuten.
---

Ein paar Sekunden lang ist der Pegidaanhänger allein im Bild. Er scheint auf einer Art Podest zu stehen, einen halben Meter über der Menschenmenge, die ihn umgibt. Zunächst ist er von hinten zu sehen, mit seiner quietschenden Tröte und der mehrfach schwarz-rot-goldenen Kostümierung (Hut, Schal, Jacke) hat er etwas Karnevaleskes an sich. Nachdem er sich umgedreht und kurz in Richtung Kamera geschaut hat, folgt ein Schwenk auf eine Gruppe Fotografen, die ihn gleichfalls im Blick haben und eifrig knipsen.
Dieser Schwenk verwandelt auch das Ausgangsbild des visuell isolierten Demonstranten: Es wird nachträglich lesbar als das Bild, das sich die Presse am liebsten von "Pegidisten" macht. Nicht alle, aber viele Berichte über die Dresdener Montagskundgebungen (und die anderen, noch weitaus radikaleren rechten Zusammenkünfte der letzten Monate) haben etwas von Freakshows, die Rhetorik, ob schriftlich oder filmisch, pendelt zwischen Voyeurismus und Angstlust; die Demonstrierenden werden entweder als undifferenzierte Masse, oder eben, wie hier, als einzelne, exemplarische Individuen präsentiert, hinzu kommen bestenfalls noch ein paar individualbiografische Vignetten unter der Leitfrage "Woher kommt der Hass?". Marie Wilke verfolgt einen anderen Plan. Es geht in ihrem Film "Aggregat" um eine Kontextualisierung der wiedererstarkten, oder jedenfalls plötzlich sehr viel sichtbareren Rechten, aber nicht im vulgärsoziologischen Sinn. Die Dokumentation fokussiert stattdessen auf die (massen-)kommunikativen Mechanismen und Aushandlungsprozesse, die erst den Pegidademonstranten sowie seine Mitstreiter und Gegenspieler zu politischen Akteuren machen.
"Aggregat" versammelt eine Reihe dokumentarischer Miniaturen, die der gegenwärtigen Mediendemokratie entnommen sind: parteiinterne Strategiedebatten, Bürgergespräche, Redaktionskonferenzen, Bundestagsbesichtigungen, Pressekonferenzen und so weiter; alles aufgezeichnet 2016/2017, im beobachtenden Stil gehalten, ohne Interviews oder Voice-Over-Kommentar. Das übergreifende Thema der jeweils durch ein paar Sekunden Schwarzbild voneinander getrennten Kapitel ist Migration; oder genauer: die Reaktion von Teilen der Bevölkerung auf Migration; oder genauer: die Reaktion von Teilen der Bevölkerung auf das, was die Medien aus Migration machen (nämlich eine "Flüchtlingskrise"); oder genauer: die Versuche verschiedener politische Akteure, auf die Reaktion von Teilen der Bevölkerung auf das, was die Medien aus Migration machen, ihrerseits zu reagieren; oder genauer: die Versuche verschiedener politischer Akteure, auf das, was sie als die Reaktion von Teilen der Bevölkerung auf das, was die Medien aus Migration machen, definieren, ihrerseits zu reagieren.

Oder, kürzer: Es geht um politische Prozesse, die als komplexe Beobachtungsverhältnisse gefasst werden. Der Film beobachtet nicht nur Beobachtungen, sondern er beobachtet Beobachtungen von Beobachtungen, die außerdem immer wieder in Selbstbeobachtungen umschlagen. "Wenn Du den Witz falsch verstehst, werden ihn auch Andere falsch verstehen." Immer wieder geht es darum, die Reaktionen dieser Anderen zu antizipieren, die eigenen Reaktionen auf unterstelltes Verhalten der Anderen einzuüben und so weiter. Es geht auch um den zugehörigen Sprachgebrauch, um die Suche nach Modellen ("Problemrahmen" vs "demokratischer Rahmen") und Metaphern ("Ich bin wie ein trockener Schwamm, der Wissen aufsaugen möchte"), die dabei helfen könnten, die eigenen Beobachtungen zu ordnen. Nur in einigen wenigen Kapiteln kommt es zu "direkten" Konfrontationen im zwischenmenschlichen Gespräch. Wo dies geschieht, betont der Film die Rahmungen, unter denen solche Kontaktversuche zwangsläufig stattfinden: Einen "Austausch auf Augenhöhe" gibt es weder im grell weißen Bundestagstuck, in dem ein älterer Herr seiner Unzufriedenheit noch weitgehend ungefiltert Ausdruck verleiht, noch im Bürgergespräch, in dem eine Besucherin ihren Redebeitrag bereits schriftlich vorformuliert mit sich führt.
Dass er sich nicht nach einem imaginären "direkten Bürgerkontakt" sehnt, sondern die unvermeidlichen Vermittlungsprozesse objektiv und vorurteilsfrei in den Blick rückt: Darin liegt die politische Klugheit von Wilkes Film. Nur in der Rhetorik des Faschismus können Volk und Staat eins werden. Daneben besticht "Aggregat" auch durch eine Aufmerksamkeit für Modalitäten und Texturen der in ihrer institutionellen Gefasstheit eben doch alternativlosen (beziehungsweise: die einzige Alternative wäre die, die der Alternative für Deutschland vorschwebt) Mediendemokratie. Sehr aufschlussreich sind etwa gegen Ende zwei direkt aufeinanderfolgende Redaktionssitzungen, erst bei der taz und dann, einmal quer über die Rudi-Dutschke-Straße, bei der Bild. Letztere sieht aus wie die Parodie auf die Teambesprechung eines jungkreativen Start-ups mit "flachen Hierarchien" - ein Gelümmel sondergleichen; aber wenn man ehrlich ist, macht die taz inhaltlich nicht unbedingt eine bessere Figur, insbesondere wenn es um ein Titelbild mit Pandabären geht, die irgendwie (aber wie?) "für die Migranten einstehen" sollen.
"Aggregat" ist kein Film über die Wut des Wutbürgers und die Ohnmacht aufrechter Demokraten, sondern einer über kommunikative Prozesse innerhalb und zwischen Institutionen. Hoffnung auf die Stabilität demokratischer Strukturen macht er gleichwohl trotzdem nicht viel. Denn die Prozesse, die er beobachtet, sind sozusagen inhaltsblind (nicht nur deshalb ist "Aggregat" ein Luhmannfilm weit mehr als ein Habermasfilm). Das macht spätestens das Pegidakapitel deutlich. Wilkes Kamera bleibt da zwar, anders als sonst, auf Abstand. Aber, wenn sich die Redebeiträge um den unterstellten Blick des Westens auf den Osten und um das Selbstbild der Demonstrierenden als legitime Erben der DDR-Dissidenz drehen, wird klar: Auch die Dresdener Demonstration kann als ein System beschrieben werden, das sich über Beobachtung und Selbstbeobachtung strukturiert. Aus systemischer Sicht haben selbst die Attacken gegen Pressevertreter Teil am Beobachtungsverhältnisses.
Immerhin vorsichtig optimistisch ist der Hallenser SPD-Politiker Karamba Diaby. "Das Gemeinsame ist das Kleingartengesetz", meint er zum Reporter eines Fernsehteams. Mit dem Hinweis auf die institutionelle Vernunft im Herzen der Kleingartenkolonie möchte er allerdings nicht nur seiner Hoffnung auf ein zivilisiertes gesamtgesellschaftliches Miteinander auch im größeren Rahmen Ausdruck verleihen; sondern gleichzeitig den unangenehm insistierenden Nachfragen des Reporters entkommen, die immer wieder auf Diabys senegalesische Herkunft abzielen.
Lukas Foerster
Aggregat - Deutschland 2018 - Regie: Marie Wilke - 93 Minuten.
Kommentieren