Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
24.10.2006. Atlantic Monthly bewundert die Manipulationsfähigkeit Hillary Clintons. In Outlook India protestiert Arundhati Roy gegen die Todesstrafe für Mohammed Afzal. Im Guardian erklärt Jay McInerney, wie billiger Wein den Gaumen schult. Elias Khoury interpretiert den Nobelpreis für Orhan Pamuk in Al Ahram als Rache des Textes am Autor. Bernard-Henri Levy will Putins Gewissensbiss sein. In Elet es Irodalom denken Peter Nadas und Peter Esterhazy über die Revolution von 1956 nach. Die Gazeta Wyborcza erinnert daran, dass es 1956 auch in Polen eine kleine Revolution gab. Die New York Times fährt nach Afghanistan.
The Atlantic | Foglio | Guardian | Tygodnik Powszechny | Express | Al Ahram Weekly | Point | Nueva Sociedad | New Yorker | Le Monde diplomatique | Groene Amsterdammer | Outlook India | New York Times | Espresso | Elet es Irodalom | Magyar Hirlap | Gazeta Wyborcza | New Republic | al-Sharq al-Awsat | Economist
The Atlantic (USA), 01.11.2006
 In einem grandiosen und sehr langen Porträt beschreibt Joshua Green die Senatorin Hillary Rodham Clinton als "gerissene Manipulatorin übergroßer Egos", die es in ihren sechs Amtsjahren und zum Schrecken der demokratischen Partei meisterhaft gelernt habe, in den Washingtoner Zirkeln der Macht zu agieren. Zum Beispiel in evangelikalen Gebetskreisen, die besonders gern von konservativen Republikanern frequentiert werden. Clinton meldete sich prompt beim exklusivsten von allen an: "Senator Sam Brownback war an der Reihe, die Gruppe zu leiten. Er erhob sich, um über den Schrecken einer Krebserkrankung zu sprechen. Doch als er vor seinen Kollegen stand, entdeckte er Clinton und es überkam ihn der Impuls, das Thema seines Zeugnisses zu wechseln. 'Ich hatte mich heute darauf vorbereitet, über eine Erfahrung in meinem Leben zu sprechen, die großes Leid verursacht hat, die aber auch meinen Glauben gestärkt hat', erklärte Brownback nach den Worten eines Beobachters dieser Szene. 'Aber jetzt habe ich nur noch einen Gedanken'. Er gestand, dass er Clinton gehasst und abfällige Bemerkungen über sie gemacht hat. Doch durch Gott habe er seine Sünden erkannt. Dann drehte er sich zu ihr um und fragte: 'Mrs. Clinton, können Sie mir verzeihen?'" Seitdem klappt's mit den Republikanern.
In einem grandiosen und sehr langen Porträt beschreibt Joshua Green die Senatorin Hillary Rodham Clinton als "gerissene Manipulatorin übergroßer Egos", die es in ihren sechs Amtsjahren und zum Schrecken der demokratischen Partei meisterhaft gelernt habe, in den Washingtoner Zirkeln der Macht zu agieren. Zum Beispiel in evangelikalen Gebetskreisen, die besonders gern von konservativen Republikanern frequentiert werden. Clinton meldete sich prompt beim exklusivsten von allen an: "Senator Sam Brownback war an der Reihe, die Gruppe zu leiten. Er erhob sich, um über den Schrecken einer Krebserkrankung zu sprechen. Doch als er vor seinen Kollegen stand, entdeckte er Clinton und es überkam ihn der Impuls, das Thema seines Zeugnisses zu wechseln. 'Ich hatte mich heute darauf vorbereitet, über eine Erfahrung in meinem Leben zu sprechen, die großes Leid verursacht hat, die aber auch meinen Glauben gestärkt hat', erklärte Brownback nach den Worten eines Beobachters dieser Szene. 'Aber jetzt habe ich nur noch einen Gedanken'. Er gestand, dass er Clinton gehasst und abfällige Bemerkungen über sie gemacht hat. Doch durch Gott habe er seine Sünden erkannt. Dann drehte er sich zu ihr um und fragte: 'Mrs. Clinton, können Sie mir verzeihen?'" Seitdem klappt's mit den Republikanern. Outlook India (Indien), 30.10.2006
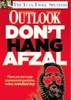 In einem leidenschaftlichen Appell fordert die Schriftstellerin und gefürchtete Aktivistin Arundhati Roy die Begnadigung des infolge des Anschlags auf das indische Parlament vom 13. Dezember 2001 gleich zweifach zum Tod verurteilten Mohammed Afzal. Roy übt scharfe Kritik an Justiz und Presse. Während die Zeitungen nichts besseres zu tun hätten, als die Länge des Stricks zu diskutieren, an dem der Verurteilte hängen werde, stütze sich das höchste Gericht auf ein illegales Geständnis Afzals und übe im Namen des kollektiven gesellschaftlichen Bewusstseins praktisch Lynchjustiz, empört sich Roy. "Afzal hat das Recht, ein Individuum, eine reale Person zu sein, scheinbar verwirkt. Er verkörpert alle möglichen Fantasien - die der Nationalisten, die der Separatisten und die der Gegner der Todesstrafe. Für Indien ist er der große Verbrecher, für Kaschmir der große Held und ist doch nur Beweis dafür, dass der Kaschmirkrieg weitergeht ... Aufgrund eines durch Folter erpressten Geständnisses wurden Hunderttausende Soldaten an die Grenze zu Pakistan geschafft, und Indien nahm die ganze Welt in die Geiselhaft seines nuklearen Wagnisses." Die für den 20. Oktober vorgesehene Hinrichtung ist inzwischen aufgrund eines Gnadengesuchs von Afzals Frau ausgesetzt worden.
In einem leidenschaftlichen Appell fordert die Schriftstellerin und gefürchtete Aktivistin Arundhati Roy die Begnadigung des infolge des Anschlags auf das indische Parlament vom 13. Dezember 2001 gleich zweifach zum Tod verurteilten Mohammed Afzal. Roy übt scharfe Kritik an Justiz und Presse. Während die Zeitungen nichts besseres zu tun hätten, als die Länge des Stricks zu diskutieren, an dem der Verurteilte hängen werde, stütze sich das höchste Gericht auf ein illegales Geständnis Afzals und übe im Namen des kollektiven gesellschaftlichen Bewusstseins praktisch Lynchjustiz, empört sich Roy. "Afzal hat das Recht, ein Individuum, eine reale Person zu sein, scheinbar verwirkt. Er verkörpert alle möglichen Fantasien - die der Nationalisten, die der Separatisten und die der Gegner der Todesstrafe. Für Indien ist er der große Verbrecher, für Kaschmir der große Held und ist doch nur Beweis dafür, dass der Kaschmirkrieg weitergeht ... Aufgrund eines durch Folter erpressten Geständnisses wurden Hunderttausende Soldaten an die Grenze zu Pakistan geschafft, und Indien nahm die ganze Welt in die Geiselhaft seines nuklearen Wagnisses." Die für den 20. Oktober vorgesehene Hinrichtung ist inzwischen aufgrund eines Gnadengesuchs von Afzals Frau ausgesetzt worden. Espresso (Italien), 26.10.2006
 Umberto Eco sorgt sich in seiner Bustina di Minerva, dass zunehmend Redeverbote um sich greifen. "Ich will daran erinnern, dass diese Tabus nicht nur den muslimischen Fundamentalisten anzurechnen sind (die in ihrer Reizbarkeit nicht mit sich scherzen lassen), sondern auch der Ideologie der 'politischen Korrektheit'. Diese ist vom Respekt gegenüber allen inspiriert, aber mittlerweile hindert sie einen daran - zumindest in den USA - Witze nicht nur über Juden, Muslime und Behinderte zu erzählen, sondern auch über Schotten, Genueser, Belgier, Polizisten, Feuerwehrleute, Straßenkehrer und Eskimos (die man nicht so nennen sollte, aber wenn man sie so nennt, wie man sie nennen sollte, versteht keiner, worüber man spricht)."
Umberto Eco sorgt sich in seiner Bustina di Minerva, dass zunehmend Redeverbote um sich greifen. "Ich will daran erinnern, dass diese Tabus nicht nur den muslimischen Fundamentalisten anzurechnen sind (die in ihrer Reizbarkeit nicht mit sich scherzen lassen), sondern auch der Ideologie der 'politischen Korrektheit'. Diese ist vom Respekt gegenüber allen inspiriert, aber mittlerweile hindert sie einen daran - zumindest in den USA - Witze nicht nur über Juden, Muslime und Behinderte zu erzählen, sondern auch über Schotten, Genueser, Belgier, Polizisten, Feuerwehrleute, Straßenkehrer und Eskimos (die man nicht so nennen sollte, aber wenn man sie so nennt, wie man sie nennen sollte, versteht keiner, worüber man spricht)." Elet es Irodalom (Ungarn), 20.10.2006
 Der ungarische Schriftsteller Peter Nadas kann heute, 50 Jahre nach der ungarischen Revolution, verstehen, warum der Westen nicht eingegriffen hat. "Im Oktober 1956 hatten die Völker und die legitimen Regierungen Europas und Nordamerikas entschieden, dass die Epoche revolutionärer Umwälzungen für immer vorbei war. Und sie hatten recht. Die Devise der Epoche lautete: um den Dritten Weltkrieg zu vermeiden, müssen soziale und politische Proteste in bestehende Systeme integriert werden. Mit großem Bedauern und blutenden Herzen, ihrer moralischen Verantwortung bewusst, entschieden sie sich, die anderthalb Jahrhunderte verspätete Revolution der ungarischen Demokratie weder mit diplomatischen Mitteln noch durch Freiwillige oder Waffen zu unterstützen."
Der ungarische Schriftsteller Peter Nadas kann heute, 50 Jahre nach der ungarischen Revolution, verstehen, warum der Westen nicht eingegriffen hat. "Im Oktober 1956 hatten die Völker und die legitimen Regierungen Europas und Nordamerikas entschieden, dass die Epoche revolutionärer Umwälzungen für immer vorbei war. Und sie hatten recht. Die Devise der Epoche lautete: um den Dritten Weltkrieg zu vermeiden, müssen soziale und politische Proteste in bestehende Systeme integriert werden. Mit großem Bedauern und blutenden Herzen, ihrer moralischen Verantwortung bewusst, entschieden sie sich, die anderthalb Jahrhunderte verspätete Revolution der ungarischen Demokratie weder mit diplomatischen Mitteln noch durch Freiwillige oder Waffen zu unterstützen."Vor zwei Wochen (der Artikel ist jetzt erst online) hatte der Schriftsteller Peter Esterhazy für eine gemeinsame Erinnerung an die Revolution plädiert, die er als etwas definiert, "das wir Ungarn immer wieder verloren haben. Zuerst verloren wir sie, als die Sowjetunion in Budapest einmarschierte. Ein zweites Mal verloren wir sie, als Imre Nagy am 16. Juni 1958 hingerichtet wurde. Das Kadar-Regime (1956-1988) sorgte für eine jahrzehntelange Amnesie. Am 16. Juni 1989 (als Imre Nagy rehabilitiert und feierlich beigesetzt wurde) schien es, als ob wir die verlorene Revolution wieder gefunden hätten. An diesem phantastischen Nachmittag war es, als ob die Geschichte an sich - unabhängig von allen politischen Interpretationen - eine enorme Kraft hätte, als ob der Geschichte das letzte Wort über das Vergessen gebührt und nicht uns, den Untreuen. Der Schein trog: Am 50. Jahrestag haben wir 1956 wieder verloren. Es ist heute ausschließlich als parteipolitische Beute interessant."
Magyar Hirlap (Ungarn), 21.10.2006
 Die sozialliberale Regierung und die rechtskonservative Opposition feiern heute den 50. Jahrestag der ungarischen Revolution von 1956 getrennt. Für das Dossier zu 1956 befragte Magyar Hirlap eine Reihe von Prominenten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wann die Ungarn zu einem Konsens über 1956 finden werden. Es antworteten u.a. die Schriftsteller Mihaly Kornis und Endre Kukorelly, der Theatermacher Arpad Schilling, der Historiker Janos Tischler und der Publizist Istvan Elek: "Den 200. Jahrestag der Französischen Revolution haben die französische Linke und Rechte immer noch getrennt gefeiert. Ich glaube, wir werden sie überbieten."
Die sozialliberale Regierung und die rechtskonservative Opposition feiern heute den 50. Jahrestag der ungarischen Revolution von 1956 getrennt. Für das Dossier zu 1956 befragte Magyar Hirlap eine Reihe von Prominenten aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft, wann die Ungarn zu einem Konsens über 1956 finden werden. Es antworteten u.a. die Schriftsteller Mihaly Kornis und Endre Kukorelly, der Theatermacher Arpad Schilling, der Historiker Janos Tischler und der Publizist Istvan Elek: "Den 200. Jahrestag der Französischen Revolution haben die französische Linke und Rechte immer noch getrennt gefeiert. Ich glaube, wir werden sie überbieten.""1956 hat Europa die Augen geöffnet", wird Cees Nooteboom in einem Artikel zitiert. Nooteboom war als 23-Jähriger Augenzeuge der Revolution. "Der Anblick der ermordeten Geheimpolizisten, der umgekippten Straßenbahnen, der Geruch von Schießpulver erinnerten ihn an den Zweiten Weltkrieg und die deutsche Besatzung der Niederlande. Er spürte, dass der Westen die auf den Straßen kämpfenden Ungarn verraten würde. Er war sprachlos, als ein Mädchen ihn mehrmals fragte, wann der Westen komme, den Ungarn zu helfen. Die Frage war nachvollziehbar, weil der Sender Free Europe mehrmals verkündet hatte, dass Westeuropa und die USA einen militärischen Eingriff in Ungarn planten. Aber auf die Frage des Mädchens blieb der Westen stumm. 'Falsche Hoffnungen waren damals sehr gefährlich. Ich wollte den Ungarn helfen, aber ich war völlig machtlos."
Außerdem: Die Fotos im Dossier zeigen die Verhaftung der Mitarbeiter der ungarischen Stasi, zertrümmerte sowjetische LKWs an der Budapester Ringstraße, Todesopfer vor dem ungarischen Parlament; eine Demonstration vor der UN in New York mit dem Schild "Save Hungary!" und die junge Frau, die Russ Melcher für Paris Match fotografierte und die im Westen zur Symbolfigur der ungarischen Revolution wurde.
Gazeta Wyborcza (Polen), 23.10.2006
 Im Oktober 1956 gab es nicht nur eine Revolution im Ostblock, die ungarische. Nach dem Arbeiteraufstand in Posen (Poznan) im Juni gab es einen Wechsel an der Spitze der polnischen kommunistischen Partei: der vermeintlich liberalere Wladyslaw Gomulka übernahm, getragen von einer Welle der nationalen Aufbruchstimmung, die Macht. Dieses Ereignis läutete die kurze Phase des sogenannten Tauwetters ein. "Das war der Anfang vom Ende des Kommunismus, sein Aufweichen begann damals", erinnert sich einer der Anführer der streikenden Arbeiter Lechoslaw Gozdzik. "1956 haben wir unsere Chance maximal genutzt. Wir hätten auch etwas mit dem Säbel rasseln und die Leute auf die Straße führen können. Dann würden wir jetzt schöne Denkmäler haben. Aber damals haben wir die Grenze nicht überschritten."
Im Oktober 1956 gab es nicht nur eine Revolution im Ostblock, die ungarische. Nach dem Arbeiteraufstand in Posen (Poznan) im Juni gab es einen Wechsel an der Spitze der polnischen kommunistischen Partei: der vermeintlich liberalere Wladyslaw Gomulka übernahm, getragen von einer Welle der nationalen Aufbruchstimmung, die Macht. Dieses Ereignis läutete die kurze Phase des sogenannten Tauwetters ein. "Das war der Anfang vom Ende des Kommunismus, sein Aufweichen begann damals", erinnert sich einer der Anführer der streikenden Arbeiter Lechoslaw Gozdzik. "1956 haben wir unsere Chance maximal genutzt. Wir hätten auch etwas mit dem Säbel rasseln und die Leute auf die Straße führen können. Dann würden wir jetzt schöne Denkmäler haben. Aber damals haben wir die Grenze nicht überschritten."In die polnischen Kinos läuft jetzt die russisch-ukrainisch-finnische Koproduktion "9. Kompagnie" an. "Ein spektakulärer Film über die sowjetische Intervention in Afghanistan, in dem niemand nach dem 'Warum' fragt, und in dem die russischen Soldaten am Ende die Opfer sind - vergessen von ihrem Vaterland, für das sie blind in den Krieg gingen", kommentiert Jacek Szczerba.
New Republic (USA), 30.10.2006
 Als Triumph des Optimismus über die Zurechnungsfähigkeit geißelt The New Republic im Editorial das Agieren der Vereinten Nationen in der Frage des Völkermords in Darfur: "Die Resolution enthält einen entscheidenden Haken: ein implizites Versprechen, dass keine Friedenstruppen Darfur ohne Einwilligung der sudanesischen Führung betreten würden. Das war die optimistische Logik, da schließlich jeder weiß, dass es genau die sudanesische Führung ist, die beim Völkermord in Darfur die Regie führt. Und welcher Völkermörder lädt schon fremde Truppen in sein Land, um sein eigenes teuflisches Treiben zu stoppen? Im Ergebnis dürfte es niemanden überrascht haben, dass der Sudan das Flehen der UN recht unverblümt abwies. Doch die Optimisten versuchen es weiter, und auch sechs Wochen später drängen, bitten, umschmeicheln sie die Gangster, die den Sudan regieren, doch bitte zu erlauben, dass UN-Truppen nach Darfur dürfen. Aber die Gangster sagen immer noch Nein. Die Diplomaten bitten weiter. Das kann man Optimismus nennen. Man kann es aber auch undiplomatisch bezeichnen: als blanken Wahnsinn."
Als Triumph des Optimismus über die Zurechnungsfähigkeit geißelt The New Republic im Editorial das Agieren der Vereinten Nationen in der Frage des Völkermords in Darfur: "Die Resolution enthält einen entscheidenden Haken: ein implizites Versprechen, dass keine Friedenstruppen Darfur ohne Einwilligung der sudanesischen Führung betreten würden. Das war die optimistische Logik, da schließlich jeder weiß, dass es genau die sudanesische Führung ist, die beim Völkermord in Darfur die Regie führt. Und welcher Völkermörder lädt schon fremde Truppen in sein Land, um sein eigenes teuflisches Treiben zu stoppen? Im Ergebnis dürfte es niemanden überrascht haben, dass der Sudan das Flehen der UN recht unverblümt abwies. Doch die Optimisten versuchen es weiter, und auch sechs Wochen später drängen, bitten, umschmeicheln sie die Gangster, die den Sudan regieren, doch bitte zu erlauben, dass UN-Truppen nach Darfur dürfen. Aber die Gangster sagen immer noch Nein. Die Diplomaten bitten weiter. Das kann man Optimismus nennen. Man kann es aber auch undiplomatisch bezeichnen: als blanken Wahnsinn."Peter Beinart hofft, dass sich die USA nach dem Wahlkampf endlich den Realitäten im Irak stellen. Seiner Einschätzung nach haben sie nur zwei Möglichkeiten: Entweder unternimmt die Regierung letzte verzweifelte Anstrengungen, die wahrscheinlich scheitern werden, oder sie akzeptiert die Niederlage und versucht, die Folgen zu mindern. "Es ist die Wahl, die man gegenüber einem sterbenden Patienten hat: zwischen aggressiven Maßnahmen, die vielleicht ein Wunder bewirken, aber auch die Agonie vergrößern können, und einem Loslassen des Patienten, in der Hoffnung, dass man wenigstens den Schmerz lindern kann, wenn man sich dem Unvermeidlichen beugt."
al-Sharq al-Awsat (Saudi Arabien / Vereinigtes Königreich), 18.10.2006
Jamal al-Din al-Afghani (1838-1897) zählt zu den wichtigsten Vordenkern einer islamischen Erneuerung. Er wird sogar oft als islamischer Martin Luther bezeichnet. Farial Hasan al-Khalifa sieht das in ihrem Buch "Die Bedeutung der Vernunft" ganz anders. Muhammad Khalil skizziert ihre Thesen: "Statt einer neuen Perspektive auf die islamische Religion, die es dem Individuum und der Gesellschaft ermöglichen würden, sich zu befreien und sich zu entwickeln, vertrat Afghani die Idee eines islamischen Staates und einer islamischen Gemeinschaft, die Idee einer Einheit von Religion und Weltlichem. Eine solche Einheit überschreitet Nationalität, Ethnie und Volk - und genau dies war das wesentliche Ziel Afghanis und seine Perspektive für die Zukunft. Eine solche Einheit würde den Muslimen die Kraft bieten, sich den imperialistischen Angriffen von Außen und der Rückständigkeit und dem Verfall im Inneren zu widersetzen. Afghanis Ruf nach einer islamischen Identität und einer islamischen Zivilisation bedeutete nach Ansicht der Autorin eine Abgrenzung vom Lauf der (nicht-islamischen) menschlichen Zivilisation."
Aus Syrien berichtet Nazim Muhanna von einem kleinen Boom staatlich produzierter Kinofilme. Anlässlich der Ernennung von Damaskus zur arabischen Kulturhauptstadt für das Jahr 2008 plant die National Film Organisation of Syrian Cinema die Produktion von zehn Filmen über die Stadt - ein enormes Projekt, denn normalerweise bringt es die Organisation alle zwei Jahre auf drei neue Filme. Angesichts der Ineffektivität der Einrichtung, deren Eingang bereits "an ein altes Krankenhaus für chronisch Kranke" erinnere, setzen immer mehr syrische Filmemacher auf Produktionen mit Digitalkameras, berichtet Muhanna. Diese Technik biete - jenseits der staatlichen Filmförderung - ein kleines Fenster zu einer Renaissance des syrischen Films.
Weblogs gewinnen in Ägypten eine immer größere Bedeutung, beobachtet Muhammad Abu Zaid: Als Forum der politischen Opposition, aber auch als künstlerisches Experimentierfeld. Angesichts der Freiheit, die ein Blog bei der Wahl von Form und Sprache biete, betreiben immer mehr ägyptische Künstler ihr eigenes Internet-Tagebuch. Zum Beispiel Salma al-Banna und Amr Ezzat.
Aus Syrien berichtet Nazim Muhanna von einem kleinen Boom staatlich produzierter Kinofilme. Anlässlich der Ernennung von Damaskus zur arabischen Kulturhauptstadt für das Jahr 2008 plant die National Film Organisation of Syrian Cinema die Produktion von zehn Filmen über die Stadt - ein enormes Projekt, denn normalerweise bringt es die Organisation alle zwei Jahre auf drei neue Filme. Angesichts der Ineffektivität der Einrichtung, deren Eingang bereits "an ein altes Krankenhaus für chronisch Kranke" erinnere, setzen immer mehr syrische Filmemacher auf Produktionen mit Digitalkameras, berichtet Muhanna. Diese Technik biete - jenseits der staatlichen Filmförderung - ein kleines Fenster zu einer Renaissance des syrischen Films.
Weblogs gewinnen in Ägypten eine immer größere Bedeutung, beobachtet Muhammad Abu Zaid: Als Forum der politischen Opposition, aber auch als künstlerisches Experimentierfeld. Angesichts der Freiheit, die ein Blog bei der Wahl von Form und Sprache biete, betreiben immer mehr ägyptische Künstler ihr eigenes Internet-Tagebuch. Zum Beispiel Salma al-Banna und Amr Ezzat.
Economist (UK), 23.10.2006
 Die britische Regierung hält Großbritanniens multikulturelle Gesellschaft in ihrer derzeitigen Form für gescheitert und sieht erheblichen Diskussionsbedarf, was das richtige Verhältnis zwischen kultureller Vielfalt und Integration angeht, meldet der Economist. "Inwieweit muss eine liberale Gesellschaft Haltungen und Verhaltensweisen verteidigen, die ihr feindlich gesinnt sind? Ist es vernünftig, von den Mitgliedern aller Minderheiten zu fordern, dass sie sich, zumindest bis zu einem gewissen Grad, in die Mehrheit integrieren?" Langsam aber sicher, so der Economist, ereilt die britische Linke, die sich traditionellerweise schwer tut mit dem Begriff der nationalen Identität, die Einsicht, dass Toleranz auch Grenzen haben muss, oder mit den Worten Salman Rushdies: "Keine Gesellschaft, und sei sie noch so tolerant, kann gedeihen, wenn ihre Bürger die Bedeutung ihrer Bürgerschaft nicht wertschätzen."
Die britische Regierung hält Großbritanniens multikulturelle Gesellschaft in ihrer derzeitigen Form für gescheitert und sieht erheblichen Diskussionsbedarf, was das richtige Verhältnis zwischen kultureller Vielfalt und Integration angeht, meldet der Economist. "Inwieweit muss eine liberale Gesellschaft Haltungen und Verhaltensweisen verteidigen, die ihr feindlich gesinnt sind? Ist es vernünftig, von den Mitgliedern aller Minderheiten zu fordern, dass sie sich, zumindest bis zu einem gewissen Grad, in die Mehrheit integrieren?" Langsam aber sicher, so der Economist, ereilt die britische Linke, die sich traditionellerweise schwer tut mit dem Begriff der nationalen Identität, die Einsicht, dass Toleranz auch Grenzen haben muss, oder mit den Worten Salman Rushdies: "Keine Gesellschaft, und sei sie noch so tolerant, kann gedeihen, wenn ihre Bürger die Bedeutung ihrer Bürgerschaft nicht wertschätzen."Weitere Artikel: Die Gesetze gegen das Schüren von Rassenhass sind keine Gesetze gegen Beleidigung und sollten auch nicht als solche interpretiert werden, weil damit auch die Möglichkeit, Kritik zu üben, gefährdet wird, warnt der Economist in einem Artikel über die Redefreheit. Weiterhin schildert der Economist, ob und wie die Türkei ihren Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk feiert. Und schließlich begrüßt er den dialogsuchenden Brief, den hohe muslimische Würdenträger an den Papst gerichtet haben.
Foglio (Italien), 21.10.2006
Sandro Fusina hat mit den Szenen, die Paolo Ventura mit Puppen nachstellt und dann fotografiert, die letzten Kriegstage in Mailand so intensiv miterlebt wie nie zuvor. Ob Soldaten, Schwarzhändler oder Prostuierte: "In diesen Arrangements gibt es keine Helden, keine Gewinner und keine Schöngeister... Und die Künstler? Sie schmachten in ihren Ateliers und starren ins Leere. Oder sie werden von der Portiersfrau erhängt an der Zimmerdecke aufgefunden, das letzte Bild lehnt noch an der Wand. In diesen Augenblicken, in denen sich zwei Leben kreuzen, hassen und lieben sich die Männer und die Frauen, immer mit dem gleichen Ausdruck in den Augen."
Gabriella Mecucci feiert die italienische Vorherrschaft im Restauratorengeschäft. Lino Januzzi stellt Massimo Pinis Biografie des italienischen Politikers Bettino Craxi vor, die Craxi wohl gefallen würde.
Gabriella Mecucci feiert die italienische Vorherrschaft im Restauratorengeschäft. Lino Januzzi stellt Massimo Pinis Biografie des italienischen Politikers Bettino Craxi vor, die Craxi wohl gefallen würde.
Guardian (UK), 21.10.2006
 Der Schriftsteller Jay McInerney erinnert sich, wie Hemingway ihn zum Wein gebracht hat und wie er sich dann langsam zum Kenner hoch trank. "Ich arbeitete mich von den billigsten osteuropäischen Tafelweinen - wir hatte eine beträchtliche Auswahl in der Zwei-Dollar-Klasse - bis zum spanischen Cava vor, der damals fünf oder sechs Dollar kostete. Es war kein schlechter Weg zu lernen. Nachdem mein erster Roman angenommen war, konnte ich mir ein paar dieser Jahrgangs-Bordeaux leisten. Mittlerweile hatte sich bei mir schon der Ansatz eines Gaumens gebildet. In 'Between Meals', rät AJ Liebling, ganz unten in der Nahrungskette zu starten. 'Wenn die erste Voraussetzung für den guten Restaurantkritiker ein guter Appetit ist', schreibt er, 'ist die zweite, die eigene Ausbildung in der Phase des Lebens zu starten, in der man die Rechnung zwar bezahlen kann, ihre Höhe einem aber noch nicht egal ist.' Das Gleiche gilt für Wein. Der arme Mann, der Billigtrinker, wird zu Entscheidungen und Opfern gezwungen, die nur seine Urteilskraft schärfen können."
Der Schriftsteller Jay McInerney erinnert sich, wie Hemingway ihn zum Wein gebracht hat und wie er sich dann langsam zum Kenner hoch trank. "Ich arbeitete mich von den billigsten osteuropäischen Tafelweinen - wir hatte eine beträchtliche Auswahl in der Zwei-Dollar-Klasse - bis zum spanischen Cava vor, der damals fünf oder sechs Dollar kostete. Es war kein schlechter Weg zu lernen. Nachdem mein erster Roman angenommen war, konnte ich mir ein paar dieser Jahrgangs-Bordeaux leisten. Mittlerweile hatte sich bei mir schon der Ansatz eines Gaumens gebildet. In 'Between Meals', rät AJ Liebling, ganz unten in der Nahrungskette zu starten. 'Wenn die erste Voraussetzung für den guten Restaurantkritiker ein guter Appetit ist', schreibt er, 'ist die zweite, die eigene Ausbildung in der Phase des Lebens zu starten, in der man die Rechnung zwar bezahlen kann, ihre Höhe einem aber noch nicht egal ist.' Das Gleiche gilt für Wein. Der arme Mann, der Billigtrinker, wird zu Entscheidungen und Opfern gezwungen, die nur seine Urteilskraft schärfen können."Amit Chaudhuri preist Arun Kolatkar und die Neuauflage seines epischen Gedichts "Arun Kolatkar", das ihn in Chaudhuris Augen auf eine Stufe mit Salman Rushdie stellt. Jim Hoberman reflektiert die Wirkungsgeschichte von Robert Penn Warrens Roman "All the King's Men" von 1946, dessen Neuverfilmung mit Sean Penn bald in die Kinos kommt.
Tygodnik Powszechny (Polen), 22.10.2006
 Mit Beunruhigung registriert der Publizist Joachim Trenkner den immer intensiveren Flirt Putins mit dem Westen. "Deutschland als wichtigster russischer 'Brückenkopf' in Europa - das ist Putins Ziel, und deshalb versucht er, seine deutschen Partner dazu zu überreden, sich für russische Investitionen zu öffnen." Die Koalition in Berlin sei sich uneinig, wie weit man sich öffnen wolle. Aber schon jetzt sollte man sich fragen, wie viel Abhängigkeit im Energiesektor zulässig ist, wie weit man mit einer der korrumpiertesten Wirtschaften der Welt kooperieren will, und wie man den vorhersehbaren Konflikt mit den Ländern Ostmitteleuropas, insbesondere Polen, lösen will, so Trenkner.
Mit Beunruhigung registriert der Publizist Joachim Trenkner den immer intensiveren Flirt Putins mit dem Westen. "Deutschland als wichtigster russischer 'Brückenkopf' in Europa - das ist Putins Ziel, und deshalb versucht er, seine deutschen Partner dazu zu überreden, sich für russische Investitionen zu öffnen." Die Koalition in Berlin sei sich uneinig, wie weit man sich öffnen wolle. Aber schon jetzt sollte man sich fragen, wie viel Abhängigkeit im Energiesektor zulässig ist, wie weit man mit einer der korrumpiertesten Wirtschaften der Welt kooperieren will, und wie man den vorhersehbaren Konflikt mit den Ländern Ostmitteleuropas, insbesondere Polen, lösen will, so Trenkner.Ewa Baliszewska empfiehlt den Besuch einer Ausstellung zu afroamerikanischer Kunst, die in der Warschauer Nationalgalerie "Zacheta" gezeigt wird. Gleichzeitig spricht sie auch das wichtigste Problem dieser Richtung an: das der Authentizität. "Die romantische Vision des schwarzen Künstlers, der sich auf der Suche nach Inspiration in seine afrikanischen Wurzeln vertieft, ist sowohl Aushängeschild als auch die größte Bedrohung der afroamerikanischen Kunst. Einige Kritiker meinen gar, sie sei geschaffen worden, um die Bedürfnisse von Weißen zu befriedigen. Im Kontext der schwarzen Pop-Kultur sind diese Vorwürfe besonders aktuell." So erzählt der Fotograf Hank Willis Thomas, wie er von weißen Freunden vorwurfsvoll gefragt wurde: "Hank, du hörst keinen Rap?! Also sind wir schwärzer als du?"
Express (Frankreich), 19.10.2006
 In einem seiner eher seltenen Interviews gibt Prince ausführlich Auskunft über seine Herkunft, die Gründe für seine Verwandlung in den "Hermaphroditen" The Artist und die "Gangster" in seiner Plattenfirma Warner. Die gibt dieser Tage eine DVD mit bisher unveröffentlichten Videos von Stücken seines Albums "Diamonds and Pearls" von 1991 heraus. Sehr hübsch ist der Beginn des Interviews. Prince erkundigt sich zunächst, ob die Interviewerin vereinbarungsgemäß weder Fotoapparat, Handy noch Aufnahmegerät dabei habe. Auf die Gegenfrage, ob sie wenigstens mitschreiben dürfe, erzählt er ihr von einem Interviewtermin in den USA. "Ich habe neulich einem amerikanischen Journalisten ein zweistündiges Interview zugestanden, unter der Bedingung, dass er sich keinerlei Notizen macht. Alle zehn Minuten ist er aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. Er hat mir was von einem Nierenleiden erzählt. In Wahrheit hat er dort aus Angst, alles zu vergessen, meine Antworten auf Klopapier geschrieben... Ich musste lachen, als er, bevor er gegangen ist, lauter vollgekritzelte Papierknäuel aus seinen Taschen beförderte und seine Sünde beichtete."
In einem seiner eher seltenen Interviews gibt Prince ausführlich Auskunft über seine Herkunft, die Gründe für seine Verwandlung in den "Hermaphroditen" The Artist und die "Gangster" in seiner Plattenfirma Warner. Die gibt dieser Tage eine DVD mit bisher unveröffentlichten Videos von Stücken seines Albums "Diamonds and Pearls" von 1991 heraus. Sehr hübsch ist der Beginn des Interviews. Prince erkundigt sich zunächst, ob die Interviewerin vereinbarungsgemäß weder Fotoapparat, Handy noch Aufnahmegerät dabei habe. Auf die Gegenfrage, ob sie wenigstens mitschreiben dürfe, erzählt er ihr von einem Interviewtermin in den USA. "Ich habe neulich einem amerikanischen Journalisten ein zweistündiges Interview zugestanden, unter der Bedingung, dass er sich keinerlei Notizen macht. Alle zehn Minuten ist er aufgestanden, um zur Toilette zu gehen. Er hat mir was von einem Nierenleiden erzählt. In Wahrheit hat er dort aus Angst, alles zu vergessen, meine Antworten auf Klopapier geschrieben... Ich musste lachen, als er, bevor er gegangen ist, lauter vollgekritzelte Papierknäuel aus seinen Taschen beförderte und seine Sünde beichtete." Al Ahram Weekly (Ägypten), 19.10.2006
 Freude über den Literatur-Nobelpreis für Orhan Pamuk kommt bei dem libanesischen Autor Elias Khoury nicht richtig auf. Eher stützt sein Beitrag die These, die Entscheidung der Schwedischen Akademie sei politisch motiviert gewesen: "Hat Pamuk den Preis stellvertretend für einen armenischen Autor bekommen? Ist Pamuk Held eines Romans geworden, den er selbst nie geschrieben hat? Dieses Verwechselspiel fasziniert mich. Es ist die Rache des Textes am Autor, der glaubt, seine Intelligenz ermögliche es ihm, die Suppe, die er den Helden seiner Romane auszulöffeln gab, selbst nicht essen zu müssen. War dies nicht das Schicksal von Salman Rushdie, Kafka und Emile Habibi?"
Freude über den Literatur-Nobelpreis für Orhan Pamuk kommt bei dem libanesischen Autor Elias Khoury nicht richtig auf. Eher stützt sein Beitrag die These, die Entscheidung der Schwedischen Akademie sei politisch motiviert gewesen: "Hat Pamuk den Preis stellvertretend für einen armenischen Autor bekommen? Ist Pamuk Held eines Romans geworden, den er selbst nie geschrieben hat? Dieses Verwechselspiel fasziniert mich. Es ist die Rache des Textes am Autor, der glaubt, seine Intelligenz ermögliche es ihm, die Suppe, die er den Helden seiner Romane auszulöffeln gab, selbst nicht essen zu müssen. War dies nicht das Schicksal von Salman Rushdie, Kafka und Emile Habibi?"Weitere Artikel: Hani Mustafa resümiert den Wettbewerb der Ramadan Soaps im ägyptischen Fernsehen und stellt fest, dass religiöse Themen sehr gefragt waren. Und angesichts der Entwicklungen im Irak, Iran und Libanon sorgt sich Rasha Saad um das friedliche Zusammenleben von Sunniten und Schiiten in Ägypten: "Ob in den Medien oder innerhalb der muslimischen Gemeinde - die Schiiten geraten zunehmend ins Schussfeld."
Point (Frankreich), 19.10.2006
 Bernard-Henri Levy kommt noch mal auf den Mord an Anna Politkowskaja zurück, schlägt vor, dem Präsidenten Putin die Mitgliedschaft in der Ehrenlegion abzuerkennen und ihn bei jedem politischen Treffen mit dem Fall zu konfrontieren: "Man darf ihn nicht mehr in Frieden lassen, bis diese Tagödie ins letzte Detail aufgeklärt wurde. Es darf keinen Gipfel, keinen Staatsbesuch, keine Pressekonferenz mehr geben, ohne dass ihm die Frage gestellt wird: 'Nun? Wie sieht's aus? Was können Sie heute über die Auftraggeber dieses Verbrechens sagen, das unter Ihren Augen geschah?' Anna Politkowskaja war das Gewissen Russlands. Sie muss das schlechte Gewissen seines Präsidenten werden, der Geist, der ihn heimsucht, sein Gewissensbiss."
Bernard-Henri Levy kommt noch mal auf den Mord an Anna Politkowskaja zurück, schlägt vor, dem Präsidenten Putin die Mitgliedschaft in der Ehrenlegion abzuerkennen und ihn bei jedem politischen Treffen mit dem Fall zu konfrontieren: "Man darf ihn nicht mehr in Frieden lassen, bis diese Tagödie ins letzte Detail aufgeklärt wurde. Es darf keinen Gipfel, keinen Staatsbesuch, keine Pressekonferenz mehr geben, ohne dass ihm die Frage gestellt wird: 'Nun? Wie sieht's aus? Was können Sie heute über die Auftraggeber dieses Verbrechens sagen, das unter Ihren Augen geschah?' Anna Politkowskaja war das Gewissen Russlands. Sie muss das schlechte Gewissen seines Präsidenten werden, der Geist, der ihn heimsucht, sein Gewissensbiss."Nueva Sociedad (Argentinien), 01.10.2006
 Kritische Fragen zu den neusten politischen Entwicklungen in Lateinamerika stellt u. a. der französische Soziologe Alain Touraine in der aktuellen Ausgabe der von der Friedrich Ebert Stiftung mitherausgegebenen Zeitschrift Nueva Sociedad: "Die Ergebnisse mehrerer Wahlen in Lateinamerika während der letzten Monate haben Beobachter dazu verführt, von einem Linksrutsch zu sprechen, der sich auf eine breite soziale Basis stützen kann. Die Begriffe 'links' wie auch 'rechts' sind jedoch ungeeignet, um die gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen Lateinamerikas zu beschreiben: Der gesamte Kontinent scheint sich im Gegenteil zusehends vom herkömmlichen Modell einer parlamentarischen Opposition mit Interessengruppen unterschiedlicher Ideologien zu entfernen. Es ist nicht gelungen, eine Verbindung zwischen den diversen sozialen Bewegungen und Parteien herzustellen, die eindeutig bereit wären, die gesellschaftlichen Konflikte in einem, zumindest formell, demokratisch-konstitutionellen Rahmen auszutragen. Lateinamerika scheint so heute weiter von einer politischen Lösung seiner sozialen Probleme entfernt als noch vor 30 Jahren."
Kritische Fragen zu den neusten politischen Entwicklungen in Lateinamerika stellt u. a. der französische Soziologe Alain Touraine in der aktuellen Ausgabe der von der Friedrich Ebert Stiftung mitherausgegebenen Zeitschrift Nueva Sociedad: "Die Ergebnisse mehrerer Wahlen in Lateinamerika während der letzten Monate haben Beobachter dazu verführt, von einem Linksrutsch zu sprechen, der sich auf eine breite soziale Basis stützen kann. Die Begriffe 'links' wie auch 'rechts' sind jedoch ungeeignet, um die gegenwärtigen gesellschaftlichen Entwicklungen Lateinamerikas zu beschreiben: Der gesamte Kontinent scheint sich im Gegenteil zusehends vom herkömmlichen Modell einer parlamentarischen Opposition mit Interessengruppen unterschiedlicher Ideologien zu entfernen. Es ist nicht gelungen, eine Verbindung zwischen den diversen sozialen Bewegungen und Parteien herzustellen, die eindeutig bereit wären, die gesellschaftlichen Konflikte in einem, zumindest formell, demokratisch-konstitutionellen Rahmen auszutragen. Lateinamerika scheint so heute weiter von einer politischen Lösung seiner sozialen Probleme entfernt als noch vor 30 Jahren."New Yorker (USA), 30.10.2006
 Unter der hübschen Überschrift "The Southern Discomfort" porträtiert Peter J. Boyer den Schriftsteller, ehemaligen Republikaner und Reagan-Berater und nun Demokraten James Webb, der gerade in Virgina das "seltsamste Senatorenrennen des Jahres" liefert. "Webbs Kampagne arbeitet schwer daran, ihn als die Art von Demokrat darzustellen, dem Ronald Reagan vertrauen konnte. Sein erster Werbespot zeigte eine Schwarzweiß-Fotografie von ihm in Uniform und Reagans Stimme erzählte dazu: 'James' Tapferkeit als Marineoffizier in Vietnam brachte ihm das Navy Cross und andere Auszeichnungen ein.' Dann erklang die Stimme eines Sprechers aus dem Off: 'Soldat. Wissenschaftler. Leitartikler. Und jetzt kandidiert Jim Webb für den Senat.' Nirgendwo in dem Werbeclip wurde das Wort Demokrat erwähnt."
Unter der hübschen Überschrift "The Southern Discomfort" porträtiert Peter J. Boyer den Schriftsteller, ehemaligen Republikaner und Reagan-Berater und nun Demokraten James Webb, der gerade in Virgina das "seltsamste Senatorenrennen des Jahres" liefert. "Webbs Kampagne arbeitet schwer daran, ihn als die Art von Demokrat darzustellen, dem Ronald Reagan vertrauen konnte. Sein erster Werbespot zeigte eine Schwarzweiß-Fotografie von ihm in Uniform und Reagans Stimme erzählte dazu: 'James' Tapferkeit als Marineoffizier in Vietnam brachte ihm das Navy Cross und andere Auszeichnungen ein.' Dann erklang die Stimme eines Sprechers aus dem Off: 'Soldat. Wissenschaftler. Leitartikler. Und jetzt kandidiert Jim Webb für den Senat.' Nirgendwo in dem Werbeclip wurde das Wort Demokrat erwähnt."Weiteres: Connie Bruck beschreibt, wie der diesjährige Friedensnobelpreisträger, der bengalische Wirtschaftswissenschaftler und Gründer der Grameen Bank Muhammad Yunus, mit einigen High-Tech-Unternehmern um die Verteilung von Krediten an die Armen dieser Welt konkurriert.
John Lahr bespricht das Theaterstück "My Name Is Rachel Corrie". Und David Denby sah im Kino "Flags of Our Fathers" von Clint Eastwood und "Babel" von Alejandro Gonzalez Inarritu, einem "der begabtesten Regisseure der Welt". Zu lesen ist außerdem die Erzählung "Republica and Grau" von Daniel Alarcon.
Le Monde diplomatique (Deutschland / Frankreich), 13.10.2006
Die Verachtung der französischen Banlieue und ihrer Vitalität ist auch von Neid geprägt, meint Denis Duclos: "Im Grunde regen sich bestimmte Intellektuelle freilich nur darüber auf, dass aus dieser unbändigen und manchmal tödlichen Vitalität eine starke Kultur hervorgegangen ist, die offenbar ansteckender wirkt als ihre eigene, vermeintliche Hochkultur. Sie bedauern weniger die mangelnde Integration oder die Orientierungslosigkeit als vielmehr die Tatsache, dass begeisterte Jugendliche und irgendwelche Medienleute dem in den Banlieues entstandenen Hiphop zu einem dauerhaften Phänomen und zu einem integrierenden Element gemacht haben."
Weiteres: Jeremy Brecher und Brendan Smith berichten über Widerstand gegen den Irakkrieg aus den Reihen der amerikanischen Konservativen, der in jüngster Zeit auch von hochrangigen Militärs getragen wird. Und Mathias Greffrath hat den Papst bei einem Teegespräch belauscht.
Weiteres: Jeremy Brecher und Brendan Smith berichten über Widerstand gegen den Irakkrieg aus den Reihen der amerikanischen Konservativen, der in jüngster Zeit auch von hochrangigen Militärs getragen wird. Und Mathias Greffrath hat den Papst bei einem Teegespräch belauscht.
Groene Amsterdammer (Niederlande), 23.10.2006
 Hubert Smeets nennt die Vorstellung des "Haager Kanons" (hier auch auf Englisch), ein in den Niederlanden langdiskutierter Leitfaden zur Geschichte des Landes, "die erste gute Nachricht der Woche". Der Auftrag für die Kommission, "im Vergangenen eine nationale Identität für die Zukunft zu finden, und mehr noch das überspannte Klima, in welchem die Kommission nur ein halbes Jahr nach der Ermordung Theo van Goghs beauftragt wurde, ließ befürchten, dass es ein echter Bergaufkampf werden würde, die Flagge der korrekten Geschichtsschreibung hoch zu halten. Die Furcht war unbegründet. Der hundert Seiten umfassende Kanon gibt eine punktgenaue Antwort auf die alte Frage: 'Was ist Geschichte?'"
Hubert Smeets nennt die Vorstellung des "Haager Kanons" (hier auch auf Englisch), ein in den Niederlanden langdiskutierter Leitfaden zur Geschichte des Landes, "die erste gute Nachricht der Woche". Der Auftrag für die Kommission, "im Vergangenen eine nationale Identität für die Zukunft zu finden, und mehr noch das überspannte Klima, in welchem die Kommission nur ein halbes Jahr nach der Ermordung Theo van Goghs beauftragt wurde, ließ befürchten, dass es ein echter Bergaufkampf werden würde, die Flagge der korrekten Geschichtsschreibung hoch zu halten. Die Furcht war unbegründet. Der hundert Seiten umfassende Kanon gibt eine punktgenaue Antwort auf die alte Frage: 'Was ist Geschichte?'""Die letzten elf Jahre nach dem Krieg wurden verspielt" erregt sich die Ärztin, Schriftstellerin und Tito-Enkelin Svetlana Broz in einem ausführlichen Interview mit Marte Kaan über die Ergebnisse der Wahlen in Bosnien-Herzegowina. Broz sieht ihr Land als Bauernopfer im Machtpoker der internationalen Gemeinschaft: "Ich vergleiche das gern mit der Lage Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Dort verbot die internationale Gemeinschaft die Nationalsozialistische Partei. In Bosnien-Herzegowina dagegen blieben die nationalistischen Parteien an der Macht, zwar unter anderem Namen, jedoch mit den gleichen Gesichtern wie vor dem Bosnienkrieg. Es gibt hier zu viele Politiker, die von der internationalen Gemeinschaft umworben werden und die zeitgleich in Den Haag oder vor einem anderen Tribunal erscheinen müssen. Und das kann nur Zweierlei bedeuten: Entweder lernt die internationale Gemeinschaft nur sehr langsam, oder sie profitiert von einer permanenten Instabilität in dieser Region."
New York Times (USA), 22.10.2006
 Das Magazin der New York Times bringt den ersten Teil einer langen Reportage über das Wiedererstarken der Taliban in Afghanistan. Elizabeth Rubin beschreibt die pakistanisch-afghanische Grenzregion als eine Art "Taliban Spa", wo die Kämpfer Erholung und neue Inspiration suchen, während die von den Amerikanern und der NATO sich selbst überlassene, unterbezahlte afghanische Polizei sich mit Opium berauscht: "Eines Nachmittags begegnete ich einer Gruppe Polizisten. Sie sagten, ihre Freunde seien gerade von einem als Polizist verkleideten Taliban vergiftet worden. Ein zottiger Officer in einer schwarzen Tunika schaute auf meine Füße. 'Ich beneide dich um deine Schuhe', sagte er mit Blick auf seine ausgetretenen Gummisandalen. 'Ich beneide dich um deinen Toyota'. Und als er meinen Stift und mein Notebook sah: 'Ich beneide dich darum, dass du lesen und schreiben kannst.' Er war 35 Jahre alt und davon 20 Jahre im Krieg."
Das Magazin der New York Times bringt den ersten Teil einer langen Reportage über das Wiedererstarken der Taliban in Afghanistan. Elizabeth Rubin beschreibt die pakistanisch-afghanische Grenzregion als eine Art "Taliban Spa", wo die Kämpfer Erholung und neue Inspiration suchen, während die von den Amerikanern und der NATO sich selbst überlassene, unterbezahlte afghanische Polizei sich mit Opium berauscht: "Eines Nachmittags begegnete ich einer Gruppe Polizisten. Sie sagten, ihre Freunde seien gerade von einem als Polizist verkleideten Taliban vergiftet worden. Ein zottiger Officer in einer schwarzen Tunika schaute auf meine Füße. 'Ich beneide dich um deine Schuhe', sagte er mit Blick auf seine ausgetretenen Gummisandalen. 'Ich beneide dich um deinen Toyota'. Und als er meinen Stift und mein Notebook sah: 'Ich beneide dich darum, dass du lesen und schreiben kannst.' Er war 35 Jahre alt und davon 20 Jahre im Krieg."Ferner: Jeneen Interlandi dokumentiert einen besonders schweren Fall von wissenschaftlichem Betrug. Alex Witchel porträtiert die Choreografin Twyla Tharp und stellt ihr neues Broadway-Projekt vor. Und im Gespräch mit Deborah Solomon erklärt der Princeton-Philosoph und Bestseller-Autor Harry G. Frankfurt ("Bullshit"), wie wir zur Wahrheit finden: durch Selbstlosigkeit.
Ist Gott eine Illusion? Die zu einer positiven Antwort führende Argumentation des Evolutionsbiologen Richard Dawkins in seinem Buch "The God Delusion" (Auszug) kommt Jim Holt in der Book Review bekannt vor: "Erstens, misstraue den üblichen Begründungen für die Existenz Gottes. Zweitens, sammle ein, zwei Argumente für die gegenteilige Hypothese. Drittens, streue Zweifel an den transzendenten Ursprüngen der Religion und zeige, dass es für sie eine natürliche Erklärung gibt. Zuletzt zeigst du, dass ein glückliches und sinnvolles Dasein ohne Gott möglich und Religion kein Garant für Moralität ist, sondern mehr Böses als Gutes schafft." Nach dem Prinzip, so Holt, funktionierte schon Bertrand Russells "Why I Am Not a Christian" von 1927. Die Gottesfrage aber bleibt für ihn spekulativ und das Buch also "eine intellektuell frustrierende Erfahrung".
Außerdem: Marcel Theroux entdeckt in dem Cicero aus Robert Harris' historischem Thriller "Imperium" (Auszug) einen modernen Politiker. Christopher Benfey lobt Michael Hofmanns Übertragung von Thomas Bernhards Roman "Frost" (Auszug), der erstmals auf Englisch erscheint. Und Henry Louis Gates Jr. macht sich an eine Revision von Harriet Beecher Stowes Roman "Onkel Toms Hütte" und entdeckt anstelle von Sentimentalität: Sex!
The Atlantic | Foglio | Guardian | Tygodnik Powszechny | Express | Al Ahram Weekly | Point | Nueva Sociedad | New Yorker | Le Monde diplomatique | Groene Amsterdammer | Outlook India | New York Times | Espresso | Elet es Irodalom | Magyar Hirlap | Gazeta Wyborcza | New Republic | al-Sharq al-Awsat | Economist







