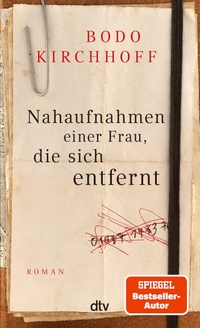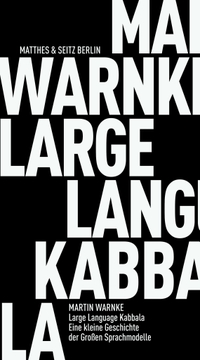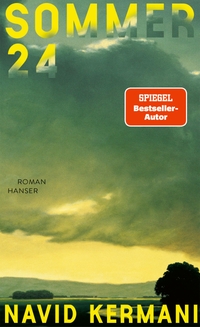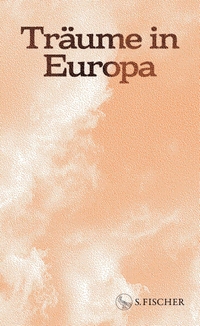Magazinrundschau
Die Magazinrundschau
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
29.04.2002. Jean Daniel gibt im NouvelObs der Linken die Schuld am Erfolg Berlusconis, Bushs, Scharons und Le Pens. Arundhati Roy fürchtet in Outlook India um die Demokratie in Indien. Ian Buruma fürchtet in The New Republic um Arundhati Roy. Mark Lilla denkt im Merkur über tyrannophile Intellektuelle nach. Mark Cousins erklärt im Prospect, warum er Billy-Wilder-Filme nur im Fernsehen sehen mag. Literaturen widmet sich deutschen Mythen. Der New Yorker stellt Arafats mildesten Mann vor: Sari Nusseibeh.
New Yorker | New York Times | Economist | The Atlantic | Nouvel Observateur | Express | Outlook India | New Republic | Merkur | Spiegel | Prospect | Literaturen
New Yorker (USA), 29.04.2002
 Adam Gopnik kommentiert die französischen Wahlen: "The situation is scarier than anyone wants to say, simply because if, by some hideous mischance, or some strange perversity of purpose - and perversities of purpose are not unknown in France - Le Pen were to be elected President in the second round of voting, next week, France would undergo a revolution of one kind or another, and the Fifth Republic would come to an end." Den Grund für das Disaster sieht Gopnik einmal in der Verfassung der Fünften Republik, die deGaulle auf sich zugeschnitten hatte, und zum anderen in der Haltung der französischen Intellektuellen: "The intellectual classes, who matter in France as they do nowhere else in Europe, share some responsibility for encouraging the kind of self-indulgent utopianism that deprecates even successful parliamentary politics as empty and distasteful."
Adam Gopnik kommentiert die französischen Wahlen: "The situation is scarier than anyone wants to say, simply because if, by some hideous mischance, or some strange perversity of purpose - and perversities of purpose are not unknown in France - Le Pen were to be elected President in the second round of voting, next week, France would undergo a revolution of one kind or another, and the Fifth Republic would come to an end." Den Grund für das Disaster sieht Gopnik einmal in der Verfassung der Fünften Republik, die deGaulle auf sich zugeschnitten hatte, und zum anderen in der Haltung der französischen Intellektuellen: "The intellectual classes, who matter in France as they do nowhere else in Europe, share some responsibility for encouraging the kind of self-indulgent utopianism that deprecates even successful parliamentary politics as empty and distasteful."David Remnick porträtiert in seinem sehr langen Brief aus Jerusalem einen Palästinenser, den die Israelis "the pretty face of terrorism" nennen. Es geht um Sari Nusseibeh, Arafats Repräsentant in Ost-Jerusalem. Er ist "perhaps the most moderate adviser in the councils of Yasir Arafat. (He is no doubt the only one to have worked on a kibbutz or to have written a graduate-school essay at Harvard on Wittgenstein and the role of jokes in philosophical discourse.) On many issues of moment within the Palestinian hierarchy - the morality of suicide bombings, the wisdom of Arafat's rejection of the Israeli offers at Camp David and at Taba, the refugees' demand for the 'right of return' to historical Palestine - Nusseibeh disagrees, publicly and in all languages, with the hard men of the P.L.O. and Hamas, and even with Arafat (to the extent that Arafat reveals himself). To him, 'martyr operations' are blatantly 'immoral', the flat rejection of the Israeli proposals a 'major missed opportunity', and the right of return a painful delusion best forgotten. It is not obvious why Arafat, who craves the support and supposed authenticity of the maximalists of Hamas and Islamic Jihad, appointed a mild man in corduroy and tweed to run the East Jerusalem portfolio."
Besprochen werden Geoffrey Walls Flaubert-Biografie, Noel Cowards "Private Lives" und die Filme "Murder by Numbers" von Barbet Schroeder und "Changing Lanes" von Roger Michell. Lesen darf man außerdem Andrea Lees Erzählung "The Prior's Room".
Nur im Print: Tja, wenn man das nur sagen könnte. Der New Yorker liebt kryptische Überschriften. Jane Kramer schreibt eine große Reportage über einen "militia leader and his impatient followers", Nicolas Lehman porträtiert einen "Democrat to watch". Doch um wenn es sich jeweils handelt, erfahren wir im Internet leider nicht.
Nouvel Observateur (Frankreich), 25.04.2002
 Immer mag man ihn nicht lesen, aber bei großen Ereignissen läuft der große alte Publizist Jean Daniel, der eine wöchentliche Kolumne im NouvelObs hat, zu großer Form auf. Er kommentiert das Versagen der Linken, das den Aufstieg Le Pens in den Wahlen ermöglichte und zieht den Fokus weiter auf: "Die Linke war sicher, dass sie noch im zweiten Wahlgang für Jospin stimmen konnte, und fuhr ins Wochenende oder stimmte für einen chancenlosen Kandidaten. Aber das Versagen vor der bürgerlichen Pflicht der einen oder die Laune der anderen tragen unverantwortliche Züge. Aus der Geschichte wissen wir, dass beispielsweise die Kommunisten häufig den Feind dem Gegner vorzogen - lieber Faschismus als Sozialdemokratie. In der jüngeren Vergangenheit konnten wir zusehen, wie Ralph Nader, der Vater der amerikanischen Ökologiebewegung, zum Wahlsieg Bushs beitrug, wie die Spaltung in der italienischen Linken Berlusconi zum Sieg führte, und welche gefährliche Rolle Shimon Peres spielte, als er, gegen seinen Gegner Barak, den Sieg seines Feindes Scharon erleichterte. All diese Leute haben dem Schlimmsten, was es in ihrem Land gibt, den Sieg gesichert."
Immer mag man ihn nicht lesen, aber bei großen Ereignissen läuft der große alte Publizist Jean Daniel, der eine wöchentliche Kolumne im NouvelObs hat, zu großer Form auf. Er kommentiert das Versagen der Linken, das den Aufstieg Le Pens in den Wahlen ermöglichte und zieht den Fokus weiter auf: "Die Linke war sicher, dass sie noch im zweiten Wahlgang für Jospin stimmen konnte, und fuhr ins Wochenende oder stimmte für einen chancenlosen Kandidaten. Aber das Versagen vor der bürgerlichen Pflicht der einen oder die Laune der anderen tragen unverantwortliche Züge. Aus der Geschichte wissen wir, dass beispielsweise die Kommunisten häufig den Feind dem Gegner vorzogen - lieber Faschismus als Sozialdemokratie. In der jüngeren Vergangenheit konnten wir zusehen, wie Ralph Nader, der Vater der amerikanischen Ökologiebewegung, zum Wahlsieg Bushs beitrug, wie die Spaltung in der italienischen Linken Berlusconi zum Sieg führte, und welche gefährliche Rolle Shimon Peres spielte, als er, gegen seinen Gegner Barak, den Sieg seines Feindes Scharon erleichterte. All diese Leute haben dem Schlimmsten, was es in ihrem Land gibt, den Sieg gesichert."Im Literaturteil können wir einem pikanten Pas de deux zusehen: Alain Finkielkraut und Pascal Bruckner, die beide zu den besten öffentlichen Denkern Frankreichs gehören, haben vor Jahren einige Bücher (zum Beispiel "Die neue Liebesunordnung") zusammen veröffentlicht, dann haben sich ihre Wege getrennt. Heute erinnert sich Finkielkraut an seine einstige Zusammenarbeit mit Bruckner ("zusammen mit ihm schafffte ich es, meinen Stil zu entkrampfen und Bücher zu schreiben"), und Pascal Bruckner bespricht Alain Finkielkrauts neues Buch "L'imparfait du present" - eine Art Tagebuch des letzten Jahres, von "Big Brother" bis zum 11. September - und freut sich wiederum über eine gewisse Entkrampfung des Stils: "Dem aristokratischen Vergnügen, zu missfallen, dieser Lust, allein gegen alle zu kämpfen, mit dem Rücken zur Wand - nichts begeistert ihn mehr als ein Publikum, das ihn auspfeift - scheint er heute den demokratischen Willen, zu überzeugen, vorzuziehen."
Express (Frankreich), 25.04.2002
 Frankreich ist erschüttert vom Erfolg der extremen Rechten bei dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen in der vergangenen Woche. Denis Jeambar verleiht in einem offenen Brief an Jacques Chirac seinem Entsetzen Ausdruck. Jeambar stimmt dem Politologen Pascal Perrineau zu, der in seinem Buch über die Front National "Le symptome Le Pen" schreibt: "Die erstaunlichen Wahlerfolge der FN beweisen, dass sich die französische Gesellschaft von einer offenen Gesellschaft in eine geschlossene Gesellschaft verwandelt." Der Brief legt Jacques Chirac nahe, seinen voraussichtlichen Wahlerfolg in der zweiten Runde nicht vorschnell als Sieg zu verstehen. "Der Präsident wird erst in einem zweiten Wahlgang gewählt werden", schreibt Jeambar, "aber gerade der erste zeigt das wahre Gesicht Frankreichs."
Frankreich ist erschüttert vom Erfolg der extremen Rechten bei dem ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahlen in der vergangenen Woche. Denis Jeambar verleiht in einem offenen Brief an Jacques Chirac seinem Entsetzen Ausdruck. Jeambar stimmt dem Politologen Pascal Perrineau zu, der in seinem Buch über die Front National "Le symptome Le Pen" schreibt: "Die erstaunlichen Wahlerfolge der FN beweisen, dass sich die französische Gesellschaft von einer offenen Gesellschaft in eine geschlossene Gesellschaft verwandelt." Der Brief legt Jacques Chirac nahe, seinen voraussichtlichen Wahlerfolg in der zweiten Runde nicht vorschnell als Sieg zu verstehen. "Der Präsident wird erst in einem zweiten Wahlgang gewählt werden", schreibt Jeambar, "aber gerade der erste zeigt das wahre Gesicht Frankreichs."Romain Rosso und Sebastien Lebourg zeichnen den Aufstieg Le Pens und die Geschichte der Front National nach. Als Etappensieg deuten sie den Erfolg Le Pens in der ersten Runde. Frankreich muss auch den Parlamentswahlen ängstlich entgegen sehen. Wie Europa auf die französischen Wahlen reagiert hat, dokumentiert der Express in einer Reportage.
Weitere Artikel: Auf dem Filmfestival in Cannes wird dank Jerome Dechamps und Macha Makeieff eine restaurierte Fassung von "Playtime" gezeigt werden. Ihr Anliegen war es, die Leichtigkeit und den Humor Jacques Tatis zu bewahren. Auf Arte ist der Regisseur am 20. Mai in der Rolle des unbeholfenen und liebenswürdigen Monsieur Hulot zu sehen. In seinem Film "Trafic" regelt er das Chaos wie üblich mit Pfeife, Hut, Regenmantel und Hochwasserhose. Außerdem erzählt Olivier Le Naire von einem mythischen Ort mitten in Paris: Der ehemaligen Bibliotheque Nationale in der Rue de Richelieu mit ihrem berühmten "Salle Labrouste", in dem sich schon so manch einer - der dann später auch berühmt geworden ist - den Kopf zerbrochen hat. Die Bibliothek beherbergt allerlei Handgeschriebenes von Pascal, Hugo, Flaubert, Proust oder auch von dem ein oder anderen französischen König. Was in Zukunft mit dem Gebäude und den archivierten Schätzen passieren soll, ist noch offen.
Daniel Rondeau empfiehlt Bücher über Marie-Antoinette, die schon als 15-Jährige den Spiegelsaal in Versailles durchschritt und auf ihre Heiratsurkunde erst mal einen dicken Tintenfleck kleckste. Besprochen wird der Band "Les Maitres censeurs" von Elisabeth Levy. Sie geht darin der Verfolgung französischer Intellektueller nach.
Und: Sabrina Dalanglade hat mit dem Soziologen Manuel Castells über sein Werk "Das Informationszeitalter" (mehr hier) gesprochen. Es scheint so, als hätten die Franzosen nach wie vor ein neurotische Verhältnis zum World Wide Web. Castells vergleicht, inwieweit Frankreich und Amerika diese technische Revolution geprägt haben und resümiert: "Das Internet bedeutet für mich Freiheit. Es ist beeinflusst worden von der liberalen Atmosphäre an den amerikanischen Universitäten. Es versteht sich von selbst, warum die Franzosen zuerst das Minitel bevorzugt haben: Es ist einfach das bürokratischere System."
Outlook India (Indien), 29.04.2002
 (Coverdatum 6.5.02) Anzuzeigen ist ein neuer, dazu unverschämt langer Essay von Arundhati Roy. Roy fürchtet die Dämmerung der Demokratie in ihrem Land und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Hindutva und die indische Regierung angesichts der massiven Ausschreitungen gegen indische Muslime. "Every independent report says the pogrom against the Muslim community in Gujarat-billed by the government as spontaneous 'retaliation'-has at best been conducted under the benign gaze of the State and, at worst, with active State collusion. Either way the State is criminally culpable. And the State acts in the name of its citizens. So as a citizen, I am forced to acknowledge that I am somehow made complicit in the Gujarat pogrom. It is this that outrages me." Jeder einzelne müsse jetzt gegen den Faschismus und für soziale Gerechtigkeit kämpfen, in allen denkbaren gesellschaftlichen Bereichen. "If not, then years from now, when the rest of the world has shunned us (as it should), like the ordinary citizens of Hitler's Germany, we too will learn to recognise revulsion in the gaze of our fellow human beings. We too will find ourselves unable to look our own children in the eye, for the shame of what we did and did not do. For the shame of what we allowed to happen.This is us. In India. Heaven help us make it through the night."
(Coverdatum 6.5.02) Anzuzeigen ist ein neuer, dazu unverschämt langer Essay von Arundhati Roy. Roy fürchtet die Dämmerung der Demokratie in ihrem Land und erhebt schwere Vorwürfe gegen die Hindutva und die indische Regierung angesichts der massiven Ausschreitungen gegen indische Muslime. "Every independent report says the pogrom against the Muslim community in Gujarat-billed by the government as spontaneous 'retaliation'-has at best been conducted under the benign gaze of the State and, at worst, with active State collusion. Either way the State is criminally culpable. And the State acts in the name of its citizens. So as a citizen, I am forced to acknowledge that I am somehow made complicit in the Gujarat pogrom. It is this that outrages me." Jeder einzelne müsse jetzt gegen den Faschismus und für soziale Gerechtigkeit kämpfen, in allen denkbaren gesellschaftlichen Bereichen. "If not, then years from now, when the rest of the world has shunned us (as it should), like the ordinary citizens of Hitler's Germany, we too will learn to recognise revulsion in the gaze of our fellow human beings. We too will find ourselves unable to look our own children in the eye, for the shame of what we did and did not do. For the shame of what we allowed to happen.This is us. In India. Heaven help us make it through the night."Im übrigen ist das Heft dem indischen Mann gewidmet. Aber Vorsicht! Dahinter könnte stets auch eine jener Frauen in Hosen stecken, gegen die Anil Thakraney ein zorniges Pamphlet verfasst ("They want to pee in unisex loos. Because a separate toilet is a stinking sign of discrimination"). Und den indischen Mann gibt es ohnehin nicht, wie ein anderer Beitrag uns belehrt, sondern jedes Medium kreiert gewissermaßen seinen eigenen: "On television you see the Fair and Lovely young man ... The Indian soap opera man is likely to be the bloke-next-door, the kind you bring home to mama and marry ... In the movies he does take his shirt off, exposing on occasion more cleavage than his heroine. He is larger than life. And he's dark and dangerous when he is not being fair and lovely and moony. This bicep-ed biped flexes his muscles, not his brain ... In advertising ... he's the perfect and caring son, lover, husband, and increasingly, father. Television ads for cars (Maruti particularly), insurance, banks, household appliances bring out the nurturing side of the Indian male." Keine Frage, welcher uns am besten gefällt.
New Republic (USA), 22.04.2002
(Coverdatum: 29.4.2002) Arundhati Roys politische Essays, darunter die beiden berühmten Essays über den 11. September (hier und hier) sind als Bücher erschienen (mehr hier und hier). Ian Buruma (Autor von "Anglomania") rezensiert sie für The New Republic der letzten Woche. Jetzt ist der Artikel online. Er würdigt Roys Interventionen gegen indische Staudammprojekte, wenn auch mit kritischen Untertönen, um dann eine scharfe Attacke gegen ihre Position zum 11. September zu lancieren: "Wenn Roy versucht, die weite Welt in Angriff zu nehmen und gegen die amerikanische Intervention in Afghanistan oder gegen die 'Globalisierung' zu wüten, beginnen ihre stilistischen Ticks zu irritieren. Ihre Dämonologie der Vereinigten Staaten erinnert an die schäumende, augenrollende Rhetorik verrückter Evangelisten. Dummerweise hat sie gerade hiermit, und nicht mit ihren Kampgnen gegen die Staudammprojekte, weltweites Gehör gefunden. Roy wurde zur perfekten Stimme der Dritten Welt, für antiamerikanische, antiwestliche oder sogar anti-weiße Gefühle. Diese Gefühle liegen Intellektuellen in aller Welt am Herzen, sogar in den Vereinigten Staaten." Buruma selbst hat einen ebenfalls umstrittenen Essay über "Occidentalism" geschrieben, auf den wir hier schon mehrfach verwiesen haben.
Merkur (Deutschland), 01.05.2002
In der Mai-Ausgabe des Merkur geht es vor allem um Terror und Ökonomie. Wie immer hat der Merkur nur zwei Texte ins Netz gestellt. In einem der beiden geht der Chicagoer Politikwissenschaftler Mark Lilla dem Phänomen der Tyrannenliebe nach. "Das Problem des Dionysios ist so alt wie die Schöpfung. Das seiner intellektuellen Parteigänger ist neu. Mit Kommunismus und Faschismus entstand auch ein neuer Typus, für den wir einen neuen Namen brauchen: der tyrannophile Intellektuelle. Einige der bedeutendsten Denker jener Epoche, deren Werk noch heute von Bedeutung für uns ist, scheuten sich nicht, dem modernen Dionysios in Wort und Tat zu dienen; berüchtigte Fälle sind Martin Heidegger und Carl Schmitt in Nazi-Deutschland, Georg Lukacs in Ungarn ... Eine erstaunlich große Zahl pilgerte zum neuen Syrakus in Moskau, Berlin, Hanoi und Havanna - politische Voyeure, die mit Rückfahrkarten in der Tasche sorgfältig choreografierte Rundreisen durch die Ländereien des Tyrannen machten, landwirtschaftliche Kollektive, Traktorfabriken, Zuckerrohrplantagen, Schulen bewunderten, aber irgendwie nie dazu kamen, die Gefängnisse zu besuchen"
Stephan Krass prangert den ökonomiefixierten Blick an, mit dem Amerika "den Preis zum Maß aller Dinge" gemacht habe: "Die amerikanische Gesellschaft ist von allem Anfang auf Ökonomie gegründet, weil nur die Geldwirtschaft über ein integratives Steuerungspotential verfügte, das die Pluralität der größten Völkerwanderung der Weltgeschichte auf ein gemeinsames Programm verpflichten konnte. 'In God We Trust' steht auf der Kopfseite der Dollarmünze. 'E pluribus unum' steht auf der anderen Seite. Einheit durch Vielfalt. Das ist die Kehrseite der Medaille. Kopf oder Zahl, beides zählt, man kann es drehen und wenden, wie man will. Jenes 'unum', Das Eine, das die vielen verschiedenen Einflüsse zusammenhält, ist der Dollar. Und Gott ist unser Zeuge."
Nur in der Print-Ausgabe: Der Soziologe Heinz Bude beschreibt die politische Ökonomie des zukünftigen Kapitalismus, in dem vor allem Wissen, Geld und Macht wirken. Konrad Adam sieht die Ethik gegenüber der Wissenschaft in die Zweitrangigkeit verbannt: "Man will, was man kann." Weitere Artikel beschäftigen sich mit den Regimen des Terrors, der Zukunft des Sozialstaats oder dem Wandel der Konservativen in den USA.
Stephan Krass prangert den ökonomiefixierten Blick an, mit dem Amerika "den Preis zum Maß aller Dinge" gemacht habe: "Die amerikanische Gesellschaft ist von allem Anfang auf Ökonomie gegründet, weil nur die Geldwirtschaft über ein integratives Steuerungspotential verfügte, das die Pluralität der größten Völkerwanderung der Weltgeschichte auf ein gemeinsames Programm verpflichten konnte. 'In God We Trust' steht auf der Kopfseite der Dollarmünze. 'E pluribus unum' steht auf der anderen Seite. Einheit durch Vielfalt. Das ist die Kehrseite der Medaille. Kopf oder Zahl, beides zählt, man kann es drehen und wenden, wie man will. Jenes 'unum', Das Eine, das die vielen verschiedenen Einflüsse zusammenhält, ist der Dollar. Und Gott ist unser Zeuge."
Nur in der Print-Ausgabe: Der Soziologe Heinz Bude beschreibt die politische Ökonomie des zukünftigen Kapitalismus, in dem vor allem Wissen, Geld und Macht wirken. Konrad Adam sieht die Ethik gegenüber der Wissenschaft in die Zweitrangigkeit verbannt: "Man will, was man kann." Weitere Artikel beschäftigen sich mit den Regimen des Terrors, der Zukunft des Sozialstaats oder dem Wandel der Konservativen in den USA.
Spiegel (Deutschland), 29.04.2002
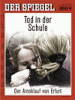 Im Titeldossier zum Amoklauf von Erfurt erwägt der Traumatherapeut Georg Pieper die Folgen für Lehrer und Schüler. Und Gisela Friedrichsen schreibt über einen Prozess in Erfurt gegen eine junge Frau, die ihre Schule angezündet hatte, weil sie nicht zum Abitur zugelassen worden war.
Im Titeldossier zum Amoklauf von Erfurt erwägt der Traumatherapeut Georg Pieper die Folgen für Lehrer und Schüler. Und Gisela Friedrichsen schreibt über einen Prozess in Erfurt gegen eine junge Frau, die ihre Schule angezündet hatte, weil sie nicht zum Abitur zugelassen worden war. Voll im Trend junger ostdeutscher Literatur liegt ein Buch, das der Spiegel in seinem Kulturteil vorstellt: "Denn wir sind anders", die tragische Geschichte des farbigen ostdeutschen Hooligans Felix Mkhonto S., recherchiert und aufgeschrieben von der Berliner Journalistin Jana Simon. Für Eva-Maria Schnurr "ein parteiisch geschriebener Text, der trotz eines manchmal betulichen Stils fesselt. Und ein Buch, das mit der detaillierten Schilderung der vergangenen zehn Jahre, vor allem der Berliner Türsteher- und Hooligan-Szene, ein bislang wenig beachtetes Kapitel der Nachwende-Gesellschaft einfängt. 'Denn wir sind anders' fängt da an, wo Thomas Brussigs 'Am kürzeren Ende der Sonnenallee' aufhört. Jana Simon nimmt ein bißchen wehmütig Abschied von einer Zeit und einer Stadt, die es so nicht mehr gibt: Ost-Berlin."
Außerdem: Thomas Hüetlin versucht in einem längeren Beitrag das Gezerre um Martin Scorseses Monumentalsaga "Gangs of New York" transparent zu machen, die in Cannes nur als Trailer zu sehen sein wird (siehe dazu auch unsere Post aus New York). Wir lesen über den Siegeszug einer österreichischen Notebook-Firma, die sich kauzigerweise Gericom (für German Industry Computers) nennt, und erfahren (in einem Interview der Printausgabe), was Jean-Marie Le Pen gegen Europa hat.
Prospect (UK), 01.05.2002
 Eine Hommage mit Vorbehalten auf Billy Wilder schreibt Mark Cousins im Prospect. Er war ein Gott, meint Cousins, Hollywoods größter Erzähler womöglich, aber nur auf der Mattscheibe. "I saw the great Wilders on television. There, they are masterpieces. The Apartment is balanced, beautiful and wise on the small screen. Some Like it Hot is an annual delight. Sunset Boulevard has for years made Saturday afternoons gothic ... I watched Wilder films on the big screen. It was an extremely unsettling experience. I knew that The Apartment was made in widescreen Panavision, but the acres of space around Jack Lemmon's and Shirley MacLaine's heads robbed the film of clarity and intimacy. With more films, I noticed something worse. Wilder's movies are so beautifully structured and preconceived that there is nothing with them that is abstract: no pauses, no excess, nothing purely formal or expressive. It's all reducible to words; nothing is pure cinema."
Eine Hommage mit Vorbehalten auf Billy Wilder schreibt Mark Cousins im Prospect. Er war ein Gott, meint Cousins, Hollywoods größter Erzähler womöglich, aber nur auf der Mattscheibe. "I saw the great Wilders on television. There, they are masterpieces. The Apartment is balanced, beautiful and wise on the small screen. Some Like it Hot is an annual delight. Sunset Boulevard has for years made Saturday afternoons gothic ... I watched Wilder films on the big screen. It was an extremely unsettling experience. I knew that The Apartment was made in widescreen Panavision, but the acres of space around Jack Lemmon's and Shirley MacLaine's heads robbed the film of clarity and intimacy. With more films, I noticed something worse. Wilder's movies are so beautifully structured and preconceived that there is nothing with them that is abstract: no pauses, no excess, nothing purely formal or expressive. It's all reducible to words; nothing is pure cinema."In einem Streitgespräch mit Will Hutton über europäische und amerikanische Werte äußert Timothy Garton Ash seine Wünsche und Ängste hinsichtlich einer europäischen Identitätssuche: "Europe historically defined itself against the Arab-Islamic world and against Asia; then, after 1945, against its own disastrous past and against the Soviet threat. Now the old Others have gone or faded, and the biggest temptation for Europe is to define itself against America. I think that would be disastrous ... I want a Europe that defines itself not by who it is against but by what it is for."
Noch im Heft: In der Cover Story rekapituliert Robert Skidelsky fünf Jahre New Labour in Britain, Jonathan Ree hegt Zweifel an Isaiah Berlins philosophischen Kompetenzen, und Angela Lambert überlegt, was es bedeuten mag, dass Genealogie heute populärer ist als Pornografie.
Literaturen (Deutschland), 01.05.2002
 Für den Schwerpunkt Deutsche Mythen (hier das Geleitwort) lädt Literaturen Günter Grass zum Gespräch mit den Historikern Michael Jeismann und Karl Schlögel. Es geht um die Mythen der deutschen Vertreibung und die Literatur als Vorreiterin der Geschichtsschreibung. Im Dossier auch ein Beitrag über die Neuausgabe von Kriegs-Briefen Hans Erich Nossacks sowie ein Selbstgespräch des Dramatikers Moritz Rinke über sein tollkühnes Projekt, die Nibelungen neu zu schreiben.
Für den Schwerpunkt Deutsche Mythen (hier das Geleitwort) lädt Literaturen Günter Grass zum Gespräch mit den Historikern Michael Jeismann und Karl Schlögel. Es geht um die Mythen der deutschen Vertreibung und die Literatur als Vorreiterin der Geschichtsschreibung. Im Dossier auch ein Beitrag über die Neuausgabe von Kriegs-Briefen Hans Erich Nossacks sowie ein Selbstgespräch des Dramatikers Moritz Rinke über sein tollkühnes Projekt, die Nibelungen neu zu schreiben.Im einzigen freigegebenen Beitrag erzählt Ulrich Baron das sehr amerikanische Erfolgsmärchen der Krimiautorin Patricia Cornwell und ihrer Romane um die Chef-Leichenbeschauerin Kay Scarpetta, für die Cornwell schon mal selbst das Skalpell in die Hand nimmt und die Baron vor allem für ihre "Rigidität und Aggressivität des Tonfalls" schätzt. Für Baron, dem die Gemeinsamkeiten der Karriere Cornwells und derjenigen ihrer Heldin auffallen, erzählt jedes der Scarpetta-Bücher immer wieder die dieselben zwei Geschichten. "Die eine ist die weibliche Version der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, und dabei geht es um das Recht auf Leben, Freiheit und das Streben nach dem Glück. Die andere ist älter und hat einst auf populäre Weise von der Eitelkeit dieses Strebens erzählt, von Hybris und Nemesis, vom Totentanz, dem sich auch die Reichen, die Erfolgreichen und die Mächtigen dieser Welt eines Tages einreihen müssen."
Ferner: Ulrich Schacht besucht die Literatur-Insel Island, Robin Detje ereifert sich über das neue Berliner Hofschranzentum, Ian Buruma schreibt über den Dalai Lama als virtuelles Phänomen, und bespochen werden Heinz Schlaffers Kurze Geschichte der Literatur (lauter "falsche Thesen"), eine brandaktuelle Studie über das Erziehungssystem aus dem Nachlass Niklas Luhmanns sowie Erzählungen der Kanadierin Alice Munro.
New York Times (USA), 28.04.2002
 Isabel Hilton bespricht drei im Exil geschriebene, sehr persönliche Bücher über Afghanistan. Alle drei - "Zoya's Story" (Auszug), ''My Forbidden Face'' (Auszug) und ''West of Kabul, East of New York'' (Auszug) -, schreibt sie, illustrierten viele derjenigen Fragen, die der Westen beantworten müsse, wenn Afghanistan aus dem jetzigen Krieg in einem besseren Zustand hervorgehen soll als zuvor. "Afghanistan remains a long way from those happy images of Afghan women shedding their burkas that we enjoyed last November." Die in den Büchern erzählten Geschichten selbst scheinen Hilton einem "populären Genre" zuzugehören: "the personal account that illustrates the wider political context. It does not diminish their particularity to say that they are illustrative rather than revelatory, reinforcing what we feel we understand rather than shedding new light or bringing new understanding."
Isabel Hilton bespricht drei im Exil geschriebene, sehr persönliche Bücher über Afghanistan. Alle drei - "Zoya's Story" (Auszug), ''My Forbidden Face'' (Auszug) und ''West of Kabul, East of New York'' (Auszug) -, schreibt sie, illustrierten viele derjenigen Fragen, die der Westen beantworten müsse, wenn Afghanistan aus dem jetzigen Krieg in einem besseren Zustand hervorgehen soll als zuvor. "Afghanistan remains a long way from those happy images of Afghan women shedding their burkas that we enjoyed last November." Die in den Büchern erzählten Geschichten selbst scheinen Hilton einem "populären Genre" zuzugehören: "the personal account that illustrates the wider political context. It does not diminish their particularity to say that they are illustrative rather than revelatory, reinforcing what we feel we understand rather than shedding new light or bringing new understanding." Anthony Lewis hat sich geistreich amüsiert mit dem dritten Band von Robert A. Caros Biografie über Lyndon B. Johnson. "The book reads like a Trollope novel, but not even Trollope explored the ambitions and the gullibilities of men as deliciously as Robert Caro does. I laughed often as I read. And even though I knew what the outcome of a particular episode would be, I followed Caro's account of it with excitement. I went back over chapters to make sure I had not missed a word." Hier eine Leseprobe und ein Audio-Interview mit Caro.
Außerdem in der Review: Eine kurzweilige indisch-amerikanische Familiengeschichte unserer Tage (Leseprobe Bharati Mukherjees "Desirable Daughters"), zwei Erzählbände (beides Debüts), die das Leben nach der Adoleszenz in den Blick nehmen, Martha Serpas liest aus ihrer neuen Gedichtsammlung "Cote Blanche", Gerald Jonas bespricht Science-Fiction von Kim Stanley Robinson, Sheri S. Tepper u.a., und der Boox-Comic entdeckt ein Subgenre der Autobiographie: die "ME-moir".
Economist (UK), 27.04.2002
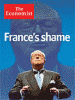 Der Titel untersucht den Coup Le Pens, "Frankreichs Schande", hält sie aber für durchaus heilsam: "There is no cause to panic. With lucky Jacques Chirac almost certainly back in the Elysee Palace for another five years, Mr Le Pen will soon have no more say in running France than he did before. At the same time, the jolt to the system he reviles is salutary. Some of the questions he raises need answering." Die Immigranten-Frage etwa oder diejenige nach Frankreichs Platz in der Welt und in der EU.
Der Titel untersucht den Coup Le Pens, "Frankreichs Schande", hält sie aber für durchaus heilsam: "There is no cause to panic. With lucky Jacques Chirac almost certainly back in the Elysee Palace for another five years, Mr Le Pen will soon have no more say in running France than he did before. At the same time, the jolt to the system he reviles is salutary. Some of the questions he raises need answering." Die Immigranten-Frage etwa oder diejenige nach Frankreichs Platz in der Welt und in der EU. Ein anderer Artikel nimmt die gesamteuropäische politische Lage in den Blick und will ebenfalls beruhigen: Die Wahlerfolge der stramm Rechten seien so berauschend gar nicht, viele Rechts-Wähler seien mitnichten Rassisten, sondern eher enttäuschte Anhänger der gemäßigten Parteien und - Parteien können sich ändern. "For instance, Italy's cannily revamped post-fascist, Gianfranco Fini, is now generally considered, even by the post-Communist opposition, to be a respectable democrat ... no one questions the impeccably democratic credentials of Jose Maria Aznar, Spain's centre-right prime minister, who sees Britain's Labour leader, Tony Blair, as his soulmate in the EU, though the embryo of Mr Aznar's party was created by politicians who served the dictator, General Franco."
Ferner: "Books and Arts" wartet mit neuen Mutmaßungen über die Nachfolge Wolfgang Wagners in Bayreuth auf und hält eine Troika mit Wolfgangs Tochter Katharina als Direktorin, dem Chef des Münchner Staatstheaters am Gärtnerplatz, Klaus Schultz, als Manager und Christian Thielemann von der Deutschen Oper Berlin als Hausdirigent für möglich.
Wir lesen, dass McDonald's (trotz Bove) in Frankreich ganz groß rauskommt, "where it now has some 900 restaurants-more per head than most of its European neighbours, including Germany, Italy, Spain and the Netherlands. (Britain is still just ahead, but the company opened there earlier.) McDonald's now claims to be the leading restaurant chain in France."
Schließlich erfahren wir mehr über die Zusammenhänge von Körpergröße und Einkommen: Wer als Teenager zu den Großen gehörte, besagt eine Studie, verdient als Erwachsener mehr, weil ihn das "soziale und kulturelle Stigma" des Kleinseins nicht bei der Ausbildung von Selbstvertrauen und sozialen Kompetenzen im Weg stand.
The Atlantic (USA), 01.05.2002
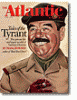 Atlantic Monthly gibt diesmal in seiner Online-Ausgabe nicht viel her. Von den drei großen Geschichten darf man nur die uninteressanteste lesen, in der die Gefängnisbriefe des Mörders von Martin Luther King vorgestellt werden.
Atlantic Monthly gibt diesmal in seiner Online-Ausgabe nicht viel her. Von den drei großen Geschichten darf man nur die uninteressanteste lesen, in der die Gefängnisbriefe des Mörders von Martin Luther King vorgestellt werden.Die Titelgeschichte (leider nur im Print) ist ein Porträt Saddam Husseins (jetzt doch freigegeben). Mark Bowden zeichnet ihn als Diktator, den weniger seine Verrücktheit oder sein Hedonismus auszeichnen als vielmehr seine besessene Sorge, wie die Nachwelt ihn ansehen wird. Hussein bewundert Stalin und Winston Churchill, sein Lieblingsfilm ist "Der Pate", er schläft nicht mehr als vier Stunden pro Nacht und sein Schreibtisch ist immer aufgeräumt. Mark Bowden hat seine Informationen vor allem aus langen Interviews zusammengetragen, die er mit exilierten Irakern geführt hatte, die Saddam Hussein gut kannten.
New Yorker | New York Times | Economist | The Atlantic | Nouvel Observateur | Express | Outlook India | New Republic | Merkur | Spiegel | Prospect | Literaturen