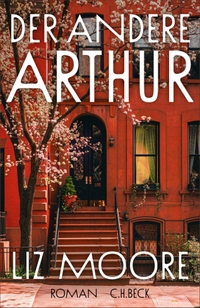Im Kino
Coolnessperformances
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Sebastian Markt
07.10.2020. Zombi-Film oder Seminararbeit zum Themenkomplex europäische Aufklärung, Kolonialismus und Voodoo? Regisseur Bertrand Bonello kann sich in "Zombi Child" nicht recht entscheiden. Therese Koppe beobachtet in ihrem Dokumentarfilm "Im Stillen laut" Erika und Tine, die seit über vierzig Jahren als Paar in Brandenburg leben.
In der ersten Einstellung schneidet ein Messer durch einen Fisch. Durch einen Kugelfisch, genauer gesagt, das schmatzt und spritzt und schleimt ganz wunderbar und angesichts des Filmtitels könnte man die Sauerei für einen Vorgeschmack halten auf weitere, ähnlich gelagerte Attraktionen. Im Großen und Ganzen läge man damit leider ziemlich falsch.
Es geht im Film durchaus um ein Zombiekind, beziehungsweise, das ist freilich schon fast ein Spoiler, um eine Zombie-Enkelin. Sie heißt Mélissa (Wislanda Louimat), stammt aus Haiti und besucht ein schickes, altmodisches Elite-Mädcheninternat, zugänglich ausschließlich für Sprößlinge französischer Ehrenlegionmitglieder. Außerdem geht es um Voodoo-Rituale und um erotische Fantasien, in einer Parallelhandlung schlägt sich ein entflohener Plantagenarbeiter durch den karibischen Dschungel. Hört sich erst einmal gut an, klar. Was leider fehlt, ist der affektive Überschuss, der sich selbst in mittelmäßigen Zombiefilmen zumeist wenigstens streckenweise einstellt, im Zuge des allfälligen Wühlens im Gedärm.
Die Szenen im Dschungel basieren auf der Lebensgeschichte beziehungsweise Selbstfiktion von Clairvius Narcisse, eines Haitianers, der, seiner eigenen Erzählung zufolge, nach seinem "ersten Tod" im Jahr 1962 wiederbelebt, mithilfe des, siehe oben, Kugelfisch-Gifts Tetrodotoxin viele Jahre lang in einem Zombie-artigen Zustand gehalten und auf einer Zuckerrohrplantage zum Frondienst gezwungen wurde, bevor er in den 1980ern zu seiner Familie und in die Welt der Lebenden zurückkehrte. Auch ansonsten hat Bonellos historisch-kritische Zombie-Recherche Hand und Fuß - als Seminararbeit zum Themenkomplex europäische Aufklärung / Kolonialismus / Voodoo gäbe es an "Zombi Child" wenig auszusetzen.
Aber als Film, als Horrorfilm gar? Da beginnen die Probleme schon bei den Oberflächen, die dem stilbesessenen Bonello stets besonders wichtig sind. Allzu plakativ kommt der Kontrast daher zwischen der sehr weißen Welt des Eliteinternats - die geschniegelten Schuluniformen mit knallroter Schärpe, der gepflegte Rasen des Park-Campus - und der ganz und gar nicht weißen Welt auf Haiti, wo Narcisses Körper vom schummrigen Grün in Grün des Dschungels oft kaum zu unterscheiden ist. Eine grafische Differenz, die ebenso konzeptuelle Setzung bleibt wie die erzählerische Spannung zwischen Teenager-Melancholie und politisch aufgeladenem Zombiekino.
Wobei die die erste Filmhälfte dominierenden Mädcheninternat-Vignetten deutlich besser funktionieren als das gegen Ende überhand nehmende Genre-Pastiche. Bonellos Kamera liebt die Gesichter der Mädchen und ihre blasierten Coolnessperformances, und ganz besonders liebt sie das weiche, stets leicht verschlafen wirkende Gesicht, die blasse Haut und den roten Lippenstift von Fanny (eine Entdeckung, eine lässige Madonna: Louise Labèque), einer hoffnungslosen Romantikerin, die in den Pausen meist ein paar Meter entfernt der anderen sitzt, in ihrer eigenen Welt, und die gelegentlich aus dem Off schwülstige Liebesbriefe an ihren abwesenden Boyfriend vorträgt.
Mélissa wiederum ist die Neue in der Schule. Fanny nimmt schnell mit ihr Kontakt auf, von den anderen wird die Haitianerin zunächst skeptisch beäugt, anhand der gängigen Kriterien adoleszenter Cliquenbildung: Seltsam genug, um als cool durchzugehen ist die mysteriöse Einzelgängerin schon; aber ist sie auch cool genug, um nicht einfach nur seltsam zu sein? Wenn das schwarze Mädchen aus der Karibik sich mithilfe einiger Zeilen des haitianischen Dichters Rene Depestres ("Listen, white world / As our dead roar / Listen to my zombie voice"), zum ersten Mal als Zombie inszeniert, dann tut sie das vor allem, um in einen ansonsten komplett weißen Freundinnenkreis aufgenommen zu werden. Ein Akt der spielerischen Selbstethnisierung, der vom Film allerdings im Anschluss komplett beim Nennwert genommen wird.

Die schönsten Szenen gehören dieser Mädchengang. Ein Geheimbund, der sich des nachts im Lagerraum des Internats trifft, um zwischen ausrangierten Statuen bei Kerzenlicht die Ginflasche kreisen zu lassen, über Mitschülerinnen zu lästern und Musik zu hören. Einmal stehen sie dicht beieinander im Kreis, und sprechen die lyrics eines alpha-male-Rap-Songs mit ("Your G-spot's dead / from the fucking you get"), ernst und konzentriert, ein Ritual. Fanny wird dann plötzlich per hartem Schnitt in einen Zauberwald befördert, wo sich der sonst nur von fern beschworene Boyfriend zum ersten Mal im Bild manifestiert und gleich damit beginnt, suggestiv die Kamera anzutanzen. Für einen Moment scheint in dieser Szene ein anderer, albernerer, schönerer Film durch, einer, der einen Begriff sowohl von seiner eigenen Absurdität, als auch vom versponnenen Seelenleben seiner jugendlichen Protagonistinnen hat.
Es geht dann aber doch brav weiter im Proseminarprogramm. Paradoxerweise wirkt "Zombi Child" umso kalkulierter und selbstzufriedener, je mehr die übersinnlichen, irrationalen Elemente Überhand nehmen. Voodoo und Zombies sind nicht das unheimliche Andere, das von Außen in unsere Welt tritt, sondern bloß Mittel zum Zweck, Diskursmarkierungen, die zwei disparate Raumzeiten aufeinander beziehen sollen, im Sinne einer schicken, linken, vage postmodernen (und schon auch: postmodern vagen) geschichtspolitischen These, die nicht nur von Anfang an feststeht, als Zweck der Übung, sondern die praktischerweise im Film gleich noch verbalisiert wird, vom Starhistoriker Patrick Boucheron höchstpersönlich.
Das ist, wie vieles im Film, on the nose, und in der Theorie ist vermutlich gerade das Plakative die Pointe. "Zombi Child" entzieht sich bewusst der Unterscheidung zwischen Text und Subtext (die der weniger smarte, aber filmisch deutlich effektivere politische Horror zum Beispiel von "Get Out" noch voraussetzt); nicht länger soll das Sichtbare aufs Unsichtbare, die Wirkung auf die Ursache verweisen, vielmehr ist beides gleichwertig im Bild präsent (genau wie, auf einer anderen Ebene, das Hohe neben dem Niedrigen, die geschichtspolitische Vorlesung neben der Rihanna-Abschweifung steht). An die Stelle der manipulativen Tricks konventioneller Genrefilme, die ihr Publikum in eine Dramaturgie der schrittweisen Enthüllung einspannen, tritt eine vorderhand freiere, collagenartige Ästhetik; die allerdings, das ist zumindest mein Verdacht, einen offenen Text nur vorgaukelt. Denn ähnlich wie in den freilich noch einmal deutlich klemmigeren Filmen von Ruben Östlund bekommen wir in "Zombi Child" Puzzlesteine präsentiert, die wir zwar in der Tat selbst zusammensetzen müssen, die sich aber doch stets nur zu ein und demselben Bild fügen.
Lukas Foerster
Zombi Child - Frankreich 2019 - Regie: Bertrand Bonello - Darsteller: Louise Labeque, Wislanda Louimat, Katiana Milfort, Mackenson Bijou - Laufzeit: 103 Minuten.
***

Zu Beginn eine Öffnung: Ein Tür geht auf, Schutzverschalungen werden aus den Fenstern und Türen genommen, Licht fällt herein, der Blick geht nach draußen. Dann guckt man eine Weile zu, man sieht eine Frau beim Ordnen von Dokumenten und Erinnerungen und eine Andere, während der Frühling auf einem umgestalteten Hof ganz praktisch willkommen geheißen wird.
Der Hof, der im brandenburgischen Lietzen liegt, ist das Refugium der bildenden Künstlerin Erika Stürmer-Alex und ihrer Lebensgefährtin Christine Müller-Stosch. Erika und Tine, beide Jahrgang 1938, sind seit über 40 Jahren ein Paar. Anfang der 80er Jahre, als die DDR noch ein Staat war, beginnen die beiden das Gehöft zum Lebens- und Arbeitsraum umzubauen. Der Hof bietet einen Rückzugsraum, den einfach privat zu nennen zu schlicht wäre. Erika und Tine geht es um anderes und mehr: das Erschaffen eines Freiraums, der andere Formen des Zusammenlebens und Zusammenarbeitens möglich macht.
Therese Koppes Film begann ursprünglich als Projekt über künstlerische Produktion in der DDR, vor allem von Frauen, ein Thema, das in der Rückschau bislang weniger hell ausgeleuchtet ist. Daraus wurde ein Porträt zweier Frauen und des gemeinsamens Lebens, das sie führen, ohne dass die Dimension einer Geschichtsforschung, der es um mehr als nur Persönliches geht, aufgegeben worden wäre. Für den Film, der in seiner Erzählung den Lauf eines Jahres von Frühling bis Winter aufnimmt, hat Koppe längere Zeit auf dem Hof gelebt und gearbeitet. Man meint dem Film die Vertrautheit und das Vertrauen, das daraus resultiert, anzusehen. In gelassener Ruhe vermag er von einer großen Liebe ebenso zu erzählen, wie er ein komplexes Bild von Freiheit und Selbstbestimmung, Engagement und Repression in der Deutschen Demokratischen Republik zeichnet.
Die Perspektiven der beiden Frauen sind dabei durchaus unterschiedlich: Christine, Pfarrerstochter und Theologin, die früh als Staatsfeindin abgestempelt war und Erika, die durch alle Widerstände hindurch engagierte Sozialistin blieb. Den beiden für einige Momente in ihrem jahrzehntelangen, nie abreißenden Zwiegespräch zuhören zu können, ihre Wachheit und Zugewandtheit und ihr Humor, ist eine der großen Freuden, mit denen der Film aufwartet.
Zwei Momente, in denen aus Dokumenten gelesen wird und aus dem Off erzählt, kontrastieren mit den dialogischen Selbstbefragungen der beiden Frauen. Im ersten Fall, zum Anfang des Films, liest Erika in ihrer Stasiakte, erst amüsiert über die verquere Mischung aus administrativer Steifheit und verklemmt freidrehender Fantasie, die sexuelle Ausschweifungen jenseits jeder Realität imaginiert; als von den anvisierten Maßnahmen die Rede ist, die dem Treiben ein Ende setzen sollten, setzt jedoch Ernüchterung ein. "Zersetzung..." sagt sie da, "das ist ein böses Wort." Später, als der Herbst schon an den Winter erinnert, der bald kommen wird, wird im Off der Moment resümiert, als eine Familie aus dem Westen, die Besitzansprüche an den Hof stellt, zum Lokalaugenschein zu Besuch kommen. Beim Kaffee fallen die Sätze: "Sie haben ja hinter der Mauer 27 Jahre umsonst gelebt. Sie müssen alle noch viel lernen."
Die Fremdzuschreibungen: der Zugriff des Staates, der Bedrohung zugleich wahrnimmt und verkennt, und die pauschale Entwertung von Lebensläufen im (westlichen) Rückblick sind Markierungen, die der Auseinandersetzung bedürfen, sie sind, im Film wie im Leben der beiden Frauen, aber vor allem Konstanten eines Raumes, innerhalb dessen nach einer Logik gesucht wird.
"Im stillen Laut" montiert Beobachtungen des Hof-, Arbeits- und Beziehungsalltags mit den Chroniken Christines und mit Archivmaterial, Fotografien und Filmaufnahmen, die der immer noch existierenden Gegenwart als sozialem Ort künstlerischen Schaffens ein Bild seiner Vergangenheit mit weitreichenden kollektiven Ambitionen hinzufügen, ein Stück queerer Geschichte der DDR, die der Film mit einem queeren Blick fokussiert. Es ist ein Blick, der weniger Privates und Politisches verbindet, als diese und andere Grenzziehungen in Frage stellt, und in Momenten intim wird, etwa wenn die Kamera sich dem Blick der Lebensgefährtin anverwandelt, und durch die Milchglasscheibe der Duschkabine die Schönheit eines alternden Körpers zeigt. Ein anrührendes Bild, das kristallisiert, was der Film als Ganzes ausstrahlt: Eine Zärtlichkeit, die immer auch politisch ist.
Sebastian Markt
Im Stillen laut - Deutschland 2019 - Regie: Therese Koppe - Laufzeit: 74 Minuten.
Kommentieren