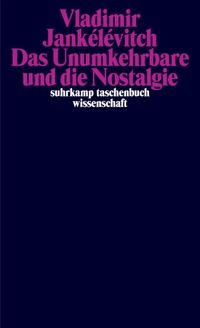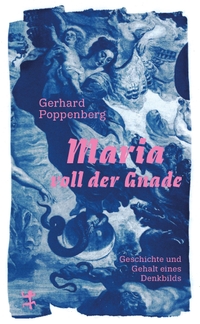Magazinrundschau
Die unsichtbare Architektur unseres Alltags
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
Washington Post (USA), 18.04.2018
Respekt (Tschechien), 30.04.2018
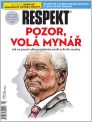 Eine tägliche Herausforderung für alle journalistischen Medien: Wie umgehen mit Hassmails, Shitstorm & Co? Die Wochenzeitschrift Respekt hat nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Kuciak beschlossen, für sich eine Grenze zu ziehen: "Wenn jemand zu Liquidierung einer Journalistin oder eines Journalisten aufruft, übergehen wir das nicht mehr, sondern übergeben es der Polizei", schreibt Chefredakteur Erik Tabery. "Kürzlich haben wir das zum ersten Mal gemacht, als ein Herr auf Facebook wiederholt schrieb, ein Mitglied unserer Redaktion solle erschossen werden, weil er unter anderem über die russischen Verbindungen im Umkreis von Präsident Miloš Zeman schrieb. Wir haben den Fall der Polizei unterbreitet und letzte Woche den Bescheid erhalten, dass sie sich nicht damit befassen werde, da wir öffentliche Kritik akzeptieren müssten. Es ist interessant, wie sich in den letzten Jahren die Einschätzung von akzeptabler Kritik verschoben hat. Für uns ist die Sache damit natürlich noch nicht zu Ende, aber die Haltung der Prager Polizei, die einen Tötungsaufruf als öffentliche Kritik erachtet, ist wahrhaftig eine Neuerung."
Eine tägliche Herausforderung für alle journalistischen Medien: Wie umgehen mit Hassmails, Shitstorm & Co? Die Wochenzeitschrift Respekt hat nach der Ermordung des slowakischen Journalisten Kuciak beschlossen, für sich eine Grenze zu ziehen: "Wenn jemand zu Liquidierung einer Journalistin oder eines Journalisten aufruft, übergehen wir das nicht mehr, sondern übergeben es der Polizei", schreibt Chefredakteur Erik Tabery. "Kürzlich haben wir das zum ersten Mal gemacht, als ein Herr auf Facebook wiederholt schrieb, ein Mitglied unserer Redaktion solle erschossen werden, weil er unter anderem über die russischen Verbindungen im Umkreis von Präsident Miloš Zeman schrieb. Wir haben den Fall der Polizei unterbreitet und letzte Woche den Bescheid erhalten, dass sie sich nicht damit befassen werde, da wir öffentliche Kritik akzeptieren müssten. Es ist interessant, wie sich in den letzten Jahren die Einschätzung von akzeptabler Kritik verschoben hat. Für uns ist die Sache damit natürlich noch nicht zu Ende, aber die Haltung der Prager Polizei, die einen Tötungsaufruf als öffentliche Kritik erachtet, ist wahrhaftig eine Neuerung."New Yorker (USA), 07.05.2018
 Im neuen Heft des New Yorker widmet sich Nicholas Schmidle der Cybersicherheit und ihren Fährnissen: "Schätzungen zufolge sind 90 Prozent aller US-Firmen Opfer von Hackerangriffen … Regierungsorganisationen wie die Nationale Sicherheitsbehärde N.S.A oder das Department of Homeland Security sorgen für die Sicherheit der Regierungsnetzwerke. Dem privaten Sektor bleibt der Schutz seiner Netzwerke selbst überlassen. Hilfe erhält er zunehmend von der Cybersicherheitsindustrie, die gern ehemalige N.S.A.-Mitarbeiter beschäftigt. Einige dieser Firmen sehen sich als Maurer, die ihren Kunden helfen, dickere Wände zu bauen, andere verstehen sich als Kammerjäger im Kampf gegen Ungeziefer. Viele von ihnen bieten 'aktive Verteidigung' an, ein vorsätzlich unscharf gehaltener Begriff für die Bereitschaft, Eindringlinge zu jagen, während sie sich im Kunden-Netzwerk befinden, oder auch: zurückzuhacken, also in die Rechner der Hacker einzudringen. Man spricht nicht gern offen darüber … Betroffene Unternehmen sind es leid, betroffene Stellungnahmen rauszugeben, um ihre Kunden davon zu unterrichten, dass sensible Personendaten gestohlen wurden. Das ist schlecht für den Aktienkurs und suggeriert Unfähigkeit. James Bourie, ein Unternehmer aus der Cybersicherheit erklärt: 'Sie wollen nicht länger passiv bleiben, aber sie wissen nicht, wie weit sie gehen können, ohne das Gesetz zu brechen' … Sollte das 'hacking back' legal werden, könnte es einzelnen Opfern von Cyberkriminalität zwar helfen, aber das Internet wird dadurch nicht sicherer. Wenn Waffenbesitz überhaupt ein Indikator ist, dann dafür, dass mehr Waffen mehr Gewalt bedeuten, und Cyperwaffen dürften noch viel schwerer in den Griff zu bekommen sein als richtige Waffen. 2012 konnten sich die USA und Russland nicht auf ein Cyberwaffen-Gesetz einigen. Open-Source-Hackercode, mit dem das Eindringen in Firmennetzwerke festgestellt werden kann, zirkuliert längst online, aber dieser Code ist auch für kriminelle Zwecke nutzbar. Nach Angaben eines früheren N.S.A.-Mitarbeiters haben z. B. iranische Hacker bei ihren Angriffen auf US-Banken solchen Code verwendet."
Im neuen Heft des New Yorker widmet sich Nicholas Schmidle der Cybersicherheit und ihren Fährnissen: "Schätzungen zufolge sind 90 Prozent aller US-Firmen Opfer von Hackerangriffen … Regierungsorganisationen wie die Nationale Sicherheitsbehärde N.S.A oder das Department of Homeland Security sorgen für die Sicherheit der Regierungsnetzwerke. Dem privaten Sektor bleibt der Schutz seiner Netzwerke selbst überlassen. Hilfe erhält er zunehmend von der Cybersicherheitsindustrie, die gern ehemalige N.S.A.-Mitarbeiter beschäftigt. Einige dieser Firmen sehen sich als Maurer, die ihren Kunden helfen, dickere Wände zu bauen, andere verstehen sich als Kammerjäger im Kampf gegen Ungeziefer. Viele von ihnen bieten 'aktive Verteidigung' an, ein vorsätzlich unscharf gehaltener Begriff für die Bereitschaft, Eindringlinge zu jagen, während sie sich im Kunden-Netzwerk befinden, oder auch: zurückzuhacken, also in die Rechner der Hacker einzudringen. Man spricht nicht gern offen darüber … Betroffene Unternehmen sind es leid, betroffene Stellungnahmen rauszugeben, um ihre Kunden davon zu unterrichten, dass sensible Personendaten gestohlen wurden. Das ist schlecht für den Aktienkurs und suggeriert Unfähigkeit. James Bourie, ein Unternehmer aus der Cybersicherheit erklärt: 'Sie wollen nicht länger passiv bleiben, aber sie wissen nicht, wie weit sie gehen können, ohne das Gesetz zu brechen' … Sollte das 'hacking back' legal werden, könnte es einzelnen Opfern von Cyberkriminalität zwar helfen, aber das Internet wird dadurch nicht sicherer. Wenn Waffenbesitz überhaupt ein Indikator ist, dann dafür, dass mehr Waffen mehr Gewalt bedeuten, und Cyperwaffen dürften noch viel schwerer in den Griff zu bekommen sein als richtige Waffen. 2012 konnten sich die USA und Russland nicht auf ein Cyberwaffen-Gesetz einigen. Open-Source-Hackercode, mit dem das Eindringen in Firmennetzwerke festgestellt werden kann, zirkuliert längst online, aber dieser Code ist auch für kriminelle Zwecke nutzbar. Nach Angaben eines früheren N.S.A.-Mitarbeiters haben z. B. iranische Hacker bei ihren Angriffen auf US-Banken solchen Code verwendet."Außerdem: Peter Hessler berichtet aus Kairo, wie es ist, als Familie durch die Revolution zu gehen. Ben Taub begleitet einen Ex-Terroristenjäger auf Streife. Zadie Smith porträtiert die Fotografin Deana Lawson. Jonathan Dee liest Sergio de la Pavas polyphonen Roman "Lost Empress". Anthony Lane sah im Kino Joe und Anthony Russos "Avengers: Infinity War" sowie Claire Denis' "Let the Sunshine In" mit Juliette Binoche. Und in einer Kurzgeschichte von Isaac B. Singer geht es ums Hadern mit einem Gott, der Hitler möglich machte.
Eurozine (Österreich), 30.04.2018
 Mykoly Balaban versucht sich zu erklären, wie die Berichterstattung über den Krieg im Osten der Ukraine im Nebel postfaktischer Propaganda versinken konnte: "Dass wir uns kein genaues Bild von der Lage machen können, liegt auch daran, dass die internationalen Medien keine eigenen Korrespondenten in der Ukraine haben, die mit Sprache und Eigenheiten des Landes vertraut sind. Seit sowjetischen Zeiten dient Moskau als Basis für internationale Journalisten, von dort aus decken sie eine Region ab, die der früheren Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten entspricht. Wenn sie also über eine sich entwickelnde Geschichte berichten, beziehen sie ihre Informationen aus zweiter und dritter Hand, meist aus russischen Massenmedien, die einen verfestigt einseitigen Blick auf die Auseinandersetzungen in der Ukraine haben. Das Narrativ, das sie aus diesen ziehen, lautet im Grunde, dass der ukrainische Staat kollabierte, das Land in totalem Chaos versank, nationalistische und faschistische Gangs sich gewaltsame Kämpfe lieferten und die Ukraine nicht in der Lage war, ihre eigene Bevölkerung zu schützen."
Mykoly Balaban versucht sich zu erklären, wie die Berichterstattung über den Krieg im Osten der Ukraine im Nebel postfaktischer Propaganda versinken konnte: "Dass wir uns kein genaues Bild von der Lage machen können, liegt auch daran, dass die internationalen Medien keine eigenen Korrespondenten in der Ukraine haben, die mit Sprache und Eigenheiten des Landes vertraut sind. Seit sowjetischen Zeiten dient Moskau als Basis für internationale Journalisten, von dort aus decken sie eine Region ab, die der früheren Sowjetunion und ihren Satellitenstaaten entspricht. Wenn sie also über eine sich entwickelnde Geschichte berichten, beziehen sie ihre Informationen aus zweiter und dritter Hand, meist aus russischen Massenmedien, die einen verfestigt einseitigen Blick auf die Auseinandersetzungen in der Ukraine haben. Das Narrativ, das sie aus diesen ziehen, lautet im Grunde, dass der ukrainische Staat kollabierte, das Land in totalem Chaos versank, nationalistische und faschistische Gangs sich gewaltsame Kämpfe lieferten und die Ukraine nicht in der Lage war, ihre eigene Bevölkerung zu schützen."
Nach dem Gesetz, das es verbietet, Polen eine Mitschuld am Holocaust zu geben, kursiert in Warschau eine wahrhaft geschmacklose Idee: Wie Konstanty Gebert berichtet, trumpfte der PR-Berater der Regierung mit der Idee auf, an das - unbestreitbare - Leid des polnischen Volkes im Zweiten Weltkrieg in einem Polocaust-Museum zu erinnern.
London Review of Books (UK), 30.04.2018
 Der Skandal um die Windrush-Generation hat Britannien erschüttert und bereits zum Rücktritt der Innenministerin Amber Rudd geführt. Es geht um Einwanderer aus der Karibik, die seit den sechziger Jahren in Britannien leben, aber keine Nachweise ihre legalen Einreise haben. Das Innenministerium hat diese Belege 2010 vernichtet. Für William Davies liegt das Problem nicht in einem bürokratischen Missgeschick, sondern in der Instrumentalisierung der Bürokratie: "Der Einwanderer-Status der Windrush-Generation hätte niemals in Frage gestellt werden dürfen, der Grund für ihre Notlage reicht nicht weit zurück: Es ist der Immigration Act von 2014, das politische Aushängeschild der damaligen Innenministerin Theresa May. Der Plan war eine 'feindselige Atmosphäre' zu schaffen, um es illegalen Einwanderer schwerer zu machen, in Britannien zu leben und arbeiten. Indem Vermieter, Arbeitgeber, Banken und NHS-Dienste gezwungen wurden, den Status von Einwanderern zu überprüfen, drückte die Polizei den Geist des Grenzschutzes in das tägliche Leben... Wer Politik über Stimmung macht, kann nie genau kontrollieren, wen diese Politik trifft und wie. Es reicht nicht zu sagen, dass die Unschuldigen nichts zu befürchten haben, so funktioniert Furcht nicht. Das Argument für das Schaffen einer 'feindseligen Atmosphäre' basiert auf der Annahme, dass legale und illegale Einwohner auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden sind und nur durch permanente Schnüffelei voneinander getrennt werden können. Die Gerichte haben das Innenministerium immer wieder frustriert, weil sie die Beweislast dem Staat auferlegten. Das Gesetz von 2014 schob sie auf die Einzelnen. Und wenn sie, wie die Windrush-Generation, nicht beweisen können, dass sie Briten sind, werden sie de facto illegal."
Der Skandal um die Windrush-Generation hat Britannien erschüttert und bereits zum Rücktritt der Innenministerin Amber Rudd geführt. Es geht um Einwanderer aus der Karibik, die seit den sechziger Jahren in Britannien leben, aber keine Nachweise ihre legalen Einreise haben. Das Innenministerium hat diese Belege 2010 vernichtet. Für William Davies liegt das Problem nicht in einem bürokratischen Missgeschick, sondern in der Instrumentalisierung der Bürokratie: "Der Einwanderer-Status der Windrush-Generation hätte niemals in Frage gestellt werden dürfen, der Grund für ihre Notlage reicht nicht weit zurück: Es ist der Immigration Act von 2014, das politische Aushängeschild der damaligen Innenministerin Theresa May. Der Plan war eine 'feindselige Atmosphäre' zu schaffen, um es illegalen Einwanderer schwerer zu machen, in Britannien zu leben und arbeiten. Indem Vermieter, Arbeitgeber, Banken und NHS-Dienste gezwungen wurden, den Status von Einwanderern zu überprüfen, drückte die Polizei den Geist des Grenzschutzes in das tägliche Leben... Wer Politik über Stimmung macht, kann nie genau kontrollieren, wen diese Politik trifft und wie. Es reicht nicht zu sagen, dass die Unschuldigen nichts zu befürchten haben, so funktioniert Furcht nicht. Das Argument für das Schaffen einer 'feindseligen Atmosphäre' basiert auf der Annahme, dass legale und illegale Einwohner auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden sind und nur durch permanente Schnüffelei voneinander getrennt werden können. Die Gerichte haben das Innenministerium immer wieder frustriert, weil sie die Beweislast dem Staat auferlegten. Das Gesetz von 2014 schob sie auf die Einzelnen. Und wenn sie, wie die Windrush-Generation, nicht beweisen können, dass sie Briten sind, werden sie de facto illegal."Stephen Sedley gibt sich alle Mühe, den Antisemitismus in Britannien und der Labour Party zu relativieren, auch wenn er einräumt, dass sich Jeremy Corbyn nicht immer scharf genug abgegrenzt habe gegenüber jenen, die Israelkritik und Ressentiment verwischen.
Magyar Narancs (Ungarn), 26.04.2018
 Die Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Nikoletta Szekeres ist Kuratoriumsmitglied bei HUBBY, der ungarischen Unterorganisation vom Internationales Kuratorium für das Jugendbuch (IBBY). Im Interview mit Ildikó Orosz spricht sie über den Tabubruch als Qualitätsmerkmal nach deutschsprachigem Vorbild in der zeitgenössischen ungarischen Jugendliteratur. "Vor etwa zehn Jahren vermissten wir Kritiker, dass es auf Ungarisch keine so harten, Tabus behandelnde, herausragende Jugendromane gibt wie zum Beispiel Beate Teresa Hanikas 'Rotkäppchen muss weinen' oder Wolfgang Herrndorfs 'Tschick'. Es ist verständlich, dass unter den Intellektuellen aber auch bei den Verlagen ein Bedürfnis danach entstand, doch Literatur funktioniert nicht so, dass jemand kommt und sagt: "Bitte, schreib etwas über Missbrauch!" Es muss ein inneres Bedürfnis geben, eine gute Geschichte und die passende Sprache. Noch sehe ich nicht, dass die ungarische Jugendliteratur ihren Platz gefunden hat, es gibt viel Herumtasten, aber es gibt auch keinen Grund zur Verzweiflung. Diese Themen waren für Jahrzehnte auf dem Abstellgleis und die ungarische Gesellschaft gilt generell als prüde."
Die Literaturwissenschaftlerin und Kritikerin Nikoletta Szekeres ist Kuratoriumsmitglied bei HUBBY, der ungarischen Unterorganisation vom Internationales Kuratorium für das Jugendbuch (IBBY). Im Interview mit Ildikó Orosz spricht sie über den Tabubruch als Qualitätsmerkmal nach deutschsprachigem Vorbild in der zeitgenössischen ungarischen Jugendliteratur. "Vor etwa zehn Jahren vermissten wir Kritiker, dass es auf Ungarisch keine so harten, Tabus behandelnde, herausragende Jugendromane gibt wie zum Beispiel Beate Teresa Hanikas 'Rotkäppchen muss weinen' oder Wolfgang Herrndorfs 'Tschick'. Es ist verständlich, dass unter den Intellektuellen aber auch bei den Verlagen ein Bedürfnis danach entstand, doch Literatur funktioniert nicht so, dass jemand kommt und sagt: "Bitte, schreib etwas über Missbrauch!" Es muss ein inneres Bedürfnis geben, eine gute Geschichte und die passende Sprache. Noch sehe ich nicht, dass die ungarische Jugendliteratur ihren Platz gefunden hat, es gibt viel Herumtasten, aber es gibt auch keinen Grund zur Verzweiflung. Diese Themen waren für Jahrzehnte auf dem Abstellgleis und die ungarische Gesellschaft gilt generell als prüde."Wired (USA), 25.04.2018
 Seit langem diskutieren Apple und die amerikanischen Ermittlungsbehörden über die rigorose Verschlüsselung von Apple-Produkten, die es im Falle eines Falles nicht einmal dem Hersteller selbst gestattet, die Inhalte verschlüsselter Geräte wieder zugänglich zu machen. Bevor ein Gesetz die Sache regelt, hat Apple jetzt die Initiative ergriffen: Steven Levy berichtet von der Präsentation des neuen Systems "Clear", das einerseits den fahrlässigen Zugang zu private Daten weiterhin verhindern, den Bedürfnissen der Ermittler und Sicherheitsbehörden aber entgegen kommen soll. Erstellt hat es Ray Ozzie, der früher für Microsoft tätig war. Dessen Vorschlag basiert auf öffentlichen und privaten Sicherheitsschlüsseln - ersterer ist auf dem iPhone zugänglich, letzterer in einem Hochsicherheitstrakt bei Apple selbst. "Der öffentliche und private Schlüssel dient zur Ver- und Entschlüsselung einer geheimen PIN, die jedes Gerät bei Aktivierung automatisch erstellt. ... Diese geheime PIN ist auf dem Gerät hinterlegt und wird über den öffentlichen Schlüssel verschlüsselt. Sobald dies geschehen ist, kann niemand mehr sie dechiffrieren und damit das Gerät entsperren, außer der hochgradig geschützte, private Schlüssel des Verkäufers kommt zum Einsatz. ... Ozzie hat weitere Features eingebaut, um Skeptiker zu überzeugen. 'Clear' funktioniert immer nur auf einem einzelnen Gerät: Die PIN eines Geräts gestattet den Behörden keinen Zugang zu weiteren Geräten. Hinzu kommt: Hat man sich mittels 'Clear' Zugang zum Gerät verschafft, zerlegt sich im Innern des Geräts ein spezieller Chip - die Daten auf dem Gerät werden eingefroren, um ihre Manipulation zu verhindern. 'Clear' kann nicht für Überwachungszwecke eingesetzt werden, erklärt Ozzie, denn ist das System erst einmal in Gang gesetzt worden, wird das Telefon unbrauchbar."
Seit langem diskutieren Apple und die amerikanischen Ermittlungsbehörden über die rigorose Verschlüsselung von Apple-Produkten, die es im Falle eines Falles nicht einmal dem Hersteller selbst gestattet, die Inhalte verschlüsselter Geräte wieder zugänglich zu machen. Bevor ein Gesetz die Sache regelt, hat Apple jetzt die Initiative ergriffen: Steven Levy berichtet von der Präsentation des neuen Systems "Clear", das einerseits den fahrlässigen Zugang zu private Daten weiterhin verhindern, den Bedürfnissen der Ermittler und Sicherheitsbehörden aber entgegen kommen soll. Erstellt hat es Ray Ozzie, der früher für Microsoft tätig war. Dessen Vorschlag basiert auf öffentlichen und privaten Sicherheitsschlüsseln - ersterer ist auf dem iPhone zugänglich, letzterer in einem Hochsicherheitstrakt bei Apple selbst. "Der öffentliche und private Schlüssel dient zur Ver- und Entschlüsselung einer geheimen PIN, die jedes Gerät bei Aktivierung automatisch erstellt. ... Diese geheime PIN ist auf dem Gerät hinterlegt und wird über den öffentlichen Schlüssel verschlüsselt. Sobald dies geschehen ist, kann niemand mehr sie dechiffrieren und damit das Gerät entsperren, außer der hochgradig geschützte, private Schlüssel des Verkäufers kommt zum Einsatz. ... Ozzie hat weitere Features eingebaut, um Skeptiker zu überzeugen. 'Clear' funktioniert immer nur auf einem einzelnen Gerät: Die PIN eines Geräts gestattet den Behörden keinen Zugang zu weiteren Geräten. Hinzu kommt: Hat man sich mittels 'Clear' Zugang zum Gerät verschafft, zerlegt sich im Innern des Geräts ein spezieller Chip - die Daten auf dem Gerät werden eingefroren, um ihre Manipulation zu verhindern. 'Clear' kann nicht für Überwachungszwecke eingesetzt werden, erklärt Ozzie, denn ist das System erst einmal in Gang gesetzt worden, wird das Telefon unbrauchbar."Außerdem hat sich Levy mit Mark Zuckerberg über die Folgen des Cambridge-Analytica-Gaus unterhalten: Unter anderem geht es darum, wie Facebook den Missbrauch seiner Tools, Daten und Zugänge zur Manipulation der Öffentlichkeit künftig verhindern will. Zuckerberg geht von einer "dreijährigen Übergangsphase" aus, um "Teams aufzubauen. Schließlich kann man nicht einfach über Nacht 30.000 Leute anstellen und sie einfach so irgendetwas machen lassen. ... Man muss sicherstellen, dass sie gut arbeiten, man muss sie gut führen und ausbilden. Und Tools für Künstliche Intelligenz erstellt man auch nicht mit einem Fingerschnipps." Eine Erkenntnis, die man sich bei Facebook vielleicht schon vor einigen Jahren gewünscht hätte.
Weiteres: Vince Beiser berichtet von dem mühseligen Einsatz von Robotern im Katastrophengebiet rund um Fukushima, wo das unter Wasser liegende, radioaktive Material noch immer nicht geborgen werden konnte. Und Brendan Koerner erzählt in einer epischen Reportage von Videogame-Kids, die sich mit ihrer Vorliebe, ihre Konsolen und die Spiele darauf zu hacken, größte Probleme eingehandelt haben.
Slate (USA), 27.04.2018
 "Wenn etwas kostenlos ist, dann bist Du nicht der Kunde, sondern das Produkt." Dieser Spruch hat Konjunktur, wenn es um die Einschätzung von Facebook geht. Doch woher kommt dieser Spruch eigentlich? Aus dem kritischen Diskurs über das Fernsehen in den 70ern, hat Will Oremus herausgefunden. Doch ergibt der Spruch überhaupt einen Sinn? Und kann man das Fernsehen der 70er ohne weiteres mit den Sozialen Medien der Gegenwart vergleichen? Alles schwierig, meint Oremus - zumal man Facebook vorwirft, die Massen zu polarisieren und sozialen Unfrieden zu stiften, wohingegen das Kabelfernsehen der frühen 70er im Verdacht stand, die Massen zu homogenisieren und zu sedieren: "In dem Slogan steckt auch die sonderbare Unterstellung, dass sich alles zum Besseren wenden würde, wenn wir für das Privileg des sozialen Netzwerkens einfach bezahlen würden. ... Dabei gibt es genügend Firmen, die sich um das Wohlergehen ihrer zahlenden Kundschaft wenig kümmern. ... Es gibt mindestens zwei alternative Sichtweisen auf unsere Beziehung zu Facebook, die ein gesünderes, weniger ausbeuterisches Verhältnis versprechen. Die Erste: Wir sollten uns als Facebooks Kunden betrachten, die mit Zeit, Aufmerksamkeit und Daten statt mit Geld bezahlen. Dies impliziert größere Verantwortlichkeit auf beiden Seiten. ... Die zweite: Wir sollten uns als Teil von Facebooks Arbeitsheer begreifen. So wie die Arbeit von Bienen unwissentlich dem Imker dient, bereichern wir mit unseren Posts und Status-Updates kontinuierlich Facebook. Doch wir sind Menschen, keine Bienen, und als solche sind wir in der Lage, kollektiv eine bessere Behandlungsweise einzufordern. In seinem Buch 'Wem gehört die Zukunft?' kommt der Tech-Aktivist Jaron Lanier im Aufgriff dieser Analogie zu dem logischen Schluss, dass die Nutzer von Facebook und anderer datenhungriger Onlinedienste sich erheben und tatsächliche monetäre Kompensation für ihre Daten verlangen sollten."
"Wenn etwas kostenlos ist, dann bist Du nicht der Kunde, sondern das Produkt." Dieser Spruch hat Konjunktur, wenn es um die Einschätzung von Facebook geht. Doch woher kommt dieser Spruch eigentlich? Aus dem kritischen Diskurs über das Fernsehen in den 70ern, hat Will Oremus herausgefunden. Doch ergibt der Spruch überhaupt einen Sinn? Und kann man das Fernsehen der 70er ohne weiteres mit den Sozialen Medien der Gegenwart vergleichen? Alles schwierig, meint Oremus - zumal man Facebook vorwirft, die Massen zu polarisieren und sozialen Unfrieden zu stiften, wohingegen das Kabelfernsehen der frühen 70er im Verdacht stand, die Massen zu homogenisieren und zu sedieren: "In dem Slogan steckt auch die sonderbare Unterstellung, dass sich alles zum Besseren wenden würde, wenn wir für das Privileg des sozialen Netzwerkens einfach bezahlen würden. ... Dabei gibt es genügend Firmen, die sich um das Wohlergehen ihrer zahlenden Kundschaft wenig kümmern. ... Es gibt mindestens zwei alternative Sichtweisen auf unsere Beziehung zu Facebook, die ein gesünderes, weniger ausbeuterisches Verhältnis versprechen. Die Erste: Wir sollten uns als Facebooks Kunden betrachten, die mit Zeit, Aufmerksamkeit und Daten statt mit Geld bezahlen. Dies impliziert größere Verantwortlichkeit auf beiden Seiten. ... Die zweite: Wir sollten uns als Teil von Facebooks Arbeitsheer begreifen. So wie die Arbeit von Bienen unwissentlich dem Imker dient, bereichern wir mit unseren Posts und Status-Updates kontinuierlich Facebook. Doch wir sind Menschen, keine Bienen, und als solche sind wir in der Lage, kollektiv eine bessere Behandlungsweise einzufordern. In seinem Buch 'Wem gehört die Zukunft?' kommt der Tech-Aktivist Jaron Lanier im Aufgriff dieser Analogie zu dem logischen Schluss, dass die Nutzer von Facebook und anderer datenhungriger Onlinedienste sich erheben und tatsächliche monetäre Kompensation für ihre Daten verlangen sollten."La vie des idees (Frankreich), 02.05.2018
![]() Ary Gordien stellt Caroline Rolland-Diamonds Studie "Black America - Une histoire des luttes pour l'égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle)" vor, die er als eine "synthèse minutieuse et dense" empfiehlt. Unter anderem erzählt die Studie vom Entstehen des "schwarzen Nationalismus", der sicher einer der Ursprünge heutiger linker Identitätspolitik ist - er entstand im Bündnis mit antikolonialen Bewegungen: "Dieser Nationalismus verbindet ein ethnisches Selbstbewusstsein, das aus der Erfahrung eines extrem gewalttätigen Rassismus hervorgegangen ist mit dem Versuch, eine Erzählung über die Identität einer Gruppe und ihrer Kultur zu formulieren. Die Gruppe wird als Verkörperung dieser Kultur und dieser Traditionen definiert, die dafür notwendiger Weise neu definiert, wiederbelebt, ja erfunden werden müssen. Rolland-Diamond zeigt sehr schön, dass einige dieser Bewegungen (der Garveyismus, die Nation of Islam) diesen Nationalismus für eine separatistische Politik einsetzten, während andere (Black Panther Party) eine kulturelle Anerkennung im Rahmen der Vereinigten Staaten anstrebten und bestimmte Kleidungs- oder kulturelle Praktiken als 'afrikanisch' rehabilitieren wollten. Diese verschiedenen Richtungen geben bis heute ein Bild von den Bruchlinien innerhalb der schwarzen Bewegungen."
Ary Gordien stellt Caroline Rolland-Diamonds Studie "Black America - Une histoire des luttes pour l'égalité et la justice (XIXe-XXIe siècle)" vor, die er als eine "synthèse minutieuse et dense" empfiehlt. Unter anderem erzählt die Studie vom Entstehen des "schwarzen Nationalismus", der sicher einer der Ursprünge heutiger linker Identitätspolitik ist - er entstand im Bündnis mit antikolonialen Bewegungen: "Dieser Nationalismus verbindet ein ethnisches Selbstbewusstsein, das aus der Erfahrung eines extrem gewalttätigen Rassismus hervorgegangen ist mit dem Versuch, eine Erzählung über die Identität einer Gruppe und ihrer Kultur zu formulieren. Die Gruppe wird als Verkörperung dieser Kultur und dieser Traditionen definiert, die dafür notwendiger Weise neu definiert, wiederbelebt, ja erfunden werden müssen. Rolland-Diamond zeigt sehr schön, dass einige dieser Bewegungen (der Garveyismus, die Nation of Islam) diesen Nationalismus für eine separatistische Politik einsetzten, während andere (Black Panther Party) eine kulturelle Anerkennung im Rahmen der Vereinigten Staaten anstrebten und bestimmte Kleidungs- oder kulturelle Praktiken als 'afrikanisch' rehabilitieren wollten. Diese verschiedenen Richtungen geben bis heute ein Bild von den Bruchlinien innerhalb der schwarzen Bewegungen."
Außerdem in La Vie des Idées: Elodie Grossis Besprechung einiger amerikanischer Bücher über die Medizingeschichte der Sklaverei und des Rassismus in den USA.
New York Times (USA), 29.04.2018
 Das aktuelle Magazin der New York Times bringt einen Text von Gideon Lewis-Kraus über den Facebook-Prozess und die spannende Frage, ob der alte Antagonismus von Privatsphäre und Öffentlichkeit noch trägt: "Es geht um den Unterschied zwischen Staat und Unternehmensmacht, aber auch um subtilere und weitreichendere Effekte, nicht nur darum, ob jemand mithört, was wir im Schlaf reden. Nach Meinung des Datenschutzrechtlers Daniel J. Solove sollten wir uns weniger über die Gedankenpolizei sorgen und mehr darum, wie unsere Profildaten die unsichtbare Architektur unseres Alltags bestimmen. Ob uns jemand beobachtet, ist gar nicht der Punkt. Aber die Verfügbarkeit von Krediten, Jobs, Partnern, Hotelzimmern nimmt bereits still und leise ab für 'Leute wie uns', Leute mit unserer politischen Haltung, Hautfarbe, Freundeskreisen, Neigungen und Gehältern. Oder unsere politische Zugehörigkeit wird, wie im Fall des Cambridge Analytica Skandals, nach unseren Schwachstellen sortiert … Die beste aktuelle Definition von Privatheit braucht nicht viel, um zu bekräftigen, warum wir weiter auf unser Gefühl eines gewissen Unwohlseins hören sollten. Die Philosophin Helen Nissenbaum definiert Privatheit nicht als ein Recht, das mit anderen ins Gleichgewicht gebracht werden soll, sondern als Bedingung dessen, was sie 'kontextuelle Integrität' nennt. Sprechen wir über Privatheit, so Nissenbaum, so sprechen wir nicht über den Unterschied zwischen der Intimität unseres Schlafzimmers und der Öffentlichkeit der Straße, sondern eher über die spezifischen Normen und Erwartungen, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten bestimmen. Die herkömmliche Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit, so Nissenbaum weiter, postuliert 'nur zwei Kontexte mit je unterschiedlichem Normen-Repertoire - die Beschränkung aufs Private innerhalb der Privatsphäre, das Anything-Goes in der Öffentlichkeit. Das Konzept der kontextuellen Integrität hingegen geht von einer Vielzahl von sozialen Kontexten aus, jeder mit einem eigenen Regelrepertoire, das den Informationsfluss steuert.' Es gibt Dinge, die wir mit unserem Partner besprechen, aber nicht mit unserem Chef, und es gibt Dinge, die wir mit einem Arzt besprechen, aber nicht mit einem Anwalt usw."
Das aktuelle Magazin der New York Times bringt einen Text von Gideon Lewis-Kraus über den Facebook-Prozess und die spannende Frage, ob der alte Antagonismus von Privatsphäre und Öffentlichkeit noch trägt: "Es geht um den Unterschied zwischen Staat und Unternehmensmacht, aber auch um subtilere und weitreichendere Effekte, nicht nur darum, ob jemand mithört, was wir im Schlaf reden. Nach Meinung des Datenschutzrechtlers Daniel J. Solove sollten wir uns weniger über die Gedankenpolizei sorgen und mehr darum, wie unsere Profildaten die unsichtbare Architektur unseres Alltags bestimmen. Ob uns jemand beobachtet, ist gar nicht der Punkt. Aber die Verfügbarkeit von Krediten, Jobs, Partnern, Hotelzimmern nimmt bereits still und leise ab für 'Leute wie uns', Leute mit unserer politischen Haltung, Hautfarbe, Freundeskreisen, Neigungen und Gehältern. Oder unsere politische Zugehörigkeit wird, wie im Fall des Cambridge Analytica Skandals, nach unseren Schwachstellen sortiert … Die beste aktuelle Definition von Privatheit braucht nicht viel, um zu bekräftigen, warum wir weiter auf unser Gefühl eines gewissen Unwohlseins hören sollten. Die Philosophin Helen Nissenbaum definiert Privatheit nicht als ein Recht, das mit anderen ins Gleichgewicht gebracht werden soll, sondern als Bedingung dessen, was sie 'kontextuelle Integrität' nennt. Sprechen wir über Privatheit, so Nissenbaum, so sprechen wir nicht über den Unterschied zwischen der Intimität unseres Schlafzimmers und der Öffentlichkeit der Straße, sondern eher über die spezifischen Normen und Erwartungen, die die Kommunikation zwischen verschiedenen Gruppen zu verschiedenen Zeiten, an verschiedenen Orten bestimmen. Die herkömmliche Unterscheidung von Öffentlichkeit und Privatheit, so Nissenbaum weiter, postuliert 'nur zwei Kontexte mit je unterschiedlichem Normen-Repertoire - die Beschränkung aufs Private innerhalb der Privatsphäre, das Anything-Goes in der Öffentlichkeit. Das Konzept der kontextuellen Integrität hingegen geht von einer Vielzahl von sozialen Kontexten aus, jeder mit einem eigenen Regelrepertoire, das den Informationsfluss steuert.' Es gibt Dinge, die wir mit unserem Partner besprechen, aber nicht mit unserem Chef, und es gibt Dinge, die wir mit einem Arzt besprechen, aber nicht mit einem Anwalt usw."