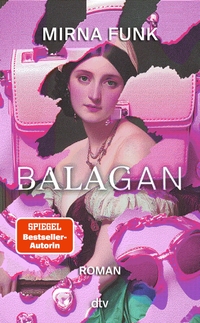Im Kino
Nicht alles am Genie ist abzulehnen
Die Filmkolumne. Von Patrick Holzapfel
29.01.2025. Jedes Bild hat Gewicht in Brady Corbets monumentalem Immigranten-Epos "The Brutalist". Gleichzeitig jedoch bewundert der dreieinhalb Stunden lange Film um einen jüdischen Architekten, der in den USA der Nachkriegszeit Karriere macht, eben dieses Gewicht, das er hat, doch etwas zu sehr.
Manche behaupten ja, das Kino wäre Seismograf für allerhand Zeitgeistiges. Sie erkennen etwa das Verschwinden der Utopie aus dem kollektiven Erwartungshorizont, wie Jacques Rancière einmal im Angesicht der unzähligen Katastrophenfilme Hollywoods. Oder sie raunen vieldeutig wie Filmemacher Pedro Costa, der unlängst von sich gab, dass es immer ein schlechtes Zeichen für die Welt wäre, wenn man viele Filme von Ridley Scott im Kino sehen könne. Wer möchte, kann auch im erstaunlichen Comeback des männlichen Genies in den letzten Kinomonaten eine gesellschaftliche Tendenz ablesen. Schließlich drohen die feministischen Errungenschaften des vergangenen Jahrzehnts dieser Tage politisch begraben zu werden.
Das leidende Genie hat wieder oder nach wie vor einen Penis, so zumindest zeigen das die männlichen Regisseure, die sich allesamt selbst mehr oder weniger mit dem Begriff des Genies identifizieren. Die Rede ist beispielsweise von Coppola, Cronenberg und Corbet. In deren jüngsten Filmen wird gegen die Schwerkraft und organische Prozesse geschaffen, die leidenden Männer kreieren Überwältigendes, die Vorstellung Übersteigendes. Der dramaturgische Oppenheimer-Effekt wird im nach Geschichten suchenden Kino zum ausgerechnet an Ayn Rand gemahnenden Aufbegehren des Individuums gegen die sich zersetzende Gesellschaft.
Corbet reiht sich wie schon in seinen vorherigen Filmen mit seinem nicht nur im Titel wuchtigen "The Brutalist" in die Reihe nordamerikanischer Autorenfilmer ein, die allein durch den ausufernden Maximalismus ihrer Arbeiten eine gewisse Aura aufbauen. Das bringt all jene ins Staunen, die dafür bereit sind. Dazu passt, dass der Film am US-amerikanischen Mythos sägt wie lange kein Film mehr aus Übersee. Das Genie, das ist hier nicht nur der gegen sämtliche kunstfeindlichen, rassistischen und kapitalistischen Widerstände anrennende ungarische Immigrant László Tóth (Adrien Brody), nein, es ist auch Corbet selbst, der mit einem Budget von "nur" zehn Millionen Dollar über sieben Jahre gegen alle Widerstände ein über dreieinhalb Stunden dauerndes, bildgewaltiges, auf Vista Vision gedrehtes historisches Großwerk schaffen wollte. Er sagte, dass sein Film, der in ausgewählten Kinos auch auf 70mm zu sehen ist, selbst ein brutalistisches Objekt wäre. Dass er damit nicht komplett scheitert, ist erstaunlich.

Erzählt wird recht klassisch, fast romanhaft die Geschichte jenes Architekten, der aus lange obskur bleibenden Gründen aus Europa flüchten musste, um in den USA auf seine Frau zu warten und sich durchzuschlagen. Der Film spannt die Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1960er auf. Die Migration gelingt (was auch immer das heißen soll; vielleicht, dass er nicht vollkommen zugrunde geht) Tóth trotz zahlreicher Hindernisse, auch wenn er immer wieder Gefahr läuft, seine Identität und seinen Verstand zu verlieren. Corbet fächert ein riesiges Gemälde auf, in dem sich an W.G. Sebald erinnernde Traumatakorridore in einer kollektiven Malaise verlieren, die Prinzipien brutalistischer Nachkriegsbaukunst auf die filmische Form und das Gesicht Adrien Brodys gegossen werden, die Kompromisslosigkeit eines genialistischen Künstlers, die Erfahrung von Fremdheit, der korrupte Traum einer Freiheit in den USA und die falschen Versprechen des Kapitalismus sich in einem riesigen Klotz vermengen, der vor allem sein eigenes Gewicht bewundert. Vielleicht erzählt Corbet auch vom Zuviel der Geschichte, davon, wie sich nichts mehr wirklich erzählen lässt, außer das eigene Schaffen.
Tóth, der lose auf dem Architekten Marcel Breuer basiert, arbeitet zunächst für seinen Cousin Attila (Alessandro Nivola), doch als es zu einem Unfall bei der Neugestaltung einer Privatbibliothek des superreichen Industriellen Van Buren (Guy Pearce) kommt, lässt sein Verwandter ihn fallen. In Ungarn ein berühmter Architekt, landet Tóth nun in einem Obdachlosenheim. Er befreundet sich mit Gordon (Isaac de Bankolé), einem schwarzen Arbeiter und die beiden beginnen, Heroin zu konsumieren. Plötzlich aber steht wieder Van Buren vor ihm und bietet ihm nicht nur eine Möglichkeit an, seiner Kunst nachzugehen, sondern auch, seine Frau Erzsébet (Felicity Jones) ins Land zu holen. Soweit ist das eine romantische Geschichte des American Dream, nur dass der Film noch nicht einmal bei seiner Intermission angelangt ist. Das versprochene Glück ist pervertiert, der Aufstieg ein moralischer Fall. Ein angestrengt bedrohliches Wummern kündet vom kommenden Unheil, damit auch niemand verpasst, wie tiefgehend das alles ist.
Tatsächlich überwältigt der sich formal zugleich am Architektonischen wie Opernhaften orientierende Film bisweilen. Das liegt zum einem am groß aufspielenden Ensemble rund um Brody, dessen zwischen selbsthassendem Leid und kecker Arroganz changierendes Antlitz subtilste Regungen greifbar macht. Aber auch Guy Pearce als Plutokrat Van Buren, der den Architekten erst verkennt, um ihn später damit zu beauftragen, ein riesiges Gemeindezentrum zu bauen, überzeugt in seiner schmierigen Selbstherrlichkeit, die von der Pervertierung der Kunst durch jene berichtet, die sie kaufen. Zum anderen versteht sich Corbet darauf, mit Hilfe einer beeindruckenden Kamera- und vor allem Schnittarbeit, aus jeder noch so beiläufigen Szene etwas herauszuholen. Jede Figur erhält eine eigenwillige Präsenz, jedes Bild Gewicht. Wie in der Architektur der Nachkriegsjahre strebt der Filmemacher danach, im Material seines Filmes Botschaften anzulegen. Das gelingt mal mehr, mal weniger, aber ist durchgehend faszinierend anzusehen. Selbst eine junge Angestellte auf dem Anwesen Van Burens, die in einem anderen Film nur eine Statistin wäre, bekommt unvermittelt eine Nahaufnahme, in der sich zeigt, dass auch sie Teil dieser Geschichte ist, dass auch sie diese Geschichte in sich trägt. Was für Geschichten und Botschaften das sind, bleibt außer am plumpen Ende, in dem ein Twist die Ambiguität des Films zugunsten einer Geschichte vom künstlerischen Triumph in Frage stellt, offen.

Corbet zeigt von den ersten, schweißnahen Handkamerabildern auf einem in New York ankommenden Schiff an ein schiefes Bild der Freiheitsversprechen, auf denen sich das Selbstverständnis der US-amerikanischen Kultur gründet. Beiläufiger Rassismus, eine unverrückbare Hierarchie, in der das Geld an der Spitze steht und ein kaum merklicher und doch dringlicher Assimilationszwang, der beispielsweise die jüdische Kultur betrifft, die mancher von Tóths Verwandten aufgibt, um überhaupt Fuß fassen zu können in den Staaten, prägen die Erfahrungen des ehrgeizigen Feingeists, dessen Ungarisch, so liest man im Abspann, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz aufgepeppt wurde. Gleichzeitig erzählt The Brutalist auch vom Entstehen eines Kunstwerks. Es ist gerade dieses Nebeneinander, Miteinander oder Gegeneinander von Kunst und der Welt, in der sie entsteht, das viele Wunden offenlegt.
Nicht alles am Genie ist abzulehnen. Immerhin überflügelt dieses bloße Wort die weitverbreitete Tendenz, das Kino nicht wirklich ernst zu nehmen. Sogar Kunst darf Film sein, wenn ein Genie dahinter steht! Es ist nur schade, dass sich die Genies immer so anstrengen müssen, Genies zu sein. Mit ihren Gimmicks (Ouvertüren und Epilogen, sich aufdrängenden Musikmotiven, dem wie üblich aus manipulativen dramaturgischen Kniffen entstehenden Abgrund aus Drogensucht und Vergewaltigung, Verrat und Holocaust) und leeren Gesten stellen sie Behauptungen auf, die sich letztlich zu einer unkenden Wolke des Unheils verdichten, aus der es nur tröpfelt. Wie bei manch brutalistischem Bauwerk wähnt man sich an der Türschwelle einer unendlich komplexen Struktur, nur um festzustellen, dass sich dahinter nichts befindet, als die Schonungslosigkeit und Potenz massiven Betons. Immerhin wird so eine Leere sichtbar, die auch als Kritik am Kulturverständnis der Vereinigten Staaten lesbar wird. Corbet hat nicht viel zu sagen außer dies: Ihr wollt keine wirkliche Kunst, sie entsteht trotzdem. Womöglich ist das gar nicht so wenig in einer Zeit, in der Menschenfeindlichkeit auch die Kunst gefährdet.
Patrick Holzapfel
The Brutalist - USA 2024 - Regie: Brady Corbet - Darsteller: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn, Raffey Cassidy - Laufzeit: 214 Minuten.
2 Kommentare