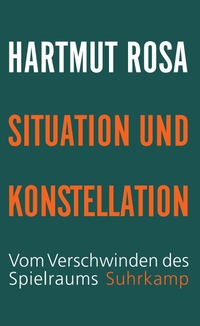Im Kino
Die Schönheit im Blutbad
Die Filmkolumne. Von Patrick Holzapfel
30.04.2025. Sind wir in '"Tardes de Soledad" von den Stierkämpfen fasziniert, die der Regisseur Albert Serra uns zeigt, oder vom Film selbst? Das ist die entscheidende Frage dieses durch und durch synthetischen Dokumentarfilms, der viel an die Rezeption denkt und wenig an die Wirklichkeit.
Am 1. August 1970 erschien in der französischen Illustrierten Paris Match ein kanonischer Text der Filmkritik unter dem Titel "'Le Shérif': Alexandre Astruc fait rendre justice à Howard Hawks". Darin nähert sich Alexandre Astruc "Rio Bravo" und Hawks, bezeichnet den Regisseur als Faschist und seinen Film als reaktionär - aber gleichzeitig als geniales Kunstwerk. In den letzten Jahren hat dieser Text an Bedeutung gewonnen, weil er entgegen des Zeitgeistes das moralische Urteil von der Kritik nach ideologischen Prinzipien abhebt. Astruc positioniert das Sehen von Filmen und das Erkennen von deren Qualität (im Fall von Hawks unter anderem das Offenbaren einer bestimmten Form der Männlichkeit) außerhalb des politischen Denkens. Er schreibt: "Es ist unmöglich, Rio Bravo gesehen zu haben, ohne Stolz zu verspüren, ein Mann zu sein." Unabhängig davon, ob Astruc sich stolz fühlen möchte und diesen Stolz überhaupt unterschreibt, gesteht er Hawks zu, dieses Gefühl aufrichtig und durch sein filmisches Können entstehen zu lassen.
Ich musste an diesen Text denken, als ich Albert Serras Tauromachie-Meditation "Tardes de Soledad" gesehen habe. Serra ist weniger Faschist als bourgeoiser Provokateur, seine Filme verpflichten sich nie den Menschen und Gegebenheiten, die er filmt, sie zielen auf ein Spiel mit denen, die sie sehen. Würde man ihm unterstellen, ein bestimmtes Bild von Männlichkeit zu zeigen, würde er entgegnen, dass er gar nichts wolle, nur die Schönheit und Seltsamkeit der Welt zu filmen, vielleicht. Wie er filmisch die ästhetischen Qualitäten grausamer Ereignisse zelebriert, erinnert an Futuristen oder Appolinaires Vergleich eines abstürzendes Flugzeugs mit einer Sternschnuppe, seine Filme entstehen augenscheinlich aus einer Lust am Verteidigen der Dekadenz und einem kalkulierten Spiel mit der Bedeutungslosigkeit des Kinos, oder wie ein spanischer Kritiker schrieb: "Für Albert Serra ist das Kino nutzlos, es hat seine eigenen Regeln und er hält sie für fremd gegenüber anderen Lebensbereichen."
L'art pour l'art ist sein Ansatz, obwohl das natürlich Unsinn ist. Serra weiß genau, was er tut, er will es nur so tun, dass niemand bemerkt, was er tut. Er will Filme machen, die, so hat er das selbst einmal gesagt, für die Kritik unfuckable sind und bis zu einem gewissen Grad gelingt ihm das immer wieder. Diesmal versucht er sich darin, einen apolitischen Film über ein Politikum in Spanien zu drehen und so mit den Vorurteilen jener, die sich einen solchen Film ansehen, zu spielen. Serra versucht, wie Astruc, den Wert des Kinos in sich selbst zu finden. Kein Wunder jedenfalls, dass die Stierkämpfer um Star-Torrero Andrés Roca Rey eher wenig mit dem Film anfangen konnten, als sie ihn zum ersten Mal sahen. Ihre Arbeit wird zwar durchaus gewürdigt vom Film, aber sie erscheint holpriger, menschlicher, weniger nobel, als es die fantasievolle Selbstbelügung der Tauromachie gern hat. Was diese Männer nicht so gern sehen, sind unsaubere Bewegungsabläufe und Nahaufnahmen der sterbenden Stiere. Nichts, was einen daran erinnert, dass diese ritualistische Praxis in der Wirklichkeit stattfindet, auch wenn gerade diese Wirklichkeit (die Möglichkeit des Todes für den Torero, die Sicherheit des Todes für den Bullen) die abscheuliche Faszination des Blutspektakels ausmacht. Das bedeutet allerdings nicht, dass Serra die Praxis des Stierkampfs mit seinem Film angreift. Er macht nichts und alles zugleich.
Serra hat sein über mehrere Jahre und insgesamt vierzehn Kämpfe hinweg gefilmtes Material dem Ablauf einer Corrida gemäß zu sechs Kämpfen verdichtet. Sechsmal also sehen wir den posierend tänzelnden Roca Rey in Halbtotalen und Nahaufnahmen in seinen herrlich schillernden Kostümen im Angesicht hilfloser Stiere. Repetitiv und fast hypnotisch gestaltet sich dieses Warten auf die ästhetische Magie (so man denn für sie empfänglich ist), diese Unsicherheit vor dem möglichen, beziehungsweise sicheren Tod. Da Rey gleich zweimal gefährlich angegriffen wurde, als Serras Kameras filmten, liegt eine anhaltende Unsicherheit in den Aufnahmen. Es wird klar, dass dieser Mann sich wirklich in Gefahr bringt, man muss das Schlimmste befürchten. Einmal wird er zwischen den Hörnern eines Stiers eingeklemmt, Panik bricht aus. "Große Männer wie du haben immer Glück", sagt einer zu ihm, als er sich in einem existenzialistischen Moment fragt, warum er nicht schwerer verletzt wurde. Wohl seit Budd Boettichers "The Bullfighter and the Lady" (1951) ist es keinem Film mehr gelungen, das tatsächliche Angesicht des Todes, das zu dieser Tätigkeit gehört, so eindrucksvoll ins Bild zu setzen. Und ja, das ist widerwärtig, ein bisschen lächerlich, seltsam schön und zugleich eine außerordentliche filmische Erfahrung.

Zwischen den Kämpfen in den Arenen montiert Serra Bilder des Toreros und seiner Entourage im Auto und im Hotelzimmer, es wird gebetet, geküsst, sich gekleidet und die immense, poetische, sich ins Ungesunde ausdehnende Größe der Hoden ("größer als die Arena") in einem nicht enden wollenden Singsang betont. Roca Rey ist ein schillernder Mann in diesem Film, expressiv, exzentrisch und ungreifbar. Wie so viele der männlichen Protagonisten im Werk Serras hört er nie auf zu performen, aber Serra zeigt uns oft die Augenblicke, in der seine immerwährende Darstellung durchlässiger wird, weil ein Schmerz, eine Furcht oder ein Wahnsinn über seine Züge weht. Ständig gleitet die Kamera über den Körper des Toreros, verliert sich in dessen Mienenspiel, das in den hintersten Reihen der Arena sichtbar sein soll und daher in den Nahaufnahmen bisweilen zur Fratze wird. Der Film zeigt das Spektakel eines Mannes, der sich in Gefahr begibt.
Die mit jeweils drei Kameras und einem erstaunlichen System von Ansteckmikros aufgenommenen Ereignisse finden fast jenseits jeglichen Eingriffs des Regisseurs statt. "Tardes de Soledad" ist ein Montagefilm, der im Material nach einer schwebenden Ambiguität sucht, die zugleich die moralische Haltung zum Spektakel betrifft, als auch das dünne rote Tuch zwischen Leben und Tod. Serra zeigt einmal mehr, dass er alles aus einem digitalen Bild machen kann. Es gibt keine Integrität in den Aufnahmen. Bild und Ton werden willkürlich kombiniert, es wird zwischen verschiedenen Kämpfen und Arenen gesprungen, nichts muss dem entsprechen, was wirklich geschehen ist. Alle sollen so aussehen, wie der Filmemacher es möchte. Das mögen manche für die Normalität des Kinos halten, andere für ein Symptom einer in Bildern lebenden Welt. Einmal mehr zeigt Serra, dass im Schnitt die Welt entsteht, eine Welt, die nach der Schönheit im Blutbad sucht. Hier komme ich wieder zurück auf Astruc. Denn ich konnte mir nicht helfen beim Sehen des Films: Ich verabscheue den Stierkampf und die Gewalt, die die Tiere erleiden müssen, aber ich habe durch Serra und dessen Montage die Schönheit dieser wie auch immer konstruierten Suche nach einer Wahrheit nachempfinden können, die aus dem Gegenüber von "Mensch und Bestie" entsteht; dieser letzten Wahrheit, in der er eben nur mehr darum geht: "Du oder Ich". Und ich habe mich aufgrund der Nahaufnahmen der sterbenden Stiere gefragt, was es bedeutet, am Leben zu sein. Vor allem, wenn die Bullen in die Kamera schauen, geschieht etwas, das schwer in Worte zu fassen ist. Ich habe etwas gespürt in dieser Liturgie des Todes, die mir sonst so fern ist. Das ist eine große Leistung eines unerträglichen Films.

Dem Titel entsprechend, trennt die Kadrierung oft den Stier und den Torero. Mensch und Tier sind einsam in dieser künstlichen Welt, einsam in ihrem Aufeinandertreffen um Leben und Tod. Die Kamera ist nah, man hört den Atem, die kurzen Worte im Adrenalinrausch, Laute, die fast unfreiwillig aus den Beteiligten hervorbrechen. Der Mensch ist einsam, der Stier ist einsam. Serra möchte seine Zuschauer zurückwerfen auf ein existenzielles, fast archaisches Erleben einer Situation, in der keine Worte mehr helfen. Damit verbrüdert sich sein Film mit den Prinzipien des Stierkampfes. Das erinnert an Michel Leiris und seinen Text "Spiegel der Tauromachie", in dem der Schriftsteller eine Analogie zwischen einer Corrida und dem Akt des autobiografischen Schreibens herzustellen versucht. Leiris geht es unter anderem um das Erzeugen einer Bedeutung im Schreiben, die nicht lächerlich wirkt im Angesicht der Schrecken der Welt. Ein Gewicht in der Kunst, das eine existenzielle Bedeutung hat, mehr als bloß eine Simulation von Größe. Vielleicht wirft Serra auch deshalb in Interviews mit fragwürdigen Vergleichen zwischen dem Stierkampf und dem Krieg in der Ukraine um sich. Er will sagen, dass er Menschen zeigt, die nicht mehr moralisch urteilen wollen und können, er will zeigen, dass es tiefe, transzendente Erfahrungen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Das ist allerdings mehr als ein schiefer Vergleich, denn er ignoriert den sicheren Tod des Stieres und die im Vergleich zu Kriegen noch größere Willkür im Stierkampf, der schließlich letztlich eine Form von Unterhaltung ist. Aber das ist sowieso das, was sich immer etwas fahl anfühlt bei Serra: Man spürt, dass er viel an die Rezeption denkt und wenig an die Wirklichkeit.
Die entscheidende Frage ist: Empfindet man Faszination für den Stierkampf oder für den Film? Für Serra mag das keinen Unterschied machen, aber eben deshalb entzieht er sich (im Gegensatz zum Torero) einer Verantwortung. Letztlich muss man sich fragen, was die Aufgabe des Filmemachers ist. Das ist eine ethische Frage, zu groß, um sie an einen einzelnen Film heran zu tragen, aber sie stellt sich. Sich filmisch davor zu drücken, Position zu beziehen, ist lange schon ein Ideal bürgerlicher Kunst. Nichts spricht gegen Ambiguitäten und eine Betonung der Nuancen. Nichts spricht dagegen, Zuschauern deren eigene Meinung zu überlassen. Was Serra und viele andere aber geflissentlich übersehen, ist, dass die Wahl des Themas oder der gefilmten Lebewesen bereits darüber entscheidet, welche Verantwortung man gegenüber einem Film hat. Das hat sich seit Astrucs Verteidigung des "faschistischen Filmemachers" Hawks nicht verändert. Das ästhetische, sinnliche Erleben des Gemetzels schafft anders als bei Hawks aus dem Gezeigten keine eigene Weltsicht, errichtet und verteidigt kein Genre und dessen Prinzipien, nein, es bedient sich der real existierenden Faszination, die im Stierkampf angelegt ist. Die Distanz zwischen Kamera und Spektakel ist nicht groß genug, um wirklich etwas zu sehen. Wenn dann sind es die Momente, in denen die Würde zusammenbricht, die Blicke der sterbenden Tiere, die Blutfontänen in Nahaufnahme oder die verabreichten Energy-Drinks.
Und am Ende bleibt doch eine seltsame Euphorie. Das letzte Duell im Film ist das kürzeste, eleganteste. Fast ohne ein Staubkorn abzubekommen, richtet der Torero den Stier rasch hin. Unter tosendem Applaus verlässt er die Arena. Jetzt ist Serra ganz beim Torero, am Anfang des Films ist er beim Stier. Das ist eine Setzung, die fast einer Wertung gleichkommt. Wer sich von Serra verführen lässt, bewundert am Ende des Films den Torero und muss einmal mehr hinterfragen, ob die eigenen moralischen Prinzipien gegenüber der Wirklichkeit, dem Kino standhalten.
Patrick Holzapfel
Tardes de soledad - Spanien 2024 - Regie: Albert Serra - Laufzeit: 125 Minuten.
Kommentieren