 Elias Hirschl: Schleifen
Elias Hirschl: SchleifenFranziska Denk wächst im Umfeld des Wiener Kreises auf und leidet als Kind an einer seltsamen Krankheit: Jedes Symptom, von dem sie hört oder liest, bekommt sie sofort. In…
 Kaum zu glauben, dass Jans Karskis erschütternder "Mein Bericht an die Welt" erst jetzt auf Deutsch erscheint, 67 Jahre nach seiner Veröffentlichung im englischen Original. Karski schildert darin seine schier unglaublichen Erlebnisse als Kurier des polnischen Widerstands gegen die Nationalsozialisten. So abenteuerlich dies mitunert auch anmutet - die Gestapo hat Karski durch halb Europa gejagt, gefasst und gefoltert -, am Bewegendsten waren für alle Rezensenten doch die Kapitel, in denen Karski schildert, wie er sich in das Warschauer Ghetto und das Konzentrationslager Izbica einschleusen ließ, um anschließend in London und Washington von der Vernichtung der europäischen Juden zu berichten. Von FR bis NZZ zeigen sich alle Rezensenten erschüttert von diesem Bericht, in der taz nennt ihn Christian Semler eine "schmerzliche, eine unverzichtbare Lektüre", und in der Zeit zeigt sich die Historikerin Katarina Bader besonders von Unbeholfenheit ergriffen, mit der Karski das Konzentrationslager schildert: "Er hatte dafür keine Vorbilder - es gab noch kein Holocaustvokabular." Einhellig gelobt wird auch das instruktive Vorwort von Celine Gervais-Francelle. (Hier Karskis einstündige Video-Aussage für die Shoah-Foundation, hier ein Auszug aus Claude Lanzmanns "Shoah"-Film.)
Kaum zu glauben, dass Jans Karskis erschütternder "Mein Bericht an die Welt" erst jetzt auf Deutsch erscheint, 67 Jahre nach seiner Veröffentlichung im englischen Original. Karski schildert darin seine schier unglaublichen Erlebnisse als Kurier des polnischen Widerstands gegen die Nationalsozialisten. So abenteuerlich dies mitunert auch anmutet - die Gestapo hat Karski durch halb Europa gejagt, gefasst und gefoltert -, am Bewegendsten waren für alle Rezensenten doch die Kapitel, in denen Karski schildert, wie er sich in das Warschauer Ghetto und das Konzentrationslager Izbica einschleusen ließ, um anschließend in London und Washington von der Vernichtung der europäischen Juden zu berichten. Von FR bis NZZ zeigen sich alle Rezensenten erschüttert von diesem Bericht, in der taz nennt ihn Christian Semler eine "schmerzliche, eine unverzichtbare Lektüre", und in der Zeit zeigt sich die Historikerin Katarina Bader besonders von Unbeholfenheit ergriffen, mit der Karski das Konzentrationslager schildert: "Er hatte dafür keine Vorbilder - es gab noch kein Holocaustvokabular." Einhellig gelobt wird auch das instruktive Vorwort von Celine Gervais-Francelle. (Hier Karskis einstündige Video-Aussage für die Shoah-Foundation, hier ein Auszug aus Claude Lanzmanns "Shoah"-Film.) Das Buch "Veit" hat schon ein ziemlich überraschendes Personal: Veit Harlan, der Vater des Autors und Regisseur des infamen Films "Jud Süß", klar, aber auch Thomas Mann, Kurt Georg Kiesinger, Klaus Kinski - dass die alle in ein und dasselbe Leben passen! Thomas Harlan erinnert sich, sein Buch selbst auf dem Sterbebett diktierend, an die drei letzten Tage seines Vaters, aber auch an die unmittelbare Kriegszeit, in der die Weichen erstmal Richtung Verdrängung gestellt wurden. Die Rezensenten sind bewegt, aber auch irritiert. Der Ton des einst so unerbittlichen Thomas Harlan werde versöhnlich, ja sogar hohepriesterlich, schreibt etwa Edo Reents in der FAZ. Grabeskalt weht es Helmut Böttiger in der SZ an. "Ein privatistisches Denkmal für eine offenbar nie zu Ende exorzierte Vater-Sohn-Beziehung, Selbst-Analyse im Medium der Literatur", urteilt Simon Rothöhler in Cargo. Es scheint sich um ein sehr deutsches Dokument zu handeln, das zwischen den Extremen schwankt und ein eher unheimliches Schlaglicht auf die Zeit nach 45 wirft.
Das Buch "Veit" hat schon ein ziemlich überraschendes Personal: Veit Harlan, der Vater des Autors und Regisseur des infamen Films "Jud Süß", klar, aber auch Thomas Mann, Kurt Georg Kiesinger, Klaus Kinski - dass die alle in ein und dasselbe Leben passen! Thomas Harlan erinnert sich, sein Buch selbst auf dem Sterbebett diktierend, an die drei letzten Tage seines Vaters, aber auch an die unmittelbare Kriegszeit, in der die Weichen erstmal Richtung Verdrängung gestellt wurden. Die Rezensenten sind bewegt, aber auch irritiert. Der Ton des einst so unerbittlichen Thomas Harlan werde versöhnlich, ja sogar hohepriesterlich, schreibt etwa Edo Reents in der FAZ. Grabeskalt weht es Helmut Böttiger in der SZ an. "Ein privatistisches Denkmal für eine offenbar nie zu Ende exorzierte Vater-Sohn-Beziehung, Selbst-Analyse im Medium der Literatur", urteilt Simon Rothöhler in Cargo. Es scheint sich um ein sehr deutsches Dokument zu handeln, das zwischen den Extremen schwankt und ein eher unheimliches Schlaglicht auf die Zeit nach 45 wirft. Mit sehr viel Sympathie wurden Werner Schroeters Erinnerungen "Tage im Dämmer, Nächte im Rausch" aufgenommen, die er in den letzten Monaten seines Lebens zusammen mit der Filmautorin Claudia Lenssen verfasst hat. Sehr spontan, aber voller Elan und Witz erzählt Schroeter von seinem Leben, dessen Bühne Rosa von Praunheim, Rainer Werner Fassbinder und Michel Foucault ebenso betraten wie Marianne Hoppe, Isabelle Huppert und Ingrid Caven. Offenbar kommt hier alles zusammen: Ein großes, obsessives, unerschrockenes Künstlerleben voller Liebe, Schmerz und Suche nach Wahrheit und Schönheit, wie Katja Nicodemus in der Zeit schreibt, und ein großer faszinierender Erzähler, "liebenswürdig, narzisstisch, witzig, offen bis zur Selbstentblößung, dabei erfüllt von Noblesse, voller Anekdoten", wie Rüdiger Suchsland in der FAZ schwärmt. Cristina Nord erinnert in der taz daran, auf wie viel Ablehnung Schroeter in Deutschland stieß, bemerkt aber auch, dass sich in dem Buch Heiterkeit, Gelassenheit und eine Menge Galgenhumor gegen Pathos und Todessehnsucht behaupten.
Mit sehr viel Sympathie wurden Werner Schroeters Erinnerungen "Tage im Dämmer, Nächte im Rausch" aufgenommen, die er in den letzten Monaten seines Lebens zusammen mit der Filmautorin Claudia Lenssen verfasst hat. Sehr spontan, aber voller Elan und Witz erzählt Schroeter von seinem Leben, dessen Bühne Rosa von Praunheim, Rainer Werner Fassbinder und Michel Foucault ebenso betraten wie Marianne Hoppe, Isabelle Huppert und Ingrid Caven. Offenbar kommt hier alles zusammen: Ein großes, obsessives, unerschrockenes Künstlerleben voller Liebe, Schmerz und Suche nach Wahrheit und Schönheit, wie Katja Nicodemus in der Zeit schreibt, und ein großer faszinierender Erzähler, "liebenswürdig, narzisstisch, witzig, offen bis zur Selbstentblößung, dabei erfüllt von Noblesse, voller Anekdoten", wie Rüdiger Suchsland in der FAZ schwärmt. Cristina Nord erinnert in der taz daran, auf wie viel Ablehnung Schroeter in Deutschland stieß, bemerkt aber auch, dass sich in dem Buch Heiterkeit, Gelassenheit und eine Menge Galgenhumor gegen Pathos und Todessehnsucht behaupten. Auf großes Interesse gestoßen ist dieses Buch "Patentöchter" das nach der Ermordung Jürgen Pontos durch die RAF die vorsichtige Kontaktaufnahme zwischen Opfer- und Täterfamilie dokumentiert. Julia Albrecht ist die Schwester von Susanne Albrecht, die 1977 einem RAF-Kommando den Weg ins Haus des Bankiers Ponto öffnete, die beiden Familien waren zu der Zeit noch miteinander befreundet. Corinna Ponto ist die Tochter des Ermordeten, sie hat sich auf diesen Dialog eingelassen. In der SZ spricht Thorsten Schmitz von einem Buch, das "leise vom Ton", aber dennoch mit einem starken Ausrufezeichen daherkomme, und er hegt die Hoffnung, dass dies die Ruhe der noch hartnäckig schweigenden Ex-Terroristen stören wird. In der taz zeigt sich Wolfgang Gast sehr beeindruckt von der Offenheit und Klarheit der Autorinnen.
Auf großes Interesse gestoßen ist dieses Buch "Patentöchter" das nach der Ermordung Jürgen Pontos durch die RAF die vorsichtige Kontaktaufnahme zwischen Opfer- und Täterfamilie dokumentiert. Julia Albrecht ist die Schwester von Susanne Albrecht, die 1977 einem RAF-Kommando den Weg ins Haus des Bankiers Ponto öffnete, die beiden Familien waren zu der Zeit noch miteinander befreundet. Corinna Ponto ist die Tochter des Ermordeten, sie hat sich auf diesen Dialog eingelassen. In der SZ spricht Thorsten Schmitz von einem Buch, das "leise vom Ton", aber dennoch mit einem starken Ausrufezeichen daherkomme, und er hegt die Hoffnung, dass dies die Ruhe der noch hartnäckig schweigenden Ex-Terroristen stören wird. In der taz zeigt sich Wolfgang Gast sehr beeindruckt von der Offenheit und Klarheit der Autorinnen.  1600 Briefe von Rahel Levin Varnhagen umfasst dieses Buch des Andenkens und den euphorischen Rezensenten zufolge ist dies kein einziger zu viel! In der Zeit erklärt Dorion Weickmann das Buch zu einem Lesevergnügen allererster Güte, denn für Weickmann verbinden sich hier Reflexion und Tratsch, Vernunft und Leidenschaft, Freundschaft und Liebe zu einer großen Lebenserzählung. In der Welt widmete Harro Zimmermann dieser Ausgabe eine eingehende Besprechung, in der er sehr schön auch Rahels empathische Intellektualität, ihre Klugheit und ihre Liebessehnsucht beschwor. Auch wie sie, die stets mehr sein wollte als nur die größte Saloniere des Berliner Geistesadels, ihre Korrespondenz selbst einzuschätzte, gefällt Zimmermann: "Es wird eine Original-Geschichte und poetisch."
1600 Briefe von Rahel Levin Varnhagen umfasst dieses Buch des Andenkens und den euphorischen Rezensenten zufolge ist dies kein einziger zu viel! In der Zeit erklärt Dorion Weickmann das Buch zu einem Lesevergnügen allererster Güte, denn für Weickmann verbinden sich hier Reflexion und Tratsch, Vernunft und Leidenschaft, Freundschaft und Liebe zu einer großen Lebenserzählung. In der Welt widmete Harro Zimmermann dieser Ausgabe eine eingehende Besprechung, in der er sehr schön auch Rahels empathische Intellektualität, ihre Klugheit und ihre Liebessehnsucht beschwor. Auch wie sie, die stets mehr sein wollte als nur die größte Saloniere des Berliner Geistesadels, ihre Korrespondenz selbst einzuschätzte, gefällt Zimmermann: "Es wird eine Original-Geschichte und poetisch." Simone Weil ist eine Heiligenfigur des 20. Jahrhundert, Andre Weil, ihr Bruder, der ihr offenbar aufs Haus gleicht, ein berühmter Mathematiker. Sylvie Weil, Tochter des Andre Weil und Nichte der Philosophin, politischen Aktivistin und Mystikerin Simone Weil, gibt in ihrem Erinnerungsbuch "Andre und Simone" Einblicke in das Familienleben der Weils. Bisher hat es nur der Hanser-Lektor und Übersetzer Wolfgang Matz in der SZ besprochen. Er ist ergriffen und amüsiert zugleich: Wie es zuging zwischen diesen teils genialen, teils ziemlich lebensuntauglichen - meist waren sie beides zugleich - Verwandten, das schildere Weil mit einem erzählerischen Können und einer Pointenkraft, die so manches Romanwerk (auch das der Tante) allemal in den Schatten stelle.
Simone Weil ist eine Heiligenfigur des 20. Jahrhundert, Andre Weil, ihr Bruder, der ihr offenbar aufs Haus gleicht, ein berühmter Mathematiker. Sylvie Weil, Tochter des Andre Weil und Nichte der Philosophin, politischen Aktivistin und Mystikerin Simone Weil, gibt in ihrem Erinnerungsbuch "Andre und Simone" Einblicke in das Familienleben der Weils. Bisher hat es nur der Hanser-Lektor und Übersetzer Wolfgang Matz in der SZ besprochen. Er ist ergriffen und amüsiert zugleich: Wie es zuging zwischen diesen teils genialen, teils ziemlich lebensuntauglichen - meist waren sie beides zugleich - Verwandten, das schildere Weil mit einem erzählerischen Können und einer Pointenkraft, die so manches Romanwerk (auch das der Tante) allemal in den Schatten stelle.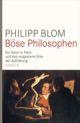 Debatten über Religion sind wahrlich nichts Neues. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es auch Philosophen, die die Welt ohne Gott erklären. Sie sind die "Bösen Philosophen", so der Titel des neuesten Buchs von Philipp Blom der an die von Voltaire und Rousseau verdrängten Radikalaufklärer Diderot und d'Holbach erinnert: Denker, die man vielleicht auch in aktuellen Debatten gebrauchen könnte. Mario Scalla erzählt in der FR glatt, dass er nach Lektüre von Bloms "anekdotenreichen und empathischen" Buch sein Bild von der Aufklärung ändern musste. Auch Manfred Geier freut sich in der SZ: über eine nicht nur gelehrte Darstellung, sondern einen Ansatz, der den beiden entspricht, wie er findet, eine Geschichte der Ideen, ihres Salons, ihrer Freund- und Feindschaften, ihrer Affären, intellektuell, sexuell. Dabei geht es dem Autor Philipp Blom laut Geier auch darum, die anhaltende Aktualität der damaligen Kämpfe um den über sich selbst aufgeklärten, von Gott- und Jenseitsglauben befreiten Menschen zu erweisen.
Debatten über Religion sind wahrlich nichts Neues. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es auch Philosophen, die die Welt ohne Gott erklären. Sie sind die "Bösen Philosophen", so der Titel des neuesten Buchs von Philipp Blom der an die von Voltaire und Rousseau verdrängten Radikalaufklärer Diderot und d'Holbach erinnert: Denker, die man vielleicht auch in aktuellen Debatten gebrauchen könnte. Mario Scalla erzählt in der FR glatt, dass er nach Lektüre von Bloms "anekdotenreichen und empathischen" Buch sein Bild von der Aufklärung ändern musste. Auch Manfred Geier freut sich in der SZ: über eine nicht nur gelehrte Darstellung, sondern einen Ansatz, der den beiden entspricht, wie er findet, eine Geschichte der Ideen, ihres Salons, ihrer Freund- und Feindschaften, ihrer Affären, intellektuell, sexuell. Dabei geht es dem Autor Philipp Blom laut Geier auch darum, die anhaltende Aktualität der damaligen Kämpfe um den über sich selbst aufgeklärten, von Gott- und Jenseitsglauben befreiten Menschen zu erweisen.
 Dies Jahr ist Hannah-Arendt-Jahr, nicht wegen eines runden Geburtstages, sondern weil sich der Eichmann-Prozess zum fünfzigsten Mal jährt. Und kaum ein Buch hat unseren Blick auf den Holocaust mehr geprägt als Arendts bis heute heftig umstrittener Bericht über den Prozess. In mehreren Büchern kann man sich diesem entscheidenden Moment der Zeitgeschichte annähern. Marie-Luise Knotts "Verlernen" nähert sich Arendt aus jahrelanger Lektüre und intimer Kenntnis von Arendts Geschichte und Werk. Und sie findet unvermutete Begriffe, um ihr Denken zu beschreiben. "Vergessen" ist einer, "Lachen" ein anderer. Wichtig ist auch, dass Knott Arendts Verhältnis zur Literatur als Erkenntnisinstrument darstellt. Thomas Meyer empfiehlt in der SZ eine ergänzende Lektüre, die neu herausgegebenen Radiogespräche Arendts mit Joachim Fest "Eichmann war von empörender Dummheit" Dieser Band bietet Meyer zufolge Gelegenheit, Hannah Arendt bei der Verfertigung ihrer Gedanken über die Schulter zu schauen. Nochmals zu empfehlen wäre auch der ebenfalls von Marie-Luise Knott herausgegebene Briefwechsel zwischen Arendt und Gerschom Scholem, in dem der Streit um den Eichmann-Prozess zum Bruch führt (Leseprobe Vorgeblättert) Und außerdem eine an dieser Stelle schon mehrfach gegebene Leseempfehlung: Nathaniel Poppers großartiger Essay "A Conscious Pariah" über Hannah Arendt und Raul Hilberg aus The Nation.
Dies Jahr ist Hannah-Arendt-Jahr, nicht wegen eines runden Geburtstages, sondern weil sich der Eichmann-Prozess zum fünfzigsten Mal jährt. Und kaum ein Buch hat unseren Blick auf den Holocaust mehr geprägt als Arendts bis heute heftig umstrittener Bericht über den Prozess. In mehreren Büchern kann man sich diesem entscheidenden Moment der Zeitgeschichte annähern. Marie-Luise Knotts "Verlernen" nähert sich Arendt aus jahrelanger Lektüre und intimer Kenntnis von Arendts Geschichte und Werk. Und sie findet unvermutete Begriffe, um ihr Denken zu beschreiben. "Vergessen" ist einer, "Lachen" ein anderer. Wichtig ist auch, dass Knott Arendts Verhältnis zur Literatur als Erkenntnisinstrument darstellt. Thomas Meyer empfiehlt in der SZ eine ergänzende Lektüre, die neu herausgegebenen Radiogespräche Arendts mit Joachim Fest "Eichmann war von empörender Dummheit" Dieser Band bietet Meyer zufolge Gelegenheit, Hannah Arendt bei der Verfertigung ihrer Gedanken über die Schulter zu schauen. Nochmals zu empfehlen wäre auch der ebenfalls von Marie-Luise Knott herausgegebene Briefwechsel zwischen Arendt und Gerschom Scholem, in dem der Streit um den Eichmann-Prozess zum Bruch führt (Leseprobe Vorgeblättert) Und außerdem eine an dieser Stelle schon mehrfach gegebene Leseempfehlung: Nathaniel Poppers großartiger Essay "A Conscious Pariah" über Hannah Arendt und Raul Hilberg aus The Nation.  So viel ist nach Lektüre von Peter Heathers Monumentalwerk "Invasion der Barbaren" klar: Die Entstehung des modernen Europas war keine friedliche Angelegenheit. Ziemlich kriegerisch vollzogen sich die Völkerwanderungen, vor allem die Goten taten sich mit ihren Plünderungszügen hervor, stets begierig nach "Metall, Vieh, urbarem Land". Sehr überzeugend findet dies Andreas Kilb in der FAZ. In der FR lobt Christian Thomas, wie Heather seine Massen an Stoff bändigt und ein Panorama des Kommens und Gehens in Europa mit all seinen Widersprüchen schafft. In der SZ ist Gustav Seibt ebenfalls sehr beeindruckt von diesem epischen Bild der wandernden Menschheit des ersten Jahrtausends.
So viel ist nach Lektüre von Peter Heathers Monumentalwerk "Invasion der Barbaren" klar: Die Entstehung des modernen Europas war keine friedliche Angelegenheit. Ziemlich kriegerisch vollzogen sich die Völkerwanderungen, vor allem die Goten taten sich mit ihren Plünderungszügen hervor, stets begierig nach "Metall, Vieh, urbarem Land". Sehr überzeugend findet dies Andreas Kilb in der FAZ. In der FR lobt Christian Thomas, wie Heather seine Massen an Stoff bändigt und ein Panorama des Kommens und Gehens in Europa mit all seinen Widersprüchen schafft. In der SZ ist Gustav Seibt ebenfalls sehr beeindruckt von diesem epischen Bild der wandernden Menschheit des ersten Jahrtausends.
 Nur auf den ersten Blick mutet Richard Cobbs "Tod in Paris" etwas bizarr an, tatsächlich feierten die Rezensenten es als "ganz wunderbares Buch". Der britische Historiker hat die Akten des Pariser Leichenschauhauses aus den Jahren 1795 bis 1801 gesichtet und daraus eine Art Sozialgeschichte der Selbstmörder und armen Schlucker destilliert - und eine "Alltagsgeschichte der Revolutionszeit", wie sich Tania Martini in der taz freut. In der FAZ empfiehlt Jochen Schimmang wärmstens diesen Autor, der ein ähnliches Gespür für Namenlose und Archive habe wie Michel Foucault, dabei aber noch besser erzähle, nicht so kalt, emphatischer (Hier unser "Vorgeblättert"). Sehr empfehlen konnte in der Zeit Elisabeth von Thadden auch Fritz Sterns Band "Moderne Historiker" der klassische Texte der großen Historiker von Voltaire über Michelet und Macauly bis Theodor Mommsen versammelt und selbst schon zu einem Klassiker geworden ist. Für die neue Ausgabe hat Stern den Band mit Jürgen Osterhammel neu zusammengestellt und um universalgeschichtliche Ansätze erweitert.
Nur auf den ersten Blick mutet Richard Cobbs "Tod in Paris" etwas bizarr an, tatsächlich feierten die Rezensenten es als "ganz wunderbares Buch". Der britische Historiker hat die Akten des Pariser Leichenschauhauses aus den Jahren 1795 bis 1801 gesichtet und daraus eine Art Sozialgeschichte der Selbstmörder und armen Schlucker destilliert - und eine "Alltagsgeschichte der Revolutionszeit", wie sich Tania Martini in der taz freut. In der FAZ empfiehlt Jochen Schimmang wärmstens diesen Autor, der ein ähnliches Gespür für Namenlose und Archive habe wie Michel Foucault, dabei aber noch besser erzähle, nicht so kalt, emphatischer (Hier unser "Vorgeblättert"). Sehr empfehlen konnte in der Zeit Elisabeth von Thadden auch Fritz Sterns Band "Moderne Historiker" der klassische Texte der großen Historiker von Voltaire über Michelet und Macauly bis Theodor Mommsen versammelt und selbst schon zu einem Klassiker geworden ist. Für die neue Ausgabe hat Stern den Band mit Jürgen Osterhammel neu zusammengestellt und um universalgeschichtliche Ansätze erweitert. Der Band "Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel" enthält Reden und Schriften zur Literatur, die Herta Müller zu unterschiedlichsten Anlässen verfasst hat. Sie erinnert sich darin an ihre Kindheit und Jugend, gibt Auskunft über ihre poetische Verfahren und setzt sich mit den politischen Realitäten in Rumänien und Deutschland auseinander. In der FR zeigt sich Jürgen Verdofsky besonders beeindruckt von ihrer versöhnlichen Sicht auf Oskar Pastior, dessen erzwungenen Arbeit für die Securitate bekannt wurde, nachdem sie für das Buch über seine Lagerhaft "Atemschaukel" den Nobelpreis erhalten hat. In der SZ preist Gustav Seibt diese Essays als Türöffner zu Herta Müllers Werk und entnimmt ihnen sehr eindrücklich, wie alternativlos eine vollständige Aufklärung der diktatorischen Geheimdienstaktivitäten ist. In der FAZ lernt Friedmar Apel, Wahrheit in der Sprache zu entdecken.
Der Band "Immer derselbe Schnee und immer derselbe Onkel" enthält Reden und Schriften zur Literatur, die Herta Müller zu unterschiedlichsten Anlässen verfasst hat. Sie erinnert sich darin an ihre Kindheit und Jugend, gibt Auskunft über ihre poetische Verfahren und setzt sich mit den politischen Realitäten in Rumänien und Deutschland auseinander. In der FR zeigt sich Jürgen Verdofsky besonders beeindruckt von ihrer versöhnlichen Sicht auf Oskar Pastior, dessen erzwungenen Arbeit für die Securitate bekannt wurde, nachdem sie für das Buch über seine Lagerhaft "Atemschaukel" den Nobelpreis erhalten hat. In der SZ preist Gustav Seibt diese Essays als Türöffner zu Herta Müllers Werk und entnimmt ihnen sehr eindrücklich, wie alternativlos eine vollständige Aufklärung der diktatorischen Geheimdienstaktivitäten ist. In der FAZ lernt Friedmar Apel, Wahrheit in der Sprache zu entdecken. Ist der Literatur die Wirklichkeit abhanden gekommen? Gleich zwei Bücher fordern von der zeitgenössischen Literatur mehr Realität und mehr Gegenwart, wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln. Richard Kämmerlings liefert mit "Das kurze Glück der Gegenwart" einen Überblick über die deutschsprachige Literatur der vergangenen 20 Jahre, und seine Kritikerkollegen haben dies ausgesprochen positiv aufgenommen, obwohl sie durchaus nicht immer mit Auswahl und Gewichtung des Kämmerlings'schen Kanons einverstanden sind: Sein oberstes Kriterium ist das Versprechen auf Gegenwartserkenntnis, und zwar eine, die schmerzt. Anhand verschiedener Kategorien - Krieg, Sex, Berlin - klopft er die wichtigsten Romane auf ihre Gegenwartstauglichkeit ab und macht kurzen Prozess mit denen, die sich in die Vergangenheit flüchten. In der taz findet Dirk Knipphals selbst die Schwächen des Buchs noch sehr anregend, in der SZ äußert sich Ina Hartwig sehr lobend, in der Zeit bedankt sich Iris Radisch dafür, so kompakt an all die Literaturdebatten der vergangenen Jahre erinnert worden zu sein. Und in der FAZ erklärt Kolja Mensing, auch einiges über die Aufgabe des Kritikers gelernt zu haben.
Ist der Literatur die Wirklichkeit abhanden gekommen? Gleich zwei Bücher fordern von der zeitgenössischen Literatur mehr Realität und mehr Gegenwart, wenn auch mit unterschiedlichen Mitteln. Richard Kämmerlings liefert mit "Das kurze Glück der Gegenwart" einen Überblick über die deutschsprachige Literatur der vergangenen 20 Jahre, und seine Kritikerkollegen haben dies ausgesprochen positiv aufgenommen, obwohl sie durchaus nicht immer mit Auswahl und Gewichtung des Kämmerlings'schen Kanons einverstanden sind: Sein oberstes Kriterium ist das Versprechen auf Gegenwartserkenntnis, und zwar eine, die schmerzt. Anhand verschiedener Kategorien - Krieg, Sex, Berlin - klopft er die wichtigsten Romane auf ihre Gegenwartstauglichkeit ab und macht kurzen Prozess mit denen, die sich in die Vergangenheit flüchten. In der taz findet Dirk Knipphals selbst die Schwächen des Buchs noch sehr anregend, in der SZ äußert sich Ina Hartwig sehr lobend, in der Zeit bedankt sich Iris Radisch dafür, so kompakt an all die Literaturdebatten der vergangenen Jahre erinnert worden zu sein. Und in der FAZ erklärt Kolja Mensing, auch einiges über die Aufgabe des Kritikers gelernt zu haben.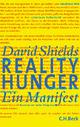 Der amerikanische Autor David Shields legt mit "Reality Hunger" ein - nur aus Zitaten zusammengestelltes - Manifest vor, das die Fiktion für obsolet erklärt und aus dem Geist des HipHops durch Imitat, Plagiat und Kompilat den Klang der Wirklichkeit in die Literatur bringen will. (Hier unser Vorgeblättert). In den USA war das Buch sehr schnell sehr hip. Hierzulande wurde es verhaltener aufgenommen. In der SZ ist allerdings Jens-Christian Rabe begeistert, Skepsis dagegen bei Dirk Pilz in der FR, und in der NZZ wirft Felix Philipp Ingold die Frage auf: Hatten die da drüben keine Postmoderne?
Der amerikanische Autor David Shields legt mit "Reality Hunger" ein - nur aus Zitaten zusammengestelltes - Manifest vor, das die Fiktion für obsolet erklärt und aus dem Geist des HipHops durch Imitat, Plagiat und Kompilat den Klang der Wirklichkeit in die Literatur bringen will. (Hier unser Vorgeblättert). In den USA war das Buch sehr schnell sehr hip. Hierzulande wurde es verhaltener aufgenommen. In der SZ ist allerdings Jens-Christian Rabe begeistert, Skepsis dagegen bei Dirk Pilz in der FR, und in der NZZ wirft Felix Philipp Ingold die Frage auf: Hatten die da drüben keine Postmoderne? Nur ein kleiner Schlenker, und doch eine Reise in ein unbekanntes Russland: Mit Begeisterung hat Volker Hagedorn in Uli Hufens Buch "Das Regime und die Dandys" über eine im Westen völlig unbekannte Subkultur gelesen: Lieder über Gangster und Dirnen, jenes Milieu also, das zwischen Gorbatschow und Putin nach oben schwappte, aber offenbar auch in der alten Sowjetunion schon auf das munterste existierte. Es gibt Kontinuitäten, von denen man gar nichts ahnte! Und ein Musikland, von dem man nicht wusste, dass man sich danach sehnen kann.
Nur ein kleiner Schlenker, und doch eine Reise in ein unbekanntes Russland: Mit Begeisterung hat Volker Hagedorn in Uli Hufens Buch "Das Regime und die Dandys" über eine im Westen völlig unbekannte Subkultur gelesen: Lieder über Gangster und Dirnen, jenes Milieu also, das zwischen Gorbatschow und Putin nach oben schwappte, aber offenbar auch in der alten Sowjetunion schon auf das munterste existierte. Es gibt Kontinuitäten, von denen man gar nichts ahnte! Und ein Musikland, von dem man nicht wusste, dass man sich danach sehnen kann. Douglas Couplands Buch "Marshall McLuhan" über einen der Mitbegründer der modernen Medientheorie, dessen Formeln vom "Medium als der Botschaft" und "globalen Dorf" heute zu den am weitesten verbreiten Denkmustern über Medien gehören, ist weniger eine Biografie als ein literarisch-biografischer Essay über die Bedingungen des Erkennens: Wie kommt es, dass ein konservativer und frommer Mann, der ausgerechnet in Winnipeg, Manitoba, aufwuchs, als erster das Rüstzeug hatte, das revolutionäre Potenzial der Medien zu erkennen? Doris Akrap in der taz erscheinen die Hypothesen, die Coupland hierzu entwickelt, durchaus aufschlussreich: So hat sie bei der Lektüre etwa erfahren, dass McLuhan die Entwicklung der Kommunikationstechnologie insgesamt keineswegs begrüßte, dass er ein "Meister der Mustererkennung" (Coupland) war, ein enges Verhältnis zu seiner Mutter hatte und welche Rolle die Anomalien in McLuhans Gehirn spielte.
Douglas Couplands Buch "Marshall McLuhan" über einen der Mitbegründer der modernen Medientheorie, dessen Formeln vom "Medium als der Botschaft" und "globalen Dorf" heute zu den am weitesten verbreiten Denkmustern über Medien gehören, ist weniger eine Biografie als ein literarisch-biografischer Essay über die Bedingungen des Erkennens: Wie kommt es, dass ein konservativer und frommer Mann, der ausgerechnet in Winnipeg, Manitoba, aufwuchs, als erster das Rüstzeug hatte, das revolutionäre Potenzial der Medien zu erkennen? Doris Akrap in der taz erscheinen die Hypothesen, die Coupland hierzu entwickelt, durchaus aufschlussreich: So hat sie bei der Lektüre etwa erfahren, dass McLuhan die Entwicklung der Kommunikationstechnologie insgesamt keineswegs begrüßte, dass er ein "Meister der Mustererkennung" (Coupland) war, ein enges Verhältnis zu seiner Mutter hatte und welche Rolle die Anomalien in McLuhans Gehirn spielte. Höchst erregt tobte die Debatte um Pädophilie im letzten Jahr. Im Vordergrund stand die Katholische Kirche. Aber es gab auch einen anderen, sozusagen protestantischen Aspekt an der Sache: die Reformpädagogik, und hier ganz besonders die Odenwaldschule, an der die halbe Elite der alten Bundesrepublik ausgebildet wurde. Christian Füller hat für sein Buch "Der Sündenfall" zum Pädophilie-Skandal an dieser Schule recherchiert. Dass der taz-Journalist mit seiner Nachlese zum "System Odenwaldschule" bis heute unbeantwortete Fragen, so die nach einem etwaigen ursächlichen Zusammenhang von Reformpädagogik und Pädokriminalität, eindringlich stellt, hält Jörg Schindler in der FR für höchst anerkennenswert. Gunter Hofmann in der Zeit sträubt sich etwas dagegen: Das liegt womöglich daran, dass der Reformpädagoge Hartmut von Hentig, der Lebensgefährte des Odenwaldchefs Gerold Becker, ein Liebling der Zeit und besonders der honorigen Gräfin Dönhoff war. Hofmann wehrt sich gegen den Vorwurf eines Elitenetzwerks - das aber übrigens auch in einem ganz anderen Buch thematisiert wird: in Ulrich Raulffs höchst lesenswerter Studie "Kreis ohne Meister" über das Nachleben des Kreises um Stefan George, der Pädophilie zum politischen Prinzip erhob und mit dem auch die Odenwaldschule verknüpft ist.
Höchst erregt tobte die Debatte um Pädophilie im letzten Jahr. Im Vordergrund stand die Katholische Kirche. Aber es gab auch einen anderen, sozusagen protestantischen Aspekt an der Sache: die Reformpädagogik, und hier ganz besonders die Odenwaldschule, an der die halbe Elite der alten Bundesrepublik ausgebildet wurde. Christian Füller hat für sein Buch "Der Sündenfall" zum Pädophilie-Skandal an dieser Schule recherchiert. Dass der taz-Journalist mit seiner Nachlese zum "System Odenwaldschule" bis heute unbeantwortete Fragen, so die nach einem etwaigen ursächlichen Zusammenhang von Reformpädagogik und Pädokriminalität, eindringlich stellt, hält Jörg Schindler in der FR für höchst anerkennenswert. Gunter Hofmann in der Zeit sträubt sich etwas dagegen: Das liegt womöglich daran, dass der Reformpädagoge Hartmut von Hentig, der Lebensgefährte des Odenwaldchefs Gerold Becker, ein Liebling der Zeit und besonders der honorigen Gräfin Dönhoff war. Hofmann wehrt sich gegen den Vorwurf eines Elitenetzwerks - das aber übrigens auch in einem ganz anderen Buch thematisiert wird: in Ulrich Raulffs höchst lesenswerter Studie "Kreis ohne Meister" über das Nachleben des Kreises um Stefan George, der Pädophilie zum politischen Prinzip erhob und mit dem auch die Odenwaldschule verknüpft ist.
 Zwei Bücher sind anzuzeigen aus dem weiten Feld der Gender Politik, die von sich reden machten: Hannelore Schlaffers "Die intellektuelle Ehe" ist einer Form des Zusammenlebens gewidmet, das "einem eigenen, rational begründbaren Entwurf" folgt und immer wieder neu austariert wird, so Christine Pries in der FR. Schlaffers Hauptbeispiele - Marianne und Max Weber, Sartre und Beauvoir, Zelda und Scott Fitzgerald - zeigen allerdings, dass diese Form oft auf Kosten der Erotik ging, stellt leicht betrübt die Rezensentin fest, die das Buch sehr anregend fand. Für den Zeit-Rezensenten Adam Soboczynski steht nach der Lektüre eindeutig fest: Die intellektuelle Ehe ist gescheitert. Bascha Mikas feministische Frauenkritik "Die Feigheit der Frauen" wurde in der SZ als Debattenbeitrag begrüßt, in den anderen Zeitungen hingegen so vehement abgelehnt, dass man annehmen kann: Sie hat wohl einen Nerv getroffen.
Zwei Bücher sind anzuzeigen aus dem weiten Feld der Gender Politik, die von sich reden machten: Hannelore Schlaffers "Die intellektuelle Ehe" ist einer Form des Zusammenlebens gewidmet, das "einem eigenen, rational begründbaren Entwurf" folgt und immer wieder neu austariert wird, so Christine Pries in der FR. Schlaffers Hauptbeispiele - Marianne und Max Weber, Sartre und Beauvoir, Zelda und Scott Fitzgerald - zeigen allerdings, dass diese Form oft auf Kosten der Erotik ging, stellt leicht betrübt die Rezensentin fest, die das Buch sehr anregend fand. Für den Zeit-Rezensenten Adam Soboczynski steht nach der Lektüre eindeutig fest: Die intellektuelle Ehe ist gescheitert. Bascha Mikas feministische Frauenkritik "Die Feigheit der Frauen" wurde in der SZ als Debattenbeitrag begrüßt, in den anderen Zeitungen hingegen so vehement abgelehnt, dass man annehmen kann: Sie hat wohl einen Nerv getroffen.
 Ökologie ist das Gebot der Stunde, da kommt Joachim Radkau mit seiner Geschichte der Umweltbewegung "Die Ära der Ökologie" genau zur richtigen Zeit. Laut Radkau nimmt das ökologische Denken zwar seine ersten Anfänge mit der Aufklärung, schlägt aber erst mit der "kopernikanischen Wende rückwärts" durch: als in den sechziger Jahren mit den aus dem Weltraum geschickten Nasa-Bildern die Erde wieder in den Mittelpunkt unseres Weltbild rückte. In der Zeit lobt Dirk van Laak den Autor als "beschlagenen wie unabhängigen" Geist, der nicht immer stringent, aber sehr originell erzählen kann. In der FAZ findet Joachim Müller-Jung diese Ökologie-Geschichte nur zu Beginn etwas jargonlastig, dann aber sehr aufschlussreich und informativ. In der taz hätte sich Felix Ekardt gewünscht, dass Radkau auch die sozialen und mentalen Ursachen der Umweltzerstörung untersucht. Bereits mehrfach hingewiesen haben wir auf Karen Duves vielfach gelobten und sehr einschlägigen Selbstversuch "Anständig essen" in dem sie sich unter zunehmend schärferen Bedingungen um eine ethische Ernährung bemüht.
Ökologie ist das Gebot der Stunde, da kommt Joachim Radkau mit seiner Geschichte der Umweltbewegung "Die Ära der Ökologie" genau zur richtigen Zeit. Laut Radkau nimmt das ökologische Denken zwar seine ersten Anfänge mit der Aufklärung, schlägt aber erst mit der "kopernikanischen Wende rückwärts" durch: als in den sechziger Jahren mit den aus dem Weltraum geschickten Nasa-Bildern die Erde wieder in den Mittelpunkt unseres Weltbild rückte. In der Zeit lobt Dirk van Laak den Autor als "beschlagenen wie unabhängigen" Geist, der nicht immer stringent, aber sehr originell erzählen kann. In der FAZ findet Joachim Müller-Jung diese Ökologie-Geschichte nur zu Beginn etwas jargonlastig, dann aber sehr aufschlussreich und informativ. In der taz hätte sich Felix Ekardt gewünscht, dass Radkau auch die sozialen und mentalen Ursachen der Umweltzerstörung untersucht. Bereits mehrfach hingewiesen haben wir auf Karen Duves vielfach gelobten und sehr einschlägigen Selbstversuch "Anständig essen" in dem sie sich unter zunehmend schärferen Bedingungen um eine ethische Ernährung bemüht.