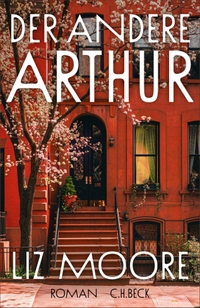Im Kino
Kontrollkapitalistisches Wunderland
Die Filmkolumne. Von Katrin Doerksen, Lukas Foerster
18.07.2019. Cyril Schäublins "Dene wos guet geit"ist ein filmischer Essay über labyrinthisch erkalteten Wohlstandsurbanismus und zugleich ein entschleunigter Thriller über eine junge Frau, die alte Frauen per Enkelinnentrick übers Ohr haut. Jon Favreau hat mit modernsten Mitteln einen altmodischen und behäbigen "König der Löwen" gefilmt, der so vorhersehbar und kuschelig ist wie das Original experimentell war.
Das erste Bild nach der Titelsequenz zeigt eine Mülltonne im öffentlichen Raum. Glänzendes, geschwungenes Metall, oben eine dunkle Öffnung. Ein Objekt des urbanen Alltags, das aus dem Zusammenhang des Alltäglichen herausgerissen wird, durch die Länge der Einstellung und auch durch die Nähe der Kamera zum Objekt. Isoliert von der Umgebung, in die sie eingebettet ist, bevor das Kino sie fand, wird die Mülltonne zu einem unbekannten, vielleicht gar außerirdischen Wesen, und die Öffnung zu einem Schlund, der potentiell alles, die gesamte Welt verschlingen kann.
Es gibt eine Reihe ähnlicher Einstellungen im Film: leinwandfüllende Ampel-Kästchen, elektronische Türöffner, Ausgabeschlitze von Bankautomaten. Schnittstellen zwischen Mensch und Stadt, die alle etwas Unheimliches bekommen, wenn man sie nur lang und genau genug beobachtet: Was öffnet sich da vor uns, womit kommunizieren wir, wenn wir unsere Chipkarten wieder und wieder an plane Kunststoffflächen drücken? Insgesamt ist Cyril Schäublins Featuredebüt "Dene wos guet geit" allerdings kein Film der Großaufnahmen. Viel häufiger ist die Kamera recht weit weg vom Geschehen, oft kleben die Figuren, oder nur ihre Köpfe, am unteren Bildrand, über ihnen dräuen, raumgreifend, anonyme und teils komplett fensterlose Häuserfronten. Ähnlich wie in James Bennings "11 x 14" ist die Perspektive häufig so gewählt, dass im Vordergrund gelegentlich Autos vorbeihuschen, über Straßen, die selbst nicht im Bild sind. Es liegt nahe, den auch auf der Tonspur allgegenwärtigen Verkehrsfluss als eine metonymische Verschiebung der nimmermüden virtualisierten Geldströme zu deuten, die Zürich, die Stadt, in der "Dene wos guet geit" und gedreht wurde, noch ein bisschen fester im Griff haben als den Rest der Welt.
Weil es ihnen nie darum geht, ein Verhältnis von Details zum Ganzem und damit einen kontinuierlichen Erzählraum zu etablieren, werden selbst die weitesten Einstellungen nicht zu Establishing Shots. Wenn wir in Panoramaaufnahmen sehen, wie die stets posh zurechtgemachte Hauptfigur Alice sich durch teils komplex organisierte Systeme von Fußgängerwegen, Straßenübergangen und Treppen bewegt, dann betrachten wir keine (jenseits des Bildkaders sich fortsetzende) Welt, sondern lediglich eine Serie von Parkours. Während Autofahrten wiederum wird die ansonsten seelenruhig statische Kamera in eine unruhige, fahrige Bewegung versetzt. Keine zielgerichteten Transfers von A nach B, sondern willkürliche Verschiebungen in einem chaotischen und doch reibungslos vor sich hin schnurrenden System.

Zwei fiktive Unternehmen treiben in dem Film ihr Unwesen: eine Versicherungsanstalt namens Dezentra und der Mobilfunkanbieter Everywhere Schweiz. Ein dezentriertes Überall - das ist nicht nur eine Beschreibung der gegenwärtigen Schweiz, sondern auch eine Selbstbeschreibung des Films, seiner Bildpraxis, die touristische oder andere eindeutig identifizierbare Markierungen meidet wie der Teufel das Weihwasser und stattdessen das Austauschbare, Modularisierte an moderner Architektur und Stadtplanung in den Blick nimmt.
"Dene wos guet geit" ist nicht nur ein filmischer Essay über labyrinthisch erkalteten Wohlstandsurbanismus, sondern auch ein entschleunigter, prozessual organisierter Thriller, der freilich ebenso selbstreflexiv konstruiert ist (und nicht nur darin, freilich stets nur von fern, an Corneliu Porumboius "Police, Adjective" erinnert). Das beginnt damit, dass Alice, wenn sie alte Frauen per einschlägigem Enkel_innentrick um ihre Ersparnisse bringt, im kriminellen Privatleben nur das fortsetzt, was sie im nichtkriminellen Berufsleben tagtäglich tut: Sie ist Mitarbeiterin eines Callcenters und zieht auf der Arbeit, im Auftrag der oben genannten oder ähnlicher Unternehmen, deren Kund_innen alle möglichen privaten Informationen, am liebsten den Kontostand betreffend, aus der Nase. Das Übergriffige am Enkeltrick ist keine Ausnahme, sondern die Regel in der Welt von "Dene wos guet geit" (eine Welt, die die unsere ist und doch noch nicht ganz; es weht, davon künden nicht nur die unheimlichen Mülltonnen, ein fast schon gnädig zu nennender Hauch Science Fiction durch die Bilder). In den naturalistisch sich anfühlenden Dialogen, die einen Großteil der Filmlaufzeit einnehmen, geht es immer wieder um die Abfrage und Weitergabe von Passwörtern, penetrante Nachfragen bezüglich höchstpersönlicher Angelegenheiten sind genauso allgegenwärtig, gelegentlich rückt Schäublin, manchmal etwas arg aufdringlich unaufdringlich im Bildhintergrund, direkt erkennungsdienstliche Maßnahmen ins Bild.
Im Prolog wiederum unterhalten sich drei später im Film nicht mehr auftauchende Figuren über Alices Vergehen, fragen sich dann allerdings, ob sie das Ganze nicht mit einem Film verwechseln, der ebenfalls von betrogenen alten Frauen handelt. Das wird zu einem Leitmotiv: Immer wieder fragt eine Figur eine andere, ob sie nicht auch diesen Film gesehen habe, dessen Titel ihr gerade entfallen sei... in dem es aber um fast dieselbe Situation geht, in der sie sich beide gerade befinden. Im der lustigsten Szene des Films bahnt sich auf diese Weise um ein Haar eine Liebesgeschichte zwischen zwei Polizisten an.
Schäublin packt viel in die schlanken 71 Minuten Laufzeit von "Dene wos guet geit". Dass der Film sich, fast durchweg, weder überfrachtet noch überkonstruiert anfühlt, sondern einen entspannt synkopischen Rhythmus entwickelt, ist ein kleines Wunder, das einiges mit der Hauptdarstellerin zu tun haben dürfte. Sarah Stauffer, wie der Rest des Casts keine professionelle Darstellerin, hat mit ihrem blassen, opaken Gesicht und den blutrot geschminkten Lippen etwas von einer Märchenfigur: Alice im kontrollkapitalistischen Wunderland.
Lukas Foerster
Dene wos guet geit - Schweiz 2017 - Regie: Cyril Schäublin - Darsteller: Sarah Stauffer, Nikolai Bosshardt, Fidel Morf - Laufzeit: 71 Minuten.
---

Jon Favreaus Neuverfilmung des Disney-Zeichentrickklassikers "Der König der Löwen" ist ein durch und durch originalgetreues Remake. Teils Einstellung für Einstellung, Dialogzeile für Zeile, vom ersten Afrikakitschbild der Silhouette eines Affenbrotbaums vor glühend rotem Himmel bis zum finalen Schließen des circle of life. "Lauf fort und kehre nie wieder zurück", droht der machthungrige Löwe Scar (im Original gesprochen von Chiwetel Ejiofor) seinem Neffen Simba (Donald Glover), bevor er die Hyänen auf ihn hetzt. Am Ende wendet Simba diese Drohung gegen den Onkel, der kurz darauf im Kampf vom Felsen stürzt, ebenfalls den hungrigen Hyänen vor die Füße. Abgeschnitten sein von der Heimat, von den eigenen Wurzeln im Sinne der von familiärer Abstammung bestimmten Zugehörigkeit zu einem klar begrenzten Ort, ist in der Logik des Films eine der drakonischsten Strafen, beinahe so endgültig wie der Tod. Eigentlich ist das eine ziemlich altmodische Ansicht.
Wie so manches in "Der König der Löwen". Der seiner Heimat verwiesene Junglöwe darf nur bei seinen neuen Freunden Timon (Billy Eichner) und Pumba (Seth Rogen) bleiben, wenn er im Tal keine anderen Tiere frisst. Gut gelaunt singend machen sich die drei aber über bunt leuchtende Insekten her. Das war genau genommen schon 1994 heuchlerisch und ist es heute nicht weniger. Jon Favreaus wenige Änderungen gegenüber dem Original beschränken sich auf die Reizthemen der Zielgruppe. Drag und cultural appropriation, doppelt vermintes Gebiet: Timons Tanz im Hularöckchen fällt im neuen "Der König der Löwen" aus.
Wie doppelt unterstrichen wirken die wenigen Szenen, die vom Original abweichen, denn indem Disney die Emotionen, die nostalgischen Erinnerungen der Fans mit aktuellen popkulturellen Stichworten verknüpft, überhöht (und monetarisiert) es die eigene Marke mithilfe des Prinzips eines simplen Belohnungssystems. Vor dramatischem Nachthimmel erscheint Simba dessen verstorbener Vater Mufasa (wie im Original synchronisiert von James Earl Jones) und löst endlich den Wendepunkt aus. Simba rennt seiner Heimat entgegen und die Sonne geht zu den Klängen von Beyoncés neuer Single auf. Das erst vor einigen Tagen unangekündigt und dafür umso publikumswirksamer online veröffentlichte Lied ist der cue. Ähnlich funktioniert die Stimme von Jones oder die von John Oliver, der in seiner Rolle als nervöser Aristokratenvogel Zazu exakt so klingt wie seine Persona aus "Last Week Tonight". Wer alle Anspielungen versteht, löst umso lieber die Kinokarte.

Die altmodischen Untertöne der Geschichte, wie behäbig die Kamera in "Der König der Löwen" den Blick lenkt, all das steht im direkten Kontrast zur hochmodernen Technologie, die den Film als Live-Action ausgibt. Gedreht wurde, das ist in diesem Ausmaß neu, in einer kompletten Virtual-Reality-Umgebung, mit VR-Brillen und Kamera-Attrappen in einem leeren Studio. Die Qualität der Animationen ist erstaunlich, von den geschmeidigen Bewegungen der Tiere bis hin zu den fotorealistisch anmutenden Großaufnahmen, in denen die Farbverläufe in jedem einzelnen Haar deutlich zu erkennen sind. Wie Favreau die Animationen auf den Präsentierteller stellt, wirkt umso ungewohnter, als wir es gewöhnt sind, CGI irgendwo verschwommen hinter Nebel, Regenschwaden und dunklen Schatten auszumachen.
Diese Verpflichtung gegenüber dem realistischen Anschein macht "Der König der Löwen" zum unterhaltsamen Spektakel, erweist sich aber auch als Fallstrick. Denn der Film besteht nicht nur aus Kintopp, aus Detailaufnahmen von flauschigem Fell, farbintensiven Sonnenuntergängen und Timelapse-Aufnahmen des Sternenhimmels. Leider, muss man sagen, denn jeder Hauch des auch jenseits der innovativen Produktionsgeschichte Ungewöhnlichen wäre willkommen gewesen. Das Experimentelle war es ja gerade, das Roger Allers' und Rob Minkoffs Film von 1994 besonders machte. Die Freiheit des Zeichentricks, der Abstraktion. Wenn darin die Tiere zu Simbas Lied "I just can't wait to be King" gemeinsam in Tanz und Gesang ausbrachen, erinnerte das an die Musicalchoreografien von Busby Berkeley vor tropisch buntem Hintergrund, dutzende kleine Siege über die Schwerkraft ebenso wie über die Langeweile. Im aktuellen "Der König der Löwen" sehen wir lediglich zwei schwer voneinander unterscheidbare Löwenbabies vor einer farblich eintönigen Savannenkulisse. Die Kamera begibt sich zu ihnen auf Augenhöhe, folgt Simba und Nala, die sich unter andere Jungtiere mischen, die den ausgewachsenen Tieren zwischen den Beinen hindurch preschen, die über Wiesen kugeln. Das Spektakel dieser Szenen ist nur noch ihre Niedlichkeit.
Katrin Doerksen
The Lion King - USA 2019 - Regie: Jon Favreau - Laufzeit: 118 Minuten.
Kommentieren