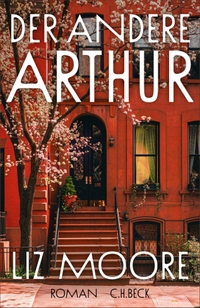Im Kino
Kanal für die Perversionen
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Patrick Holzapfel
11.10.2017. Womöglich ein letztes Mal nimmt Michael Haneke in "Happy End" eine Mittelschichtsfamilie auseinander. Dabei sorgt er für ungewohnte Lacher, trotz der Verderbtheit seiner Figuren. Na Hong-jin erweist sich mit "The Wailing" als ein begnadeter Stimmungsmaler Ton in Ton.
Da ist er wieder, der mit dem Finger auf die problematische menschliche Moral deutende Präzisionsarbeiter Michael Haneke. "Happy End" heißt sein neuestes Werk, es könnte dem fast spöttischen Titel nach sein letztes sein. Man vergisst leicht, wie sich ein Haneke-Film wirklich anfühlt, weil man während eines Filmjahres mit sehr vielen Nachahmern konfrontiert wird. Natürlich bemerkt man, dass das Original immer noch am besten ist. Was nicht zwingend heißt, dass "Happy End" ein guter Film ist.
Es sind mal wieder die Bruchstellen des Großbürgertums, die der österreichische Oscarpreisträger seziert. Dabei geht er bisweilen deutlich schärfer und weniger subtil vor als man es von ihm kennt, was manche Szenen an den Rand des Komödiantischen treibt. In einer Art Familienportrait arbeitet der Filmemacher unterschiedliche Überlebensstrategien einer dem Untergang geweihten Klasse heraus. Das mit dem "Überleben" ist allerdings nicht wörtlich zu nehmen, denn insbesondere der alte Georges Laurent (Jean-Louis Trintignant) möchte nur noch sterben. Er versucht es mit seinem Friseur, mit einem Auto oder im Wasser. So ganz gelingen will es ihm nicht. Das ganze wirkt gelegentlich wie eine nicht ganz ironische, nicht ganz ernste Fortsetzung von oder zumindest Variation auf den Vorgänger "Amour".
Georges ist das Oberhaupt einer in Calais ansässigen Familie, die ein Bauunternehmen besitzt und unter Druck gerät, als es auf einer Baustelle zu einem tragischen Unfall kommt. Allerdings interessiert sich Haneke genauso wenig für die Tragik des Ganzen wie die Familie für den Unfall. Der Druck kommt von anderswo. Er ist in die soziopathische Familie und ihre Struktur eingeschrieben. Dramaturgisch ist der Film ein abgeschottetes Familienportrait, dessen Bewegungen hin zu einem unmöglichen Ende führen.
Man bekommt Lust, es dem Regisseur gleichzutun und den kryptischen Bewegungen hin zu einer Unmenschlichkeit durch die verschiedenen Familienmitglieder zu folgen. Da wäre zum Beispiel Georges Laurents Tochter Anne, gespielt in vernichtend effizienter Abgeneigtheit von Isabelle Huppert, deren Präsenz im Film unter anderem an Paul Verhoevens "Elle" erinnert, einem anderen Stück zeitgenössischen Kinos, in dem man Sympathie nicht mal mit der Lupe finden kann. Beide Filme eint die Zuspitzung dieser Weltsicht, die zumindest bei Haneke für ungewohnte Lacher sorgen kann. Anne leitet den Betrieb, hält alles am Laufen und am Leben. Ihr Sohn Pierre (Franz Rogowski) zerbricht unter Depressionen und hysterischen Ausbruchsversuchen. Georges Sohn Thomas, ein nur scheinbar angepasster Mann, gespielt von Matthieu Kassovitz, lebt an seiner Ehe vorbei und hegt heimlich dunkle Fantasien.
Und natürlich hat Haneke noch ein Kind im Ärmel, es ist die Tochter von Thomas: Eve gespielt von Fantine Harduin. Wie man das von Haneke kennt, erfahren wir nicht vollends, wie krank dieses Mädchen wirklich ist und was sie mit dem Krankenhausaufenthalt ihrer Mutter, der Ex-Frau von Thomas zu tun hat. Was wir sehen ist, dass auch sie die soziopathische Veranlagung ihrer Familie übernommen hat und sich völlig in die digitale Welt ihres Smartphones zurückzieht. Haneke überlässt den Zusehern wie gewohnt die Schlussfolgerungen und Urteile. Zumindest tut er so als ob, denn wenn man es genau nimmt, arbeitet sein Kino mit präziser Manipulation, die keine Fragen offen lässt. Die Frage ist nicht, ob dieses Mädchen ein Verbrechen begangen hat oder nicht. Vielmehr will Haneke erzählen, wie kaputt diese Welt ist. Und daran lässt er keinen Zweifel.

Das mit Ausnahme der Tochter, die den naturalistischen Schauspielstil ihrer Kollegen nicht ganz übernimmt, durchweg groß aufspielende Ensemble macht "Happy End" zu einem Schauspielerfilm. Es ist ein wenig wie bei Woody Allen, nur dass keine Versionen von Woody Allen dargestellt werden, sondern Variationen menschlicher Abgründe. Diese hängen - und da muss man dem Altmeister keineswegs folgen - auch an den Neuen Medien. Man kann sich nicht ganz der Wahrnehmung entziehen, dass hier ein älterer Mann einen Teufel an die Wand malen will und klar formuliert, dass die neuen Kommunikationsformen uns pervertieren. Zumindest geben sie den Perversionen einen Kanal. Dabei erfindet Haneke ganz nebenbei eine interessante Mischung aus Live-Chat und Video, die er so auch als Pitch an Facebook und Konsorten schicken könnte.
Wie vieles in Hanekes jüngeren Filmen ist das etwas einfach gestrickt. Denn sämtliche Verwendungen von Neuen Medien im Film sind pervertiert. Das Gegenteil kommt nicht vor. Es beginnt mit der Art und Weise, wie Anne, an ihr Handy geschweißt, agiert, und geht weiter mit Drohungen, gefährlicher Abschottung, pervertierten Sexualtrieben. In den Fragmenten, in denen man damit konfrontiert wird, dients das vor allem einem Spannungsaufbau. Blickt man zum Beispiel auf einen Filmemacher wie Cristi Puiu, der in "Sieranevada" gar nicht so unähnliche Themen verhandelt, spürt man ein deutlich größeres Bemühen um Ambivalenz und Offenheit. Hanekes Welt ist geschlossen und in ihrer Selbstreferentalität inzwischen zu routiniert. Genau deshalb wirken seine Filme häufig so, als wäre er der Lehrer seiner Zuseher. Man muss gerne Schüler sein, um das zu mögen.
Das bedeutet allerdings nicht, dass Haneke selbst nicht ständig auf der Suche wäre. Er präsentiert keine statischen Wahrheiten, sondern macht Filme über Dinge, mit denen in seinen Augen etwas nicht stimmt. Sein Kino ist in dieser Hinsicht nach wie vor nicht versöhnt mit der Welt. Versöhnt ist es nur mit dem eigenen Blick auf sie. Das zeigt sich zum Beispiel darin, wie das titelgebende "Happy End" gesucht wird. Haneke vermeidet am Ende das offensichtliche Bild, weil er an eine Wahrheit glaubt, die daraus resultiert, dass man immer weitergeht. Das gilt auch für viele seiner gewohnt statischen Einstellungen. Sie sehen lange Zeit zu, suhlen sich manchmal in ihrer eigenen Undurchdringbarkeit, aber warten auf den perfekten Moment, in dem es zumindest möglich wäre, dass ein Herz, eine Emotion durchschimmert.
Calais, das ist auch ein politischer Brandherd in der Flüchtlingskrise. Gegen Ende konfrontiert der Filmemacher seine Figuren und auch sein Kino mit dieser Realität. Dieses Eindringen einer anderen Welt in jene des Großbürgertums ist aber spürbar ein dramaturgischer Kniff, der die Abschottung dieser Welt, ihre Heuchelei noch etwas greifbarer macht. Wenn es um wirkliche Teilhabe geht, entzieht sich Haneke der Verantwortung genauso wie seine Figuren. Die Präsenz der Flüchtlinge wird geduldet, sie ist eine moralische Frage, aber niemals eine Einladung für ein anderes Kino.
Jacques Rancière schrieb einmal, dass die aktuellen Stoffe aus Hollywood zeigen würden, dass es heute viel leicht wäre, sich das Ende der Welt auszumalen als eine alternative Form des Zusammenseins. Michael Haneke zeigt, dass man sich nicht mal mehr das Ende vorstellen kann. Genau darin liegt die süffisante Grausamkeit von "Happy End".
Patrick Holzapfel
Happy End - Frankreich, Deutschland, Österreich 2017 - Regie: Michael Haneke - Darsteller: Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Franz Rogowski - Laufzeit: 107 Minuten.
---

Es regnet dauernd, und wenn es mal nicht physisch regnet, herrscht trotzdem ein ewiges Drei Tage Regenwetter. Die Wiesen und Wälder machen einen depressiven Eindruck, selbst die niedrigen, oft baufällig anmutenden Häuser, die sich hier, im südkoreanischen Nirgendwo, fernab der Metropolen, zu tristen, veralteten, aber dennoch traditionslosen Dörfern zusammenrotten, wirken geknickt. Kein Wunder, dass auch die Menschen in "The Wailing" wenig zu lachen haben. Und sich stattdessen irgendwann gegenseitig an die Gurgel gehen. Ganze Familien werden wie im Rausch ausgerottet, die Häuser abgefackelt, die vermeintlichen Schuldigen kauern hinterher in der Asche, regungslos, die Gesichter unlesbar hinter einer Maske aus Blut und Schlamm.
Es dauert eine Weile, bis sich die diversen Gewalt- und Tristessesplitter, die der koreanische Regisseur Na Hong-jin zu Beginn seines neuen Films vor uns ausbreitet, zu einem halbwegs kohärenten Kriminalfall zusammensetzen, der sich dann - auch wiederum nach und nach - als ein Besessenheitsphänomen entpuppt. Zunächst schlägt "The Wailing" eher in Richtung Provinzgroteske aus: Die Polizei ist von dem Grauen, dem sie begegnet, hoffnungslos überfordert, die Beamten stolpern bei den Ermittlungen hilflos durch die Tatorte, verunreinigen bei der Spurensicherung aus reiner Tollpatschigkeit die wenigen auffindbaren Indizien und verziehen sich stets schnell wieder in ihr gleichfalls eher lächerliches Revier, das in einem schlechteren Einfamilienhaus untergebracht ist.
Auch der eine Polizist, der, aus persönlichen Gründen, irgendwann doch ein gesteigertes Interesse an dem Fall entwickelt (und freilich den Ereignissen bis zum Schluss eher hinterherhechelt, als wirklich zu einem handlugsmächtigen Individuum zu werden), ist eine traurige Gestalt: Jong-goo (Kwak Do-won), ein rundlicher, manchmal von Ferne an Kevin James erinnernder, aber dabei kein bisschen frohsinniger Typ, der sich schon in den eigenen vier Wänden kaum der bösartig lauernden Blicke seiner Stiefmutter erwehren kann, pendelt, mit einem bald ins mythologisch-außerweltliche überschwappenden Schrecken konfrontiert, zwischen stumpfer, geistferner Lethargie und affektgesteuerten, ziellosen Energieschüben hin und her. Im harten Kontrast dazu sein Gegenspieler, der zunächst nur am Rand durch die Erzählung huscht, sich aber bald klammheimlich in deren Zentrum festsetzt: ein namenloser japanischer Einsiedler (Jun Kunimura), der in einer Hütte im Wald mysteriösen Ritualen frönt, aber schon durch seine hellwache Seelenruhe jede Einstellung, in der er auftaucht, zu destabilisieren scheint. Wenn Jong-goo sich dazu entschließt, den zunächst auf nicht allzu genau definierte Art diabolischen Fremden zu konfrontieren, wechselt der Film in ein anderes, noch einmal grausligeres Register.
Na Hong-jin ist ein begnadeter Stimmungsmaler und auch wenn er in "The Wailing" fast durchweg im düsteren, baufälligen, wolkenverhangenen, braungrünen Register bleibt, gelingen ihm einige erstaunliche Akzentuierungen. Wenn etwa zum ersten Mal der von Anfang an wenig vertrauenserweckende Schamane Il-Gwang (Hwang Jung-min) auftaucht, dann sieht man ihn in einer James-Bond-Film-tauglichen aerial shot im Auto eine Landstraße entlang jagen, auf der Tonspur peitscht eine hysterische Geisterbahnmusik. Ein toller B-Movie-Moment - überhaupt finden sich ab und an erfreuliche Parallelen zum spekulativ-deliranten italienischen Horrorkino der 1970er Jahre, insbesondere zu den zahllosen "The Exorcist"-Rip-Offs. Auch beispielsweise den markerschütternden, bis zum Anschlag hochgepegelten Schrei, den Jong-goos Tochter ab einem bestimmten Punkt der Handlung auszustoßen beginnt, werde ich nicht so schnell vergessen.

Vor allem versteht der Regisseur es jedoch, seine Geisterbahnfahrt eigentümlich, soghaft zu rhythmisieren. Wenn er einen zunächst einlullt, mithilfe einer fast willkürlich anmutenden Abfolge einzelner Szenen, die nirgendwo hinzuführen und sich gleichzeitig endlos zu wiederholen scheinen, dann weckt er einen im rasanten Mittelteil umso nachhaltiger auf. Besonders eindrücklich sind zwei ausgedehnte Exorzismus-Spektakel und bald darauf noch eine furchterregende, kannibalistische Monster-Attacke: Drei stakkatoartig inszenierte filmische Hochdrucksequenzen, das Bild quillt fast über vor Blut, dazu ein gnadenlos hämmernder Soundtrack. Wie ein blast-beat-Part in einem Death-Metal-Song, nur eben jeweils mehrere Minuten lang. Im letzten Drittel dagegen bremst Na seinen Film fast komplett herunter, eine technisch hervorragend erarbeitete Sequenz entfaltet den Schrecken entlang zweier ausgedehnter, parallel montierter Gesprächsszenen, beide klassisch aufgelöst im Schuss-Gegenschuss-Verfahren.
Eine gleichzeitig filigran konstruierte und im emotionalen Einschlag wuchtige Reise in die Nacht ist das, keine Frage. Es ist sicherlich möglich, sich von "The Wailing" mit Haut und Haaren verschlingen, sich von der eigenen Angstlust, die immer wieder und immer wieder neu getriggert wird, überwältigen zu lassen. Bei mir hat das leider nicht ganz geklappt. Teilweise liegt das an technischen Einwänden: Dass Na auf die zuletzt zum Beispiel in "It" über jede Gebühr strapazierten jump scares fast vollständig verzichtet, ist zweifellos ehrenwert und darf gerne Schule machen; mit der Zeit kommt man freilich dahinter, dass seine eigene Masche, andauernd irgendwelche mysteriösen Gestalten im Bildhintergrund hinter einem Busch oder Ähnlichem hervorlugen zu lassen, auch nicht viel origineller ist. Aber mein eigentliches Problem mit dem Film ist ein anderes.
Ich suche in Filmen manchmal nach Momenten, in denen sich im Schauspiel etwas zeigt, das über die Rolle hinaus weißt - nicht als Bruch oder Verfremdung, sondern als ein Exzess des Individuellen: Gesten, Blicke, Sprechweisen usw., die nicht ganz vom Drehbuch eingefangen werden können. In "The Wailing" ist mit da nur eine Szene ins Auge gesprungen, in der zwei Polizisten in ihrem Dienstwagen unterhalten und sich der eine im Laufe ihres Gesprächs mit der Zunge in leicht ekliger Manier über die Zähne schleckt. Das mag ein schrecklich willkürlicher Zugriff sein, aber im Rückblick ist das die einzige Szene, in der ich mich wirklich für eine der Figuren im Film interessiert habe. Ansonsten sind die Darsteller kaum mehr als Funktionen der Bilder, in die sie eingebaut sind: wenn alles dunkel brütet, brüten sie auch, wenn Blutstürme wüten, wüten sie mit.
Das dürfte der Hauptgrund für eine Skepsis sein, die ich den Film über nie ganz losgeworden bin: etwas zuviel Ton in Ton, etwas zu wenig Leben. Etwas zuviel Bauplan, etwas zuwenig Raum für Querschläger, für momenthaften, unverantwortlichen Eigensinn. "The Wailing" war in seinem Produktionsland ein gigantischer Erfolg, und schon, dass es in Korea anders als in Amerika (von Europa gar nicht zu reden) derzeit möglich ist, mit einem derart wuchtigen, kompromisslosen Stück Genrekino für Erwachsene einen Blockbuster zu landen, nimmt mich durchaus für den Film ein; aber das koreanische High Concept Kino hat eben häufig etwas Aufgeplustertes, (allzu) Unentspanntes an sich, und "The Wailing" ist da, insbesondere wenn gegen Ende (synkretistisch-)religiöse Motive die Überhand nehmen, keine Ausnahme. Was umso ärgerlicher ist, als Na 2008 mit seinem Estling frischen Wind in diesen Produktionszusammenhang gebracht hatte: "The Chaser" begeisterte als erfrischend ökonomisches, trotz auch schon gut zwei Stunden Laufzeit schlank und wendig sich anfühlendes Spannungskino. Zwei Filme später hat sich das zu einer Blut-und-Tränen-Melange verdichtet, die auf vielen Ebenen Respekt abnötigt, einem aber auch ein wenig die Sinne zu verkleistern droht.
Lukas Foerster
The Wailing - Südkorea 2016 - Regie: Na Jong-jin - Darsteller: Kwak Do-wan, Hwang Jung-min, Jun Kunimura, Chun Woo-hee, Kim Hwan-hee - Laufzeit 156 Minuten.
Kommentieren