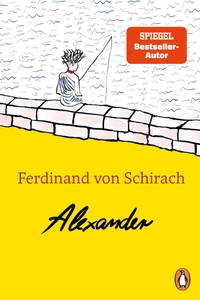Im Kino
Hammer über das Netz
Die Filmkolumne. Von Katrin Doerksen, Karsten Munt
18.10.2017. Ruben Östlund lässt in seinem Cannes-Gewinnerfilm "The Square" die Außenwelt ungefragt in eine Blase heinbrechen, die mit Reaktionen nicht mehr rechnet. Janus Metz verliert in seinem Sportfilm "Borg/McEnroe" nie den Wettkampf aus den Augen, die kinetische Schönheit des Tennis bekommt er dennoch nur selten zu fassen.
"Hör auf mit der Schwedenscheiße", stöhnt der Assistent, und Christian scheint nur darauf gewartet zu haben, dass ihn jemand seiner Verpflichtungen gegenüber Rechtsstaatlichkeit und politischer Korrektheit enthebt. Flugs wirft er sämtliche Bedenken über Bord und setzt einen Drohbrief auf. In den Figuren in "The Square" brodelt es. Das eindringlichste Bild dafür ist wahrscheinlich ein knubbelig muskulöser Mann mit freiem Oberkörper, der einer feinen Gesellschaft aufs Dach steigt. Oder genauer: auf die Tische springt. Der sich wie ein Gorilla aufführt, Frauen belästigt und Männer von ihrem Platz jagt. Die Situation scheint allen Beteiligten von Anfang an unangenehm, ungeheuer, gar bedrohlich. Aber sie wird erst einmal ausgehalten, denn sie ist überschrieben mit dem Wort: Performancekunst.
Eine andere Performance im öffentlichen Raum setzt die Ereignisse in Gang. Christian (Claes Bang) ist der Kurator eines Museums für zeitgenössische Kunst in Stockholm. Mittvierziger, sich seines guten Aussehens überaus bewusst, Lebemann. Dieser Christian beschützt eines Morgens auf dem Arbeitsweg eine schreiende Frau vor einem aggressiven Typen, der sie offensichtlich umbringen will. Er und ein Beistehender beglückwünschen sich noch gegenseitig zu ihrer beispielhaft gelebten Zivilcourage, nur um kurz darauf festzustellen, dass die vermeintliche Notsituation ein Raubzug war. iPhone und Geldbeutel sind weg, die Tracking-Funktion weißt auf einen Wohnblock in der Stockholmer Peripherie. Also steigt Christian in seinen Tesla und verteilt einen Drohbrief an sämtliche Mietparteien. Von diesem Augenblick an gerät sein wohlgeordnetes Leben außer Kontrolle - und so liegen schon nach zwanzig Minuten sämtliche Metaebenen in "The Square" offen: Es geht um das wuchtige Aufeinanderprallen verschiedener Lebensrealitäten in einem Land, in dem nach Jahrzehnten einer beispiellos liberalen Einwanderungspolitik die fremdenfeindlichen "Schwedendemokraten" glänzende Umfragewerte verzeichnen. Weil sich eine Gesellschaft durch Zuwanderung eben verändert, vor neue Herausforderungen gestellt wird. Offen bleibt fürs Erste, was die moderne Kunst dieser sich verändernden Stimmung entgegenzusetzen hat. Christian beantwortet die Frage einer Journalistin (Elisabeth Moss) mit der laschen Gegenfrage: "Wenn ich Ihre Tasche in meine Galerie stellte - wäre das dann schon Kunst?"

Ruben Östlunds eigene Antwort ist ein Projekt namens "The Square", das dem gleichnamigen Film als Recherche diente. In Zentrum der schwedischen Stadt Värnamo installierte er ein weißes Rechteck auf dem Boden und erklärte das Konzept mit einem Verweis auf das Prinzip Zebrastreifen. Der sei ein Ort, an dem sich die Menschen auf bestimmte Verhaltensweisen geeinigt hätten: Autofahrer achten auf Fußgänger. Im Square haben alle Menschen die gleichen Rechte. Bittet jemand darin um Hilfe, muss er von den Passanten Hilfe erhalten. Ein vergleichbares Rechteck bildet auch das Kernstück einer von Christian kuratierten Ausstellung. In endlosen, repetitiven Schleifen springt "The Square" zwischen den Ereignissen im Museum und Außerhalb hin und her. Die Jagd nach Christians Smartphone wächst sich zu einem Katz-und-Maus-Spiel aus. Zwei langhaarige Werbefuzzis überlegen, wie sie die Ausstellung möglichst kontrovers bewerben können. Eine Putzfrau beschädigt unwissentlich ein Kunstwerk und Christian geht mit der Journalistin ins Bett (was unter Anderem eine unerträglich peinliche Sexszene, bestehend aus abwechselnden point-of-view-shots nach sich zieht). Zwischendurch zeigt Ruben Östlund Obdachlose und Bettler im Stockholmer Stadtbild.
Nach seiner Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes - wo er im Übrigen die Goldene Palme gewann - war immer wieder zu lesen, "The Square" habe etwas Oberlehrerhaftes an sich. Eigentlich wirkt er eher zwanghaft. Bewusst zitiert Östlund immer wieder Bilder und Motive aus seinen früheren Filmen. Die steril glänzenden Oberflächen eines geschäftigen Einkaufszentrums, ein quäkendes Baby im Meeting, der frontal gefilmte Auftritt blonder Cheerleaderkinder erinnern an "Play - Nur ein Spiel", der sich mit einer Serie von Raubüberfällen unter Kindern und Jugendlichen in Göteborg auseinandersetzte. Wenn ein Mann bei der eingangs erwähnten Affenmensch-Performance hastig vom Tisch aufsteht und sich ungeachtet seiner protestierenden Gattin entfernt, ist sein Verhalten nicht weit von dem des feigen Familienvaters entfernt, der Frau und Kinder in "Höhere Gewalt" angesichts einer Lawine zurückließ. Es scheint, als müsse Östlund immer wieder auf die gleichen Probleme zurückkommen, eben, weil es sie noch immer zu beackern gilt. Die Unfähigkeit zu helfen, aber auch um Hilfe zu bitten. Verantwortung, die sich einfach nicht gerecht zwischen Staat und Individuum aufteilen lassen will. Die Außenwelt, die ungefragt in eine scheinbar intakte Blase hineinbricht.
Der Werbefilm des Museums soll möglichst schlagkräftig die Ausstellung verkaufen - auf den darauf folgenden Shitstorm ist man hinter den glatten Betonmauern nicht vorbereitet. Später nimmt Christian eine Videobotschaft für die Eltern eines kleinen Jungen auf, der durch seinen Drohbrief fälschlicherweise als Dieb beschuldigt wurde. Eine feige Methode, um Absolution weniger zu suchen als sich selbst zu erteilen. In seinem Monolog reflektiert er über Systemfragen, über eigene Unsicherheiten. Später kommuniziert er in einer Pressekonferenz seinen eigenen Rücktritt - und staunt nicht schlecht, als die Journalisten ihn beschuldigen, sich um den Preis der Meinungsfreiheit aus der Verantwortung zu stehlen. In der Blase, deren Mittelpunkt Christian bildet, rechnet man nicht mit Reaktionen. Man nimmt an, dass es reicht, nach außen zu kommunizieren. Ruben Östlund hingegen scheint eine ganz bestimmte Art der Reaktion einzukalkulieren. Wenn er uns mit seinen Filmen Spiegel vorhält, reagieren wir wie Christians Kinder in der letzten Einstellung von "The Square": auf der Rückbank des Teslas sitzend schauen sie verdutzt den konfusen Vater an - und dann zurück auf ihre iPhones.
Katrin Doerksen
The Square - Schweden 2017 - Regie: Ruben Östlund - Darsteller: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, Terry Notary - Laufzeit: 142 Minuten.
---

Tennis ist ein Sport der Spleens. Den Sand von den Schuhen klopfen, das Hemd zurecht zupfen, die Haare aus dem Gesicht wischen, beim Schlag laut stöhnen: oft sind es Eigenheiten, Rituale und die ganz eigene Körpersprache eines Spielers, die eher im kollektiven Gedächtnis der Zuschauer hängen bleiben, als sportliche Erfolge. Auch die legendäre Rivalität zwischen Björn Borg und John McEnroe ist zu großen Teilen auf ihre völlig unterschiedlichen Platz-Persönlichkeiten zurückzuführen. "Ice Borg" taufte die Boulevardpresse den Schweden, der auf dem Platz nie Emotion zu zeigen schien. McEnroe hingegen wurde für seine Wutausbrüche "SuperBrat" genannt. Von Anfang an eine Medieninszenierung, die nun auch den dramaturgischen Kern einer Filmadaption bildet
Das Setting für das Aufeinandertreffen der Tennisikonen ist Wimbledon 1980. Björn Borg (Sverrir Gudnason) sitzt im klimatisierten Luxus-Hotelzimmer, zwei Finger auf den linken Unterarm gelegt - Pulskontrolle. John McEnroe (Shia LaBeouf) kritzelt derweil im Ramones-Shirt die holzvertäfelte Wand seiner Pension voll, bis sie schließlich ein kaum lesbarer Turnierbaum schmückt. In der Mitte der Krakelei stehen sich Borg und McEnroe sgegenüber, auf dem Center Court. Regisseur Janus Metz inszeniert "Borg/McEnroe" als klassisches Sportdrama, das im Gegensatz zu Filmen wie Bennett Millers "Moneyball" und "Foxcatcher" - die das Sportliche nur am äußersten Rand ihrer Erzählungen streifen und große Wettkämpfe nur als Ergebnisse präsentieren - nie das finale Aufeinandertreffen und den Wettkampf aus dem Blick verliert.

Auf dem Weg dorthin kehrt der Film immer wieder zum Motiv des vereinsamten Athleten zurück: Borg auf der Pressekonferenz, McEnroe in einem Londoner Club; Borg einsam im Rampenlicht, McEnroe unsichtbar in seinem langen Schatten; Borg ausdruckslos nach dem ersten Turniersieg, McEnroe schäumend vor dem Schiedsrichterstuhl. Metz bietet stets zwei Varianten des hadernden Profisportlers an, die letztlich in die gleiche Richtung führen. Die Persona des Starathleten wird mit kleinen privaten Details in ein prosaisches Dasein umgewandelt. Jeder möchte "nur ein Mensch" sein, abseits der Öffentlichkeit und des Lebens, das vom Management für einen entworfen wird. Doch ausgehend von der öffentlichen Wahrnehmung scheinen alle Wege des Dramas in bekannte Abzweigungen zu verlaufen. Ein Zusammenbruch unter der Dusche und einsame Stunden in der Umkleidekabine wirken ebenso konsequent und klischeehaft wie die Motivationsreden, die Borgs Trainer Bergelin (Stellan Skarsgård) seinem Schützling stets aufs Neue hält. Spätestens beim dritten Pep-Talk ist auch klar, dass all die pathetischen Ansagen existieren, damit ein Mensch wie Borg überhaupt auf dem Platz erscheinen kann, natürlich nicht, ohne sich vorher zu übergeben. Solchen Momenten hebt "Borg/McEnroe" Flashbacks aus der frühen Kindheit unter, die die Athleten-Charakterstudie mit logischer Konsequenz bis auf den Rasenplatz Wimbledons begleitet.
Dabei hält Metz geradezu pedantisch an seiner authentischen Übersetzungslogik fest. Die schönste Konsequenz daraus bleibt das Erscheinungsbild der Athleten, das frei von Ironie und fern der Kostümklamotte die perfekte Balance zu halten vermag. Statt des vom Tanktop freigelegten Riesenbizeps eines Rafael Nadal oder des elegant unscheinbaren Körpers eines Roger Federer, präsentieren sich die legendären Rivalen als schlaksiger Lockenkopf mit Babyspeck und als Blondschopf, dessen stoischer Sexappeal tatsächlich erst zur Geltung kommt, wenn der Film ihn bei einer Stippvisite im legendären Studio 54 in Abendklamotte präsentiert.
Auf dem Tennisplatz findet Metz' perfektionistisches Festhalten an Glaubwürdigkeit seine Grenzen. Zu selten bringt "Borg/McEnroe" die Athleten in Bewegung. Die Ästhetik des Sports weicht auch auf dem Rasenplatz der Ästhetik des Wettkampfs. Hier dominieren Punktetafeln, Zuschauerreaktionen, Kommentatoren und die schweißtriefenden Close-Ups der Spieler. Damit umkreist der Film elegant die oft CGI-gestützte Unbeholfenheit, mit der Filme wie "Wimbledon" bisher versuchten, den Sport abzubilden. Stattdessen werden die Elemente der Fernsehübertragungen auf dem Center Court so montiert, dass ein 37 Jahre altes Finale wieder zur Live-Übertragung wird. Das ist spannend, wirkt aber doch wie eine Ersatzhandlung für die kinetische Schönheit des Tennis, die nur in den kurzen Momenten aufblitzt, in denen Borg zu seiner charakteristischen Rückhand ausholt und sie schwingt, als wolle er einen Hammer über das Netz werfen. Genau in diesen, wohl schönsten Szenen, gibt der Film seine Fassade der perfekten Imitation auf. Für einen kurzen Moment sieht Gudnason nicht mehr aus wie Björn Borg - und kommt ihm in der eigentümlichen Charakteristik seiner eigenen Bewegung doch viel näher, als es mit perfekt inszenierter Authentizität möglich wäre.
Karsten Munt
Borg/McEnroe - Schweden 2017 - Regie: Janus Metz - Darstller: Shia LaBeouf, Sverrid Gudnason, Stellan Skarsgård, Tuva Novotny, Björn Granath, David Bamber - Laufzeit: 107 Minuten.
1 Kommentar