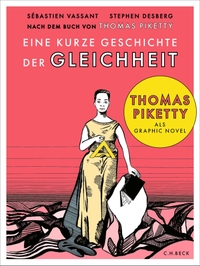Im Kino
Halbseiden-abgründiger Sexappeal
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Sebastian Markt
21.09.2017. Neu startet Joseph Cedars "Norman", mit einem dezent überagierenden Richard Gere, der auf den vornehmsten Straßen New Yorks auf Beute geht. Harun Farockis Essayfilm-Hauptwerk erzählt eine Geschichte "Zwischen zwei Kriegen", aber keine lineare. Der Film ist am 16.09. im Berliner Kino Arsenal zu sehen.
Norman läuft durch die Straßen New Yorks, genauer gesagt durch jene Straßen New Yorks, auf denen sich die Mächtigen und Einflussreichen tummeln. Oder noch genauer: durch Straßen, auf denen sich jene tummeln, die einmal mächtig und einflussreich werden wollen, aber es bislang eher noch nicht sind. Norman selbst ist ebenfalls nicht mächtig, aber er gibt sich alle Mühe, einflussreich zu wirken. Sobald er jemand in seiner Umgebung entdeckt, der oder die ein wenig unsicher, suchend, bedürftig dreinblickt, leckt er Blut, sucht das Gespräch, bietet seine Hilfe an. Genauer gesagt: Er bietet an, den Gesprächspartner mit diesem und jenem vertraut zu machen, hier und da ein gutes Wort für ihn einzulegen. Weniger in seinen Worten als in seinen Gesten versucht er dabei die Fiktion zu erschaffen, "connected" zu sein. Allzu erfolgreich sind seine Bemühungen nicht, insbesondere weil sie zu offensichtlich bemüht wirken. Nicht wie ein Fisch im Wasser bewegt er sich, wenn er zwischen den künftigen Entscheidern hin und her eilt; eher erinnert er an ein übereifriges Jungtier, das verzweifelt versucht, mit dem Rudel mitzuhalten und dabei mangelnde körperliche Reife mit Enthusiasmus (nie ganz) ausgleicht. Das eigentliche Problem könnte dann darin bestehen, dass Norman eben gerade nicht jünger, sondern älter ist als die Mehrzahl seiner Gesprächspartner.
Wenn er (wieder einmal) abgewimmelt wird, zieht er weiter, sucht sich das nächste Opfer, und oftmals hat er zwischendurch noch einen Anruf zu erledigen. Norman trägt Kopfhörer im Ohr, die an ein Telefon angeschlossen sind, ein fast unsichtbares Mikrofon befindet sich zumeist irgendwo in der Nähe seiner Schulter. Den Anblick von Menschen, die sich auf der Straße ohne sichtbare Gerätschaften fernmündlich mit Anderen, Abwesenden unterhalten, ist man zwar inzwischen gewohnt, aber bei Norman rückt diese Handlung doch wieder in die Nähe des Selbstgesprächs eines psychisch Verwirrten. Verantwortlich dafür ist Nomans dezente Überagitiertheit, und vielleicht auch ein bisschen sein Kleidungsstil, der zwar distinguiert ist und gepflegt, aber auf eine brüchige, nicht ganz organische Weise. Die Rückseite von Normans ewiger Geschäftigkeit ist eine mindestens halbbewusste Angst vor Verwahrlosung - und später im Film scheint sich diese Angst zu materialisieren, in Gestalt eines Norman-Doppelgängers, der seine Manierismen und seinen Kommunikationsstil nachahmt, aber in abgerissener Kleidung unterwegs ist.

Dass Norman von Richard Gere gespielt wird, ist ein fast schon genialer Schachzug. Das längst schneeweiße, aber nach wie vor in elegante Stirnlocken frisierte Haar, darunter das Gesicht, in dem selbst in den ernstesten Szenen ein spöttisches Grinsen verborgen scheint (mehr in den Augen als im Mund), seine agile, schlanke Gestalt: Noch immer steckt in Gere der American Gigolo, sein mondäner, irgendwie komplett unamerikanischer, stets etwas halbseiden-abgründiger Sexappeal wirkt nach wie vor. In "Norman" mag sein Spiel manchmal zu sehr in den "Qualitätskinomodus" abrutschen, in einen unbedingten Ausdruckswillen, der nichts ist als ausgestellte Technik, der eine Figur nur behauptet, nicht zeigt; aber in den entscheidenden Momenten setzt sich die Ikone Gere stets mühelos gegen den Method Actor Gere durch. Daraus folgt auch, dass Norman mit seinen Gesprächspartnern zumindest auf der Ebene der unmittelbaren Kommunikation keine Geschäftsbeziehung unterhält, sondern mit ihnen flirtet, vielleicht ohne es zu wissen. Besonders interessant ist die Szene, in der er eine von Charlotte Gainsbourg verkörperte Diplomatin anquatscht. In einer Manier, die sich zunächst kein bisschen von seinen Interaktionen mit den vorherigen, weitgehend männlichen Gesprächspartner unterscheidet. Dennoch gibt es einen kurzen Moment der Irritation, als sie ihm mitteilt, dass sie lesbisch ist. Obwohl wenig dafür spricht, dass er in der Szene (oder sonst irgendwo im Film) von erotischen Interessen geleitet ist, hält er kurz inne, orientiert sich neu, bevor er wieder, mit noch einmal gesteigerter Intensität, zum Angriff übergeht.
Am besten ist der Film, wenn er sich ganz seiner eigenen Faszination für die Hauptfigur hingibt. Zum Beispiel isoliert die Kamera Norman immer wieder in leeren Räumen, die sich plötzlich im urbanen Gewusel auftun; man hat dann den Eindruck, dass Gere in diesen Momenten in das Off New Yorks, wenn nicht der Bildlichkeit überhaupt stürzt. Die Versuche, den zielstrebigen Erratiker Norman in eine kohärent konstruierte Erzählung zu pressen, sind hingegen nicht immer überzeugend, genauso wenig wie die Split-Screen-Spielereien, mit denen Cedar seine ansonsten unauffällig-souveräne Bildsprache hin und wieder aufzumotzen versucht. Die Erzählung ist aber glücklicherweise eh nicht allzu aufwändig ausgearbeitet. Dass es dem Film an Prägnanz mangelt, ist seine Stärke. Er belässt die Beziehung zwischen seinen Figuren ebenso wie die biografischen und motivationalen Hintergründe Normans in der Schwebe, aber ohne dabei großspurige Ambivalenzgesten zu setzen.

Der Grundzustand des Films ist ein geschäftiger Leerlauf, der nicht nur Norman, sondern alle Figuren auf Trab hält, ohne dass man den Eindruck hat, dass auch nur irgendjemand ein konkretes Ziel vor Augen hat. Cedar legt allerlei Fährten, die aber alle früher oder später ins (narrative) Nichts führen, und die den Film letztlich immer wieder auf seine enigmatische Hauptfigur zurückwerfen. Das betrifft den Gainsbourg-Handlungsstrang, aber noch mehr die Freundschaft Normans mit dem jungen Politiker Micha Eshel (ziemlich großartig: Lion Ashkenazi). Nachdem Norman endlich einmal, wie er selbst sagt, aufs richtige Pferd setzt, weil Eshel, den er in einem leicht desorientierten Zustand abpasst, umsorgt und mit sauteuren Schuhen beschenkt, drei Jahre später israelischer Ministerpräsident wird, erwartet man, dass sich der Film zum Politthriller vereindeutigt.
Tut er aber nicht. Es entspinnt sich zwar durchaus eine Intrige, aber Norman kann nur gelegentlich, von Außen, in sie hineintelefonieren, wird zumeist von Eshers Sekretärin abgewimmelt. Esher wiederum bleibt als Politiker derart konturlos, dass man durchaus auf die Idee verfallen könnte, dass er seinerseits nur ein weiterer Norman-Doppelgänger ist. Und dass "Norman" vielleicht überhaupt komplett in Normans Kopf spielt, in einem Spiegelkabinett, dessen rafinierte Konstruktion man vielleicht nur deshalb nicht erkennt, weil es von Anfang an über keinen Ausgang verfügt.
Lukas Foerster
Norman - Israel, USA 2016 - Regie: Joseph Cedar - Darsteller: Richard Gere, Lior Ashkenazi, Michael Sheen, Steve Buscemi, Charlotte Gainsbourg - Laufzeit: 117 Minuten.
---

"Ein Film aus den Klassenkriegen, in dem es nicht um die Schmerzen der Verletzten und die Qualen des Todes geht." (Ein Bild aus einer Fabrik, ein Arbeiter, der kniet, ein Arm im Ärmelschoner, der ihm einen Revolver ins Genick setzt, ein Soldat zu Pferd, der unten vorbeireitet.) "Ein Film über die Ausrichtung der Arbeit, in dem es nicht um die Schmerzen und Qualen des Arbeitstages geht." (Ein Bild von manikürten Händen, die in Zeitlupe auf einer elektronischen Tastatur tippen.) So heißt es zu Beginn. Worum aber geht es in diesem Film, der, wie es später heißt, "Eine Geschichte aus der Zeit zwischen den Kriegen" erzählt?
Es geht, zunächst, um eine Suche nach einem Grund, um eine Krankenschwester, die danach fragt, wofür die Soldaten des Ersten Weltkriegs gestorben sind. Während einer auf den Geleisen stirbt, schreibt er "Rohstoffe" auf die Bahnschwellen. Während ein anderer stirbt, ritzt er "Wahn" in den Dreck. Es geht, dann, um eine Geschichte technologischer Rationalität, die in eine Geschichte gesellschaftlicher Irrationalität umschlägt. Ein Ingenieur präsentiert eine Idee für einen industriellen Verbund, in dem die Abgase des einen Produktionsvorgangs einen anderen befeuern, und umgekehrt. Es geht um die ökonomischen Konsequenzen und die politischen Implikationen. Es geht, immer wieder, um einen Filmemacher, der unter erschwerten Bedingungen versucht einen Film zu machen, der einer Frage nachgeht. "Wenn man kein Geld hat, für Autos, Schießereien, schöne Kleider, wenn man kein Geld hat für Bilder, die die Filmzeit, das Filmleben von selber verstreichen lassen, dann muss man seine Kraft in die Intelligenz der Verbindung der einzelnen Elemente legen, die Montage der Ideen", sagt er, während man ihm über die Schulter dabei zusieht, wie er aus Worten und Bildern den Bauplan einer Erzählung zusammensetzt.
"Zwischen zwei Kriegen", Harun Farockis 1978 nach langjähriger Arbeit fertiggestellter, und bis dahin umfangreichster und dichtester Film, verfolgt in der Vorgeschichte des deutschen Faschismus, die er auch als die Geschichte der katastrophalen Niederlage der deutschen Arbeiterbewegung erzählt, die Spur eines ökonomischen Zusammenhangs. Es ist ein Film, der in erzählerischen Bildern ein Argument verfolgt, eine historische Rekapitulation, die jene immanenten Horizonte rekonstruiert, welche bestimmen, was den in ihr Handelnden denk- und machbar schien. Es ist eine Suche nach einer Lehre, die immer wieder die Bedingungen und Grenzen ihrer eigenen Erkenntnispotentiale auslotet.
Dass die Logik von Bildern, auch von solchen, die aneinandergereiht stehen, sich nicht rein linear erschließt, nutzt Farocki zum Versuch, Geschichte zu rekapitulieren. Das eine bittere Ende, auf das diese Geschichte doch zugeht, bestimmt nicht die Erzählung, und das, was es in ihr zu Begreifen gibt. Seine Bilder sind Bilder, die etwas zum Ausdruck bringen und in Frage stellen, Bilder, die an andere Bilder anschließen (solche des Weimarer Kinos vor allem) und sie in andere Bezüge setzen, Bilder die sich zu etwas, das historisch ist, in Verbindung setzen, und selbst Teil von Geschichte sind.
Der Arbeiter, der eine (kollektive) Heldenfigur dieser Geschichte ist, wird sich am Ende, nach dem Sieg des Faschismus, aus dem Fenster gestürzt haben. Was man sieht, ist jedoch nicht seine Leiche, sondern deren Umrisse, die mit Kreide in den Asphalt geschrieben sind. Zwischen den Kriegen liegt die Zeit in der sich die Frage nach den Zusammenhängen erörtern läßt. Zwischen den Bildern liegt der Raum, in dem der Film seine eigene Art zu denken findet.
Sebastian Markt
Zwischen zwei Kriegen - BRD 1978 - Regie: Harun Farocki - Darsteller: Ingemo Engström, Jeff Layton, Stefan Matousch, Willem Menne - Laufzeit: 83 Minuten.
Das Berliner Kino Arsenal zeigt derzeit und noch mehrere Monate lang eine integrale Werkschau der Filme Farockis. Zwischen zwei Kriegen ist am 26.09. um 20 Uhr zu sehen.
Kommentieren