Außer Atem: Das Berlinale Blog
Am Meer ein Gefängnis: Christian Petzolds 'Barbara' (Wettbewerb)
Von Thomas Groh
12.02.2012.
"At last, I am free - I can hardly see in front of me!", singen Chic über die präzise gesetzte Schwarzblende, mit der Christian Petzold seinen neuen Film "Barbara" enden lässt. Ein Auftakt übertönt das Schwarz, ein Knoten, auf den "Barbara" kontinuierlich hingearbeitet hat, ist mit einem Mal gelöst - der Film, der zwar unweit der Meeresküste spielt, doch eigentlich ein Gefängnis beschreibt, öffnet sich schlagartig zu der weltumarmenden Weite, die nur der Soul der 70er Jahre auf diese Weise in Klang gegossen hat. Es gehört viel Mut dazu, einen Film über latente Paranoia, angespannte Kiefermuskeln, über suchende Blicke in leeren Augen und schlussendlich auch ethische Dilemmata mit derart zärtlichem Schmelz ausklingen zu lassen. Petzold, mit "Barbara" zu einer Meisterschaft seiner Kunst gereift, die nichts mit Routine oder gar Abgeklärtheit zu tun hat, gelingt dies glatt.
Vom Soul der 70er, überhaupt von solchem Sound und jedweder Urbanität ist Barbara (Nina Hoss) denkbar weit entfernt: Als eigentlich reüssierende Ärztin an der Berliner Charité wird sie gleich zu Beginn wegen eines Ausreise-Antrags - sie ist in einen Westdeutschen verliebt - von der DDR-Obrigkeit an ein Provinzkrankenhaus unweit der Ostseeküste strafversetzt. Die zugeteilte Wohnung ist ein Loch mit angekokelter Steckdose. Dass ihr Vorgesetzter, Dr. André (Ronald Zehrfeld - ein echtes Mannsbild, bei Dominik Graf sonst als Körper ganz eskalativ und fordernd inszeniert, hier nun dazu im Kontrast mit über dem Rücken spannenden Arztkittel fast schon in Ketten gelegt), mit der Stasi zumindest zu tun hat, macht schon sein erster Auftritt klar: Als Barbara zum Dienst antritt - sie ist etwas zu früh, raucht noch eine Zigarette im Park vor dem Hospital - blitzt er durch die Vorhänge am Fenster (überhaupt wird hier oft hinter Vorhängen hervor auf die Straße geschaut) auf sie herunter, während ein Offizier (wie so oft asig mit Bravour: Rainer Bock) ihm bestätigt: Ja, das ist "sie". Dass André sich für Barbara auch jenseits solcher Befehlshierarchien zu interessieren beginnt, stellt Petzold wunderbar latent in den Raum. Dass André wiederum sich in einer solchen Hierarchie bewegt, macht Barbara schon frühzeitig an seinem autoritär durchwirkten Vokabular fest. Barbara will trotzdem raus, rüber - erst recht nun hier, gestrandet in der Provinz.

Die DDR - "Barbara" spielt in den frühen 80ern - wird hier nicht als Warenboutique mit nostalgischem "Ach, weeste noch, ditte"-Zeigefinger-Effekt vorgeführt, nicht als mausgrauer Betonstaat, dessen Gräue sich in die Falten seiner Bürger gefressen hat. Kein Pittiplatsch und Sandmännchen, keine Abrafaxe, Spreewaldgurken oder Insidersprüche wider die Obrigkeit kecker Ostdeutsche im Zonenpark, kein Privileg der Ausstattungsrechercheure über das nötige Minimum hinaus: Ein Provinzfilm ohne die Signaturen provinzieller Kinomanufaktur. Stattdessen: Die DDR als Raum, in dem Menschen unter bestimmten Bedingungen leben, als allenfalls im Stasi-Offizier (der aber auch eigentlich anderen Tätigkeiten nachgeht) greifbare Präsenz, die sich in die Beziehungen, mehr noch in die entstehenden Beziehungen der Menschen eingräbt.
Petzold kennt die DDR aus eigener Erfahrung, wenn auch nur touristisch: Er besuchte als Jugendlicher regelmäßig Verwandte dort. Im taz-Interview sprach er davon, dass er das Land nie grau, sondern farbig erlebte. Diese Farben sind dem Kino über die DDR indessen abhanden gekommen, daher auch sein Entschluss, anders als in seinem vorherigen Film aus dem "Dreileben"-Projekt, wieder analog auf 35mm zu drehen: "Die Farbpalette ist so menschlich." Und was für Farben das sind: Nie dick aufgetragen, wenn auch manchmal kräftig. Der rote Vorhang, der André einmal vom Fenster trennt. Das orange-dumpfe Licht nachts auf den Straßen. Das golden schimmernde Gesicht der Klavier spielenden Nina Hoss vor blauem Vorhang. Das Make-Up auf Nina Hoss' Augenlidern. Schließlich die dramatische Zuspitzung nachts am Strand: Wie ein Strich durchs Bild gezogen der Horizont, darüber schimmert leicht Dänemark heran, Nina Hoss ganz fahl, blass blau mit weißen Haaren - eine Gespensterfrau am äußersten Punkt der Anspannung. Und wie gesättigt blau die Jacke ist, die sie gelegentlich trägt. Eine Farbensinnlichkeit, die direkt mit der sinnlichen Tongestaltung korrespondiert: Wenn Barbara Westgeld auf Vorrat in freier Natur vor den Regimehäschern bunkert, umrauscht sie der Wind auf eine Weise, die zum Ereignis für sich wird.

Darauf setzt Petzold in geschickter Konstruktion die Ankündigung einer melodramatischen Struktur, gliedert dafür Subplots und Episoden an, deren anfangs erst unklare Funktionen sich nach und nach weisen und zieht damit die Anspannung zum Äußersten an. Mit Angeberei hat das nichts zu tun: Was hier, mehr als in allen oscarprämierten DDR-Themenabendfilmen dieser Welt, filmisch zum Ausdruck kommt, ist die Zerfurchung persönlicher Bindungen durch ein Regime, das nicht so sehr diktatorisch von oben herab als vielmehr zersetzend wirkt. Petzold spitzt am Ende zu, grob gesagt stehen einander gegenüber: Die Verpflichtungen des hippokratischen Eids wider das eigene, individuelle Wohlbefinden.
Wie Petzold dies am Ende auflöst, ist (in seiner Aussage) so ambivalent wie (in seiner Form) großartig. Es umweht im Spröden der märchenhafte Zauber einer kleinen Utopie: Kein Regime ist so übermächtig, dass es zwei Menschen daran hindern könnte, einander im Blick zu erkennen. Schwarzblende: At last I am free.
Thomas Groh
"Barbara". Regie: Christian Petzold. Mit Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Rainer Bock, Christina Hecke u.a., Deutschland 2012, 105 Minuten. (Vorführtermine)
Kommentieren








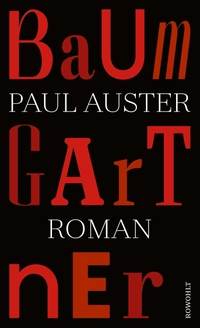 Paul Auster: Baumgartner
Paul Auster: Baumgartner Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung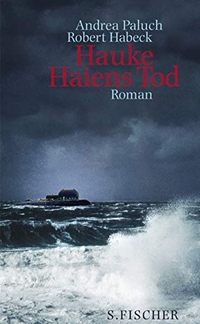 Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod
Robert Habeck, Andrea Paluch: Hauke Haiens Tod