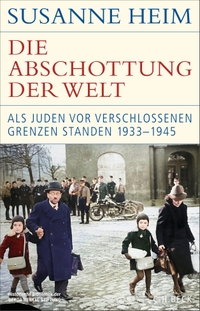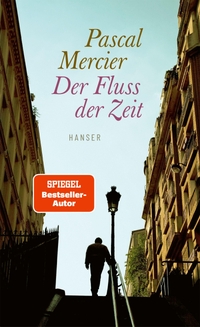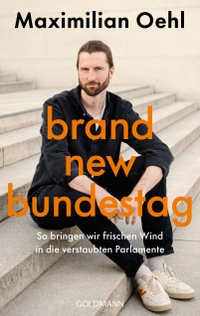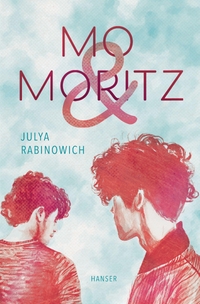Magazinrundschau
Perliges Neo-Champagner
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
New York Times (USA), 28.06.2020
 Natürlich sei eine Polizeireform notwendig, meint Nikole Hannah-Jones, aber wirklich helfen würde Schwarzen in Amerika ein Ausgleich der Vermögensverhältnisse. Dann könnten sich vielleicht auch Schwarze ein Haus in einem sicheren Viertel leisten, mit sicheren Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Deswegen fordert auch Hannah-Jones Kompensation für die Sklaverei, die den Schwarzen nach der Befreiung vorenthalten wurde, während über Generation hinweg weißen Einwanderern Land von der Regierung geschenkt wurde, die darauf ihr Vermögen aufbauen konnten: "Im Januar 1865 gab General William Tecumseh Sherman die Special Field Order 15 aus, mit der mehrere hunderttausend Acres ehemaliges Konföderierten-Land in South Carolina und Georgia an die befreiten Menschen verteilt werden sollte, in Parzellen von 40 Acres. Doch vier Monate später, im April, wurde Abraham Lincoln ermordet. Andrew Johnson, der rassistische Vizepräsident aus den Südstaaten, der die Regierung übernahm, brach das Versprechen, in Missachtung von Shermans Anordnung. Die meisten Amerikaner glaubten, dass die Schwarzen für ihre Befreiung dankbar sein sollten, dass mit dem Blutzoll des Bürgerkrieges alle Schuld getilgt sei. Die Regierung konfiszierte das Land der Familien wieder, die der Sklaverei entronnen waren und gerade ein bescheidenes Dasein jenseits der weißen Peitsche begonnen hatten. Sie gab es den Verrätern zurück. Und damit endete der einzige wirkliche Versuch dieser Nation, die schwarzen Amerikaner für 250 Jahre Sklaverei zu entschädigen."
Natürlich sei eine Polizeireform notwendig, meint Nikole Hannah-Jones, aber wirklich helfen würde Schwarzen in Amerika ein Ausgleich der Vermögensverhältnisse. Dann könnten sich vielleicht auch Schwarze ein Haus in einem sicheren Viertel leisten, mit sicheren Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen. Deswegen fordert auch Hannah-Jones Kompensation für die Sklaverei, die den Schwarzen nach der Befreiung vorenthalten wurde, während über Generation hinweg weißen Einwanderern Land von der Regierung geschenkt wurde, die darauf ihr Vermögen aufbauen konnten: "Im Januar 1865 gab General William Tecumseh Sherman die Special Field Order 15 aus, mit der mehrere hunderttausend Acres ehemaliges Konföderierten-Land in South Carolina und Georgia an die befreiten Menschen verteilt werden sollte, in Parzellen von 40 Acres. Doch vier Monate später, im April, wurde Abraham Lincoln ermordet. Andrew Johnson, der rassistische Vizepräsident aus den Südstaaten, der die Regierung übernahm, brach das Versprechen, in Missachtung von Shermans Anordnung. Die meisten Amerikaner glaubten, dass die Schwarzen für ihre Befreiung dankbar sein sollten, dass mit dem Blutzoll des Bürgerkrieges alle Schuld getilgt sei. Die Regierung konfiszierte das Land der Familien wieder, die der Sklaverei entronnen waren und gerade ein bescheidenes Dasein jenseits der weißen Peitsche begonnen hatten. Sie gab es den Verrätern zurück. Und damit endete der einzige wirkliche Versuch dieser Nation, die schwarzen Amerikaner für 250 Jahre Sklaverei zu entschädigen."New Yorker (USA), 06.07.2020
 In den USA gibt es inzwischen mehr als sechzigtausend Dollar Generals und fast achttausend Family Dollars - und es entstehen immer weitere der Billig-Discounter, schreibt Alec MacGillis in der aktuellen Ausgabe des Magazins. Die Löhne sind niedrig und die Kriminalität - von Diebstahl über Raubüberfall bis zu Mord - ist überdurchschnittlich hoch in den Ladenketten, fährt MacGillis fort: Oft in ärmeren Nachbarschaften liegend, gibt es maximal drei Angestellte pro Geschäft, Kameras funktionieren kaum und an sämtlichen Sicherheitsstandards wird ebenfalls gespart: In einem Dollar General, in dem kurz vorher ein Raubüberfall geschehen war, "nahm der 32-jährige Edwin Goldsmith eine Stelle an. Das einzige Sicherheitstraining, das er erhielt, war ein zwölfminütiges Video. Die Kassierer wurden angewiesen, das Geld in der Schublade herauszugeben, wenn sie bedroht wurden, ein Farbpäckchen beizufügen, um die Rückverfolgung des Geldes zu erleichtern, und ein rotes Telefon hinter der Kasse zu verwenden, um eine Sicherheitsfirma anzurufen, die von Dollar General beauftragt wurde. Die Vorgesetzten von Goldsmith ignorierten seine Bitte um Sicherheitspersonal. Am St. Patrick's Day, als Ohio inmitten der Coronavirus-Pandemie alles dichtzumachen begann, betrat ein Mann den Laden, zog eine Maske an und holte eine Waffe heraus. Es waren nur achtzig Dollar in der Kasse; die Kassierer hatten gerade Bargeld zum Briefkasten gebracht. Es gab keine Farbpäckchen in der Kasse, es war nach dem Raubüberfall im November immer noch nicht ersetzt worden. Goldsmith hatte erst kürzlich einen Teil der Theke entfernt, den der Schütze mit einer Kugel beschädigt hatte. Goldsmith, der älteste der drei Angestellten in der Schicht, befürchtete, dass der Räuber zurückkommen würde. Also holte er seine eigene Waffe aus seinem Auto und schob sie unter den Hosenbund. Die Polizei traf ein, ebenso wie der Bezirksleiter von Dollar General. Als sie das Kameramaterial abspielten, um den Raub zu sehen, sahen sie auch, wie Goldsmith seine Waffe holte. Am folgenden Tag teilte der Geschäftsleiter Goldsmith mit, die Firma habe ihm gesagt, er solle ihn entlassen, weil er gegen die Regeln der Firma verstoßen habe, wonach es verboten ist, eine Waffe zur Arbeit zu bringen."
In den USA gibt es inzwischen mehr als sechzigtausend Dollar Generals und fast achttausend Family Dollars - und es entstehen immer weitere der Billig-Discounter, schreibt Alec MacGillis in der aktuellen Ausgabe des Magazins. Die Löhne sind niedrig und die Kriminalität - von Diebstahl über Raubüberfall bis zu Mord - ist überdurchschnittlich hoch in den Ladenketten, fährt MacGillis fort: Oft in ärmeren Nachbarschaften liegend, gibt es maximal drei Angestellte pro Geschäft, Kameras funktionieren kaum und an sämtlichen Sicherheitsstandards wird ebenfalls gespart: In einem Dollar General, in dem kurz vorher ein Raubüberfall geschehen war, "nahm der 32-jährige Edwin Goldsmith eine Stelle an. Das einzige Sicherheitstraining, das er erhielt, war ein zwölfminütiges Video. Die Kassierer wurden angewiesen, das Geld in der Schublade herauszugeben, wenn sie bedroht wurden, ein Farbpäckchen beizufügen, um die Rückverfolgung des Geldes zu erleichtern, und ein rotes Telefon hinter der Kasse zu verwenden, um eine Sicherheitsfirma anzurufen, die von Dollar General beauftragt wurde. Die Vorgesetzten von Goldsmith ignorierten seine Bitte um Sicherheitspersonal. Am St. Patrick's Day, als Ohio inmitten der Coronavirus-Pandemie alles dichtzumachen begann, betrat ein Mann den Laden, zog eine Maske an und holte eine Waffe heraus. Es waren nur achtzig Dollar in der Kasse; die Kassierer hatten gerade Bargeld zum Briefkasten gebracht. Es gab keine Farbpäckchen in der Kasse, es war nach dem Raubüberfall im November immer noch nicht ersetzt worden. Goldsmith hatte erst kürzlich einen Teil der Theke entfernt, den der Schütze mit einer Kugel beschädigt hatte. Goldsmith, der älteste der drei Angestellten in der Schicht, befürchtete, dass der Räuber zurückkommen würde. Also holte er seine eigene Waffe aus seinem Auto und schob sie unter den Hosenbund. Die Polizei traf ein, ebenso wie der Bezirksleiter von Dollar General. Als sie das Kameramaterial abspielten, um den Raub zu sehen, sahen sie auch, wie Goldsmith seine Waffe holte. Am folgenden Tag teilte der Geschäftsleiter Goldsmith mit, die Firma habe ihm gesagt, er solle ihn entlassen, weil er gegen die Regeln der Firma verstoßen habe, wonach es verboten ist, eine Waffe zur Arbeit zu bringen."In der gleichen Ausgabe stellt Anna Wiener sogenannte "Ghost kitchens" vor, also virtuelle Restaurants, die nur noch für Lieferdienste produzieren und keinen Gastraum bieten: "Einige Restaurantbesitzer betreiben zehn virtuelle Marken von einer einzigen Küche aus. Im Februar, als der Stadtrat von New York eine Aufsichtsanhörung über die Auswirkungen von Geisterküchen auf lokale Unternehmen abhielt, sagte Matt Newberg, ein Unternehmer und unabhängiger Journalist, aus, er habe einen CloudKitchens-Beauftragten in Los Angeles besucht, wo siebenundzwanzig Küchen auf 11.000 Quadratmetern einhundertfünfzehn Restaurants auf Lieferplattformen betreiben. Newberg stellte ein Video online, auf dem Köche gezeigt wurden, die in ein fensterloses Lagerhaus gepfercht sind und über die Geräusche von Tabletts und Telefone hinweg Bestellungen brüllen. Für die Menschen, die in Geisterküchen arbeiten, hat diese Umgebung nichts Gespenstisches an sich, höchstens für die Kunden; die Geister sind die Arbeiter selbst. Die Logik der Plattformen zur Lieferung von Lebensmitteln ist die Logik des digitalen Marktplatzes. Genauso wie es vier verschiedene Amazon-Listen unter vier verschiedenen Markennamen für dasselbe USB-Kabel gibt, kann ein in einer Geisterküche hergestelltes Sandwich auf mehreren Speisekarten mit verschiedenen Namen erscheinen. Virtuelle Restaurantmarken haben oft auffällige und mit Worten spielende Namen, und einige scheinen wie aus einer Kurzgeschichte von Lorrie Moore gerissen zu sein: Á La Couch, Endless Pastabilities, Mac to the Future, Bad Mutha Clucka."
Weiteres: Sehr detailliert erläutert Jeffrey Toobin, wie der Mueller-Report an der Sabotage durch Justizminister William Barr scheiterte.
London Review of Books (UK), 02.07.2020
 Natürlich habe China in der Coronakrise nicht "offen, transparent und verantwortungsbewusst" gehandelt, aber Donald Trumps Gepolter gegen die WHO und Pekings angeblichen Einfluss verdecke die wahren Gräben, die sich durch die internationalen Gesundheitspolitik ziehen, befürchtet James Meek in einem sehr ausführlichen Report über die WHO: "Es gibt eine immer wiederkehrende Angst in Europa und Amerika vor Infektionskrankheiten aus anderen Teilen des Planeten und damit verbunden den Willen, sich dagegen zu verbarrikadieren. Auf dieses alte Muster stößt die amerikanische Furcht vor allem, was wie eine Weltregierung aussehen könnte, und eine Gesundheitspolitik, die zwischen zwei Idealen hin und her gerissen ist: Dem technischen Modell, bei dem Gesundheit aus einer Reihe von persönlichen Problemen besteht, die durch intensive, vorzugsweise einmalige wissenschaftliche Erfindungen behoben werden können (man muss nur den Gencode der Moskitos verändern und schon ist die Malaria ein für allemal ausgelöscht!), und dem kommunalen Modell, das Gesundheit für ein fortlaufendes, nicht abschließbares und universales Projekt sozialer Reformen hält, technologiearm, arbeitsintensiv und untrennbar verbunden mit Fragen des Wohnens, mit Bildung, Ernährung, Arbeit, Armut und Ungleichheit. Krankheit kennt keine Grenzen, wurde uns ein ums andere Mal erklärt, wir müssen zusammenarbeiten. Aber was heißt das? Kann die WHO der Weg sein, globale Anstrengungen zu dirigieren, oder ist sie dazu verurteilt, die Realität zu bemänteln, dass es zwischen den Nationen nur wenig Solidarität gibt? Trumps Intervention vom Mai war keine Hilfe für die WHO, und Amerikas Rückzug aus der Organisation wäre ein herber, aber nicht unerwarteter Schlag, aber etliche Regierungen dürften erleichtert gewesen sein, dass der amerikanische Präsident alle mediale Aufmerksamkeit auf sich zog, die sonst vielleicht dem größeren Versäumnis gegolten hätte, dem Fehlen weltweiter Kooperation."
Natürlich habe China in der Coronakrise nicht "offen, transparent und verantwortungsbewusst" gehandelt, aber Donald Trumps Gepolter gegen die WHO und Pekings angeblichen Einfluss verdecke die wahren Gräben, die sich durch die internationalen Gesundheitspolitik ziehen, befürchtet James Meek in einem sehr ausführlichen Report über die WHO: "Es gibt eine immer wiederkehrende Angst in Europa und Amerika vor Infektionskrankheiten aus anderen Teilen des Planeten und damit verbunden den Willen, sich dagegen zu verbarrikadieren. Auf dieses alte Muster stößt die amerikanische Furcht vor allem, was wie eine Weltregierung aussehen könnte, und eine Gesundheitspolitik, die zwischen zwei Idealen hin und her gerissen ist: Dem technischen Modell, bei dem Gesundheit aus einer Reihe von persönlichen Problemen besteht, die durch intensive, vorzugsweise einmalige wissenschaftliche Erfindungen behoben werden können (man muss nur den Gencode der Moskitos verändern und schon ist die Malaria ein für allemal ausgelöscht!), und dem kommunalen Modell, das Gesundheit für ein fortlaufendes, nicht abschließbares und universales Projekt sozialer Reformen hält, technologiearm, arbeitsintensiv und untrennbar verbunden mit Fragen des Wohnens, mit Bildung, Ernährung, Arbeit, Armut und Ungleichheit. Krankheit kennt keine Grenzen, wurde uns ein ums andere Mal erklärt, wir müssen zusammenarbeiten. Aber was heißt das? Kann die WHO der Weg sein, globale Anstrengungen zu dirigieren, oder ist sie dazu verurteilt, die Realität zu bemänteln, dass es zwischen den Nationen nur wenig Solidarität gibt? Trumps Intervention vom Mai war keine Hilfe für die WHO, und Amerikas Rückzug aus der Organisation wäre ein herber, aber nicht unerwarteter Schlag, aber etliche Regierungen dürften erleichtert gewesen sein, dass der amerikanische Präsident alle mediale Aufmerksamkeit auf sich zog, die sonst vielleicht dem größeren Versäumnis gegolten hätte, dem Fehlen weltweiter Kooperation."Amia Srinivasan räumt ein, dass sie von ihren verblendeten Eltern gelernt hat, es sei unhöflich, in Gegenwart einer Person nicht ihren Namen, sondern das Personlapronomen zu benutzen. Aber ihre Uni hat sie eines Besseren belehrt. Zuerst sollte in Seminaren nämlich die Frage geklärt werden, mit welchem Pronomen über jemanden gesprochen werden soll: Er oder sie? "Ich schickte meinen StudentInnen einen Entschuldigung. Sie akzektierten sie und wir diskutierten, wie ich in Zukunft diese Dinge besser handhaben kann. Ich werde nun jedes Semester damit beginnen, meine StudentInnen per E-Mail zu fragen, ob sie mir und den anderen Studierenden ihr bevorzugtes Pronomen nennen möchten. Es ist keine perfekte Praxis, aber ich hofffe, sie wird mir helfen, weitere Fehler zu vermeiden."
El Pais Semanal (Spanien), 30.06.2020
 "Wie wir die Generation verloren, die Spanien verändert hat": Mit einer bewegenden Reportage, die man auch als Podcast hören kann, nimmt El País Abschied von den fast 30.000 Menschen über siebzig oder gar achtzig, die der Corona-Pandemie in Spanien zum Opfer fielen: "Von der Generation, die nach dem Bürgerkrieg aufwuchs, die Diktatur durchmachte und anschließend die Hauptrolle bei der grandiosen Wiederbelebung ihres Landes übernahm. Deren Anstrengungen den gesellschaftlichen Aufstieg ihrer Kinder und Enkel ermöglichte. Deren Kampf die Grundlage für die Demokratie legte. Und die nach der Pleite von Lehman Brothers ihre Spardosen aufmachte, um ihre Kinder, Familien und die gesamte Volkswirtschaft zu unterstützen. Von all denen, die am Ende zu Hause, in Krankenhäusern oder in Altenheimen - letztere oft tödliche Fallen - allein starben, nachdem sie so viel gegeben hatten."
"Wie wir die Generation verloren, die Spanien verändert hat": Mit einer bewegenden Reportage, die man auch als Podcast hören kann, nimmt El País Abschied von den fast 30.000 Menschen über siebzig oder gar achtzig, die der Corona-Pandemie in Spanien zum Opfer fielen: "Von der Generation, die nach dem Bürgerkrieg aufwuchs, die Diktatur durchmachte und anschließend die Hauptrolle bei der grandiosen Wiederbelebung ihres Landes übernahm. Deren Anstrengungen den gesellschaftlichen Aufstieg ihrer Kinder und Enkel ermöglichte. Deren Kampf die Grundlage für die Demokratie legte. Und die nach der Pleite von Lehman Brothers ihre Spardosen aufmachte, um ihre Kinder, Familien und die gesamte Volkswirtschaft zu unterstützen. Von all denen, die am Ende zu Hause, in Krankenhäusern oder in Altenheimen - letztere oft tödliche Fallen - allein starben, nachdem sie so viel gegeben hatten."La regle du jeu (Frankreich), 29.06.2020
 Bernard-Henri Levy musste sich von französischen Internauten beschimpfen lassen, weil er in der Fernsehsendung "On n'est pas couché" dem Moderator entgegen der Corona-Etikette die Hand schüttelte. Levy könnte sich natürlich einfach für den Fauxpas entschuldigen, aber lieber hebt er an zu einer Huldigung des Handschlags in all seinen Formen. Was ginge nicht alles verloren! "Der Handschlag der Sportler, die nach dem Turnier übereinkommen: 'Es war nur ein Spiel, ein Ritual, ein fest - es ist nur Konvention, dass wir vorgeben, um Leben und Tod zu kämpfen.' Der uralte Handschlag, der seit Menschengedenken deutlich machen will, dass man unbewaffnet kommt, ohne versteckten Dolch, ohne feindliche oder kriegerische Absicht. Der brüderliche Handschlag, den die Quäker zusammen mit dem Du dem frühen amerikanischen Establishment entgegenstellten mit seiner Vorliebe für alles Zeremonielle, das Beugen der Knie und die 'Hut-Ehre'. Präsident Theodor Roosevelt, Friedensnobelpreisträger hundert Jahre vor Barack Obama, war kein Quäker, aber auch er sagte: 'Wehe dem, der seinen Mitmenschen nicht am Handschlag erkennt.' Es war der feste Wille der Französische Revolution, diese bürgerliche Geste gegen die Verbeugungen und Knickse durchzusetzen, die unter dem Ancien Regime gebräuchlich waren. Und es ist die Gleichheit von Mann und Frau, die so gezeigt wird."
Bernard-Henri Levy musste sich von französischen Internauten beschimpfen lassen, weil er in der Fernsehsendung "On n'est pas couché" dem Moderator entgegen der Corona-Etikette die Hand schüttelte. Levy könnte sich natürlich einfach für den Fauxpas entschuldigen, aber lieber hebt er an zu einer Huldigung des Handschlags in all seinen Formen. Was ginge nicht alles verloren! "Der Handschlag der Sportler, die nach dem Turnier übereinkommen: 'Es war nur ein Spiel, ein Ritual, ein fest - es ist nur Konvention, dass wir vorgeben, um Leben und Tod zu kämpfen.' Der uralte Handschlag, der seit Menschengedenken deutlich machen will, dass man unbewaffnet kommt, ohne versteckten Dolch, ohne feindliche oder kriegerische Absicht. Der brüderliche Handschlag, den die Quäker zusammen mit dem Du dem frühen amerikanischen Establishment entgegenstellten mit seiner Vorliebe für alles Zeremonielle, das Beugen der Knie und die 'Hut-Ehre'. Präsident Theodor Roosevelt, Friedensnobelpreisträger hundert Jahre vor Barack Obama, war kein Quäker, aber auch er sagte: 'Wehe dem, der seinen Mitmenschen nicht am Handschlag erkennt.' Es war der feste Wille der Französische Revolution, diese bürgerliche Geste gegen die Verbeugungen und Knickse durchzusetzen, die unter dem Ancien Regime gebräuchlich waren. Und es ist die Gleichheit von Mann und Frau, die so gezeigt wird."Guardian (UK), 29.06.2020
New Statesman (UK), 26.06.2020
 In Zeiten, da Fußball immer mehr zu einer Veranstaltung von Oligarchen und Körpernarzissten wird, freut sich Jason Cowley über die Aufstieg politisch engagierter Spielerstars wie Marcus Rashford, Raheem Sterling und Tyrone Mings: "Die neuen Aktivisten unter den Superspielern schöpfen oft aus der eigenen Erfahrung von Not und Armut, wie es zum Beispiel Marcus Rashford, der Nationalstürmer von Manchester United tat, als er sich letzte Weihnachten für Wohnungslose einsetzte oder zuletzt für eine Fortsetzung des kostenlosen Schulessens auch während der Sommerferien. Rushford wuchs als jüngstes von fünf Kinder in Wythenshawe auf, einem armen Stadtteil von Manchester, seine alleinerziehende Mutter arbeitete als Kassiererin in einem Wettbüro. Er selbst bekam kostenloses Schulessen und hat niemals vergessen, was es für ihn bedeutete. Als Antwort auf seine Kampagne - er trat in den Hauptnachrichten der BBC auf, veröffentlichte einen Artikel in der Times, schrieb einen Offenen Brief an die Regierung und twitterte energisch - kündigte Boris Johnson einen "Covid-Sommer-Essensfonds" von 120 Millionen Pfund an. Angesichts einer hochkochenden Parteirevolte polterte Johnson, dass er von Rashfords Kampagne nichts gewusst habe - als hätte es keiner seiner Berater für nötig befunden, ihn darüber zu informieren."
In Zeiten, da Fußball immer mehr zu einer Veranstaltung von Oligarchen und Körpernarzissten wird, freut sich Jason Cowley über die Aufstieg politisch engagierter Spielerstars wie Marcus Rashford, Raheem Sterling und Tyrone Mings: "Die neuen Aktivisten unter den Superspielern schöpfen oft aus der eigenen Erfahrung von Not und Armut, wie es zum Beispiel Marcus Rashford, der Nationalstürmer von Manchester United tat, als er sich letzte Weihnachten für Wohnungslose einsetzte oder zuletzt für eine Fortsetzung des kostenlosen Schulessens auch während der Sommerferien. Rushford wuchs als jüngstes von fünf Kinder in Wythenshawe auf, einem armen Stadtteil von Manchester, seine alleinerziehende Mutter arbeitete als Kassiererin in einem Wettbüro. Er selbst bekam kostenloses Schulessen und hat niemals vergessen, was es für ihn bedeutete. Als Antwort auf seine Kampagne - er trat in den Hauptnachrichten der BBC auf, veröffentlichte einen Artikel in der Times, schrieb einen Offenen Brief an die Regierung und twitterte energisch - kündigte Boris Johnson einen "Covid-Sommer-Essensfonds" von 120 Millionen Pfund an. Angesichts einer hochkochenden Parteirevolte polterte Johnson, dass er von Rashfords Kampagne nichts gewusst habe - als hätte es keiner seiner Berater für nötig befunden, ihn darüber zu informieren."Novinky.cz (Tschechien), 26.06.2020
Weitere Stimmen: Ondřej Slačálek urteilt in a2larm.cz übrigens noch gnadenloser: Er wirft dem Autor Boulevardjournalimus und gar alte Methoden der Staatssicherheit vor, nämlich die Missachtung der Intimsphäre. Jana Machalická schreibt in den Lidové noviny über den Rummel vor der Veröffentlichung: "Was bisher über das Buch, und damit über Kundera geschrieben wurde, sagt vor allem etwas über uns selbst aus, über unsere gespaltene Gesellschaft und unsere Schwarz-Weiß-Sicht." Den Inhalt des Buchs kann sie nicht ernstnehmen. Geradezu komisch sei Nováks Aussage, Kundera schreibe so authentisch übers Denunziantentum, dass er das selbst durchlebt haben müsse - als gäbe es nicht so eine Kategorie wie schriftstellerisches Können. Ihr Fazit: "So viel Arbeit, so viele Seiten, und doch so wenig über den wirklichen Kundera. Über seine lebenslange Zurückgezogenheit, den Fluch, sich von anderen abzusondern, über seine Überempfindlicheit. Auch nichts über das Thema des Mitleids, das in seinem Werk so besonders durchscheint. Kundera ist nicht unkritisierbar, aber so einen gnadenlosen Beschuss mit Mist, wie Pavel Kosatík treffend auf Facebook schreibt, hat er nicht verdient."
Magyar Narancs (Ungarn), 25.06.2020
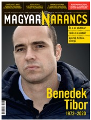 Der Schriftsteller László Márton übersetzte unter anderem Goethes "Faust" und das gesamte literarische Werk von Walther von der Vogelweide. Zuletzt übertrug er das Nibelungenlied ins Ungarisch. Im Interview mit Anita Markó spricht Márton über seine Arbeit: Die mittelalterliche deutsche Literatur interessiert mich besonders, weil ich ein modernes schriftstellerisches Problem hinter der Aufgabe der Übersetzung sehe und weil ich das zu übersetzende Werk für einen Vorläufer eines modernen Genres halte. Bei Walther von der Vogelweide zum Beispiel musste neben der Übersetzung des gesamten erhaltenen lyrischen Lebenswerks auch die Figur des Dichters konstruiert werden, was weit über die Übersetzungstätigkeit hinaus läuft ... Das Ziel ist, dass der Text als literarisches Werk auf Ungarisch erklingt. Es soll als Teil der lebendigen Literatur sein und kein Museumsobjekt. Das kann nur dann gelingen, wenn wir das Konzept und Gedankengang des Autors rekonstruieren können, wenn wir mit ihm in Dialog treten können und wir all dies auch in dem ungarischen Text erscheinen lassen können."
Der Schriftsteller László Márton übersetzte unter anderem Goethes "Faust" und das gesamte literarische Werk von Walther von der Vogelweide. Zuletzt übertrug er das Nibelungenlied ins Ungarisch. Im Interview mit Anita Markó spricht Márton über seine Arbeit: Die mittelalterliche deutsche Literatur interessiert mich besonders, weil ich ein modernes schriftstellerisches Problem hinter der Aufgabe der Übersetzung sehe und weil ich das zu übersetzende Werk für einen Vorläufer eines modernen Genres halte. Bei Walther von der Vogelweide zum Beispiel musste neben der Übersetzung des gesamten erhaltenen lyrischen Lebenswerks auch die Figur des Dichters konstruiert werden, was weit über die Übersetzungstätigkeit hinaus läuft ... Das Ziel ist, dass der Text als literarisches Werk auf Ungarisch erklingt. Es soll als Teil der lebendigen Literatur sein und kein Museumsobjekt. Das kann nur dann gelingen, wenn wir das Konzept und Gedankengang des Autors rekonstruieren können, wenn wir mit ihm in Dialog treten können und wir all dies auch in dem ungarischen Text erscheinen lassen können."Aktualne (Tschechien), 25.06.2020
New York Magazine (USA), 26.06.2020
 Dass die amerikanischen K-Pop-Fans für politischen Trubel sorgen - erst haben sie einen von Rassisten verwendeten Twitter-Hashtag gekapert, dann eine Trump-Kundgebung so sabotiert, dass der Präsident vor einer halbleeren Halle sprach -, hätte man durchaus kommen sehen können, meint T.K. Park. Stattdessen reagierten weite Teile der Öffentlichkeit mit völliger Überforderung und blanker Unkenntnis der Materie. Aber woher kommt dieser hohe Grad an Online-Kompetenz gerade in diesem an sich wenig politischen Segment der Popkultur? Zum einen erfahren wir, dass in den USA tatsächlich viele Schwarze Jugendliche diese Musik hören und das Media-Hacking quasi zum Alltag dazugehört: "Fan einer angesagten K-Pop-Gruppe zu sein verlangt einem mehr ab als, sagen wir, Fan von Taylor Swift zu sein ... Jede K-Pop-Band kommt mit einer Reihe vorgefertigen Kennzeichen für die Fans: Spitznamen für die Unterstützer (BTS hat seine 'Army', Blackpink nennt sie Blinks), Farben (die Farbe von NCT ist 'perliges Neo-Champagner'), Hymnen und Slogans. Jede Fangemeinde fordert ihre jeweiligen Anhänger zu koordinierten Aktionen auf, um ihre Stars zu unterstützen, etwa massenhaft bei Radiosendern anzurufen, sich ein bestimmtes Lied zu wünschen, oder abgesprochenes Streaming bestimmter Stücke zu einer bestimmten Zeit - alles, um die Chartposition der Stars zu verbessern. Um das Image ihrer Stars aufzupolieren, organisieren die Fanclubs Spendenaufrufe und andere ehrenamtliche Dienste in deren Namen. Wichtig ist dabei: All diese Aktivitäten kommen ohne herausragende Prsonen oder Hierarchien aus. Vielmehr entfalten sie sich horizontal durch Echtzeit-Kommunikation auf Sozialen Netzwerken. Unter dem Strich steht damit eine partizipatorische Erfahrung von Popkultur. Eine K-Pop-Fangruppe liebt ihre Stars nicht nur für ihre Musik, ihr Aussehen oder ihre Choreografie, obwohl das alles häufig notwendige Voraussetzungen sind. Die engagiertesten K-Pop-Fans kultivieren mit ihrem Zeit- und Energieaufwand zugunsten ihrer Stars ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu ihren Stars und, noch wichtiger, untereinander. Als Kollektiv prägt die Fangruppe den Weg des Idols zum Star - der Erfolg des Idols ist auch der Erfolg der Fans."
Dass die amerikanischen K-Pop-Fans für politischen Trubel sorgen - erst haben sie einen von Rassisten verwendeten Twitter-Hashtag gekapert, dann eine Trump-Kundgebung so sabotiert, dass der Präsident vor einer halbleeren Halle sprach -, hätte man durchaus kommen sehen können, meint T.K. Park. Stattdessen reagierten weite Teile der Öffentlichkeit mit völliger Überforderung und blanker Unkenntnis der Materie. Aber woher kommt dieser hohe Grad an Online-Kompetenz gerade in diesem an sich wenig politischen Segment der Popkultur? Zum einen erfahren wir, dass in den USA tatsächlich viele Schwarze Jugendliche diese Musik hören und das Media-Hacking quasi zum Alltag dazugehört: "Fan einer angesagten K-Pop-Gruppe zu sein verlangt einem mehr ab als, sagen wir, Fan von Taylor Swift zu sein ... Jede K-Pop-Band kommt mit einer Reihe vorgefertigen Kennzeichen für die Fans: Spitznamen für die Unterstützer (BTS hat seine 'Army', Blackpink nennt sie Blinks), Farben (die Farbe von NCT ist 'perliges Neo-Champagner'), Hymnen und Slogans. Jede Fangemeinde fordert ihre jeweiligen Anhänger zu koordinierten Aktionen auf, um ihre Stars zu unterstützen, etwa massenhaft bei Radiosendern anzurufen, sich ein bestimmtes Lied zu wünschen, oder abgesprochenes Streaming bestimmter Stücke zu einer bestimmten Zeit - alles, um die Chartposition der Stars zu verbessern. Um das Image ihrer Stars aufzupolieren, organisieren die Fanclubs Spendenaufrufe und andere ehrenamtliche Dienste in deren Namen. Wichtig ist dabei: All diese Aktivitäten kommen ohne herausragende Prsonen oder Hierarchien aus. Vielmehr entfalten sie sich horizontal durch Echtzeit-Kommunikation auf Sozialen Netzwerken. Unter dem Strich steht damit eine partizipatorische Erfahrung von Popkultur. Eine K-Pop-Fangruppe liebt ihre Stars nicht nur für ihre Musik, ihr Aussehen oder ihre Choreografie, obwohl das alles häufig notwendige Voraussetzungen sind. Die engagiertesten K-Pop-Fans kultivieren mit ihrem Zeit- und Energieaufwand zugunsten ihrer Stars ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu ihren Stars und, noch wichtiger, untereinander. Als Kollektiv prägt die Fangruppe den Weg des Idols zum Star - der Erfolg des Idols ist auch der Erfolg der Fans."