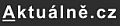
Petr Zidek
bespricht die (auch auf Englisch erschienene)
Monografie des slowakischen Historikers
Michal Kšiňan über den slowakischen Abenteurer und Mitbegründer der Tschechoslowakei
Milan Rastislav Štefánik. Štefánik, der nach einer Fernsehumfrage aus dem Jahr 2019 als "größter Slowake" gilt, erweist sich auch in der historischen Analyse als eine Figur wie aus einem Jules-Verne-Roman, die alle Normen gesprengt habe, meint Kšiňan. "Seine Expeditionen machten ihn zu einem der
meistgereisten Europäer seiner Zeit. Neben vielen europäischen Ländern besuchte er Tahiti, Neuseeland, das heutige Turkmenistan, Algerien und Tunesien, Brasilien, Ecuador, Russland, die Vereinigten Staaten, Fidschi und Panama. Er war der erste Tschechoslowake, der 1905 den Mont Blanc bestieg. Dabei schleppte er für das Observatorium, an dem er arbeitete, schwere Teleskopteile auf den Gipfel. In den Folgejahren bestieg er Europas höchsten Berg weitere fünf Male und verbrachte unglaubliche 46 Tage auf dem Gipfel - obwohl er unter schweren gesundheitlichen Problemen litt." Als Erfinder habe er nicht nur
astronomische Instrumente verbessert, sondern "ließ sich zum Beispiel auch eine
selbsttätige Straßenbahnweiche, einen neuartigen
Schnallentyp und eine Vorrichtung patentieren, mit der man gleichzeitig fotografieren und Bilder projizieren konnte." Im Jahr 1912 nahm er die französische Staatsbürgerschaft an, und während des Ersten Weltkriegs agierte er zugleich als französischer Offizier und als politischer Vertreter des tschechoslowakischen Auslandswiderstands. Nachdem Štefánik im Dezember 1915
Edvard Beneš kennengelernt hatte, stellte er sich in den Dienst der antiösterreichischen Bewegung. Vor allem als Türöffner sei er von unschätzbarem Wert, so Rezensent Zidek, denn im Februar 1916 habe er Masaryks erste Audienz beim französischen Premierminister Aristide Briand arrangiert. Ein Brief Štefániks an Masaryk, "in dem er gegen ein republikanisches Modell (er selbst wollte eine Monarchie mit einem
Monarchen aus der italienischen Dynastie an der Spitze) und sogar gegen das Frauenwahlrecht protestiert, lässt jedoch darauf schließen, dass er konservativer war als die beiden anderen Gründerväter [Masaryk und Beneš] der Tschechoslowakei", so das Fazit von Petr Jidek. Wäre Štefánik 1919 nicht bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen (was seinen Mythos als moderner Held erst richtig begründete), "wäre die Geschichte des Staates, den er mit aus der Taufe gehoben hatte, wahrscheinlich anders verlaufen. Doch die Frage ist, ob er dann für die Slowaken der
unbestrittene Universalheld sein würde, als der er heute gilt."