Magazinrundschau
Unerwartete Intrigen
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
17.12.2019. Bloomberg stürzt sich auf Madagaskar in den unglaublich wilden Markt für Vanilleschoten. Der Historiker Stefano Bottoni sieht Ungarn Richtung Asien rücken. John Lanchester sieht ein Warnschild und verliert seine Angst vor der Macht der chinesischen Regierung. Die Historikerin Christelle Taraud erklärt, wie Prostitution ins Zentrum von Machtstrukturen führt. Der Guardian amüsiert sich mit einem prehistoric man. Roberto Saviano erklärt, wie die Mafia küsst. Harper's begibt sich im Dark web auf den Markt für Mord.
Bloomberg Businessweek (USA), 16.12.2019
 Monte Reel stürzt sich für eine Reportage in den Markt für Vanilleschoten in Madagaskar und lernt dabei einiges über den globalen Kapitalismus. "Die regionalen Märkte folgen einem etablierten Protokoll, erklärten die Männer. Nach dem Wiegen der Schoten versammeln sich die Bauern, überlegen sich einen Preis pro Kilo und schreiben diese Zahl auf die Tafel. Die Käufer starren eine Weile auf die Zahl, dann kauern sie sich zusammen. Sie löschen den Preis der Bauern aus und schreiben ein Gegenangebot. Dieses Hin und Her wird wiederholt, bis die Zahlen übereinstimmen. Wenn das passiert, teilen die Käufer die Schoten auf. Der Prozess kann einen Tag oder eine Woche dauern. ... Dieser besondere Verkauf war von keinem ungewöhnlichen Ereignis gezeichnet. Aber es gab viele unerwartete Intrigen und Täuschungen. Das Geschäft ist grausam, menschlich, komisch, tragisch, genial und absolut verrückt, oft alles zur gleichen Zeit. Während wir versuchten das Drama zu entwirren, begannen wir zu begreifen, dass unser ursprüngliches Ziel, den Vanillehandel zu verstehen, zweitrangig war. Wichtiger schien es, dieses ganze Geschäft einfach in einer bestimmten Weise zu beobachten: mit einer nachhaltigen Wertschätzung dafür, wie unglaublich wild der Welthandel auf seiner elementarsten Ebene tatsächlich ist."
Monte Reel stürzt sich für eine Reportage in den Markt für Vanilleschoten in Madagaskar und lernt dabei einiges über den globalen Kapitalismus. "Die regionalen Märkte folgen einem etablierten Protokoll, erklärten die Männer. Nach dem Wiegen der Schoten versammeln sich die Bauern, überlegen sich einen Preis pro Kilo und schreiben diese Zahl auf die Tafel. Die Käufer starren eine Weile auf die Zahl, dann kauern sie sich zusammen. Sie löschen den Preis der Bauern aus und schreiben ein Gegenangebot. Dieses Hin und Her wird wiederholt, bis die Zahlen übereinstimmen. Wenn das passiert, teilen die Käufer die Schoten auf. Der Prozess kann einen Tag oder eine Woche dauern. ... Dieser besondere Verkauf war von keinem ungewöhnlichen Ereignis gezeichnet. Aber es gab viele unerwartete Intrigen und Täuschungen. Das Geschäft ist grausam, menschlich, komisch, tragisch, genial und absolut verrückt, oft alles zur gleichen Zeit. Während wir versuchten das Drama zu entwirren, begannen wir zu begreifen, dass unser ursprüngliches Ziel, den Vanillehandel zu verstehen, zweitrangig war. Wichtiger schien es, dieses ganze Geschäft einfach in einer bestimmten Weise zu beobachten: mit einer nachhaltigen Wertschätzung dafür, wie unglaublich wild der Welthandel auf seiner elementarsten Ebene tatsächlich ist."In den letzten fünf Jahren haben sich ein Viertel der Amerikaner Sprachassistenten wie Alexa, Echo, Google Home oder Apple HomePod zugelegt. Seitdem sitzen Tausende Mitarbeiter der Techfirmen irgendwo zu Hause oder in "Übersetzungsfarmen" und transkribieren die mitgehörten Passagen, berichten Austin Carr, Matt Day, Sarah Frier und Mark Gurman in einem Artikel des Magazins. Angeblich geschieht dies, um das Angebot zu verbessern. "Die Frage ist, was dann? Diese Maschinen erstellen zwar keine Audiodateien von jedem Wort, dass Sie sagen - Technologiefirmen behaupten, ihre intelligenten Lautsprecher würden Audio nur dann aufnehmen, wenn Benutzer sie aktivieren - aber sie nutzen ständig aktive Mikrofone in Küchen und Schlafzimmern, die Geräusche aufnehmen können, die Benutzer nie teilen wollten. 'Mikrofone zu haben, die die ganze Zeit zuhören, ist beunruhigend. Wir haben festgestellt, dass die Benutzer dieser Geräte ihre Augen schließen und darauf vertrauen, dass Unternehmen mit ihren aufgezeichneten Daten nichts Schlechtes tun werden', sagt Florian Schaub, Professor an der University of Michigan, der das menschliche Verhalten rund um die Sprachsteuerung untersucht. 'Es gibt diese schleichende Erosion der Privatsphäre, die immer weitergeht. Die Leute wissen nicht, wie sie sich selbst schützen können.'" Oder wohl eher: Sie sehen die Notwendigkeit dafür nicht.
Magyar Narancs (Ungarn), 14.11.2019
 Stefano Bottoni, ein Historiker mit italienischen und ungarischen Vorfahren, war bis Mitte des Jahres wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA). Nach der Ausgliederung der kritischen wissenschaftlichen Kollegien der Akademie durch die Regierung nahm Bottoni einen Ruf der Universität Florenz in Italien an. Dort erschien vor kurzem seine historisch-soziologische Abhandlung über die Entstehung von Viktor Orbans sogenanntem "System der nationalen Kooperation": "Orbán - Un despota in Europa" (mehr hier). Im Gespräch mit Ferenc M. László sagt er: "Wenn wir anerkennen, dass wir es mit einem regionalen Phänomen nach 1990 zu tun haben, dann wurde in gewisser Hinsicht tatsächlich die Idee aufgegeben, dass Ungarns Platz im Westen ist. ... Orban hat verstanden, wie er gleichzeitig drinnen und draußen sein kann. Er weiß, dass die ungarische Gesellschaft westliche Sehnsüchte und Attitüden hat und er erkannte frühzeitig - was man im Westen jetzt erst langsam begreift -, dass er sein System ohne EU-Gelder nicht aufrechterhalten kann. Darauf baut das ganze wirtschaftliche Hinterland seiner Partei. Pfauentanz, könnten wir sagen. Aber es wäre ein Fehler zu glauben, dass dies die Essenz seines Systems sei: die Unterordnung der Prinzipien unter die Interessen. Es wird immer öfter darüber gesprochen, dass die Ungarn ein halb-asiatisches Volk seien. Auf der Ebene der Rhetorik entfernen wir uns immer weiter vom Westen."
Stefano Bottoni, ein Historiker mit italienischen und ungarischen Vorfahren, war bis Mitte des Jahres wissenschaftlicher Mitarbeiter an der ungarischen Akademie der Wissenschaften (MTA). Nach der Ausgliederung der kritischen wissenschaftlichen Kollegien der Akademie durch die Regierung nahm Bottoni einen Ruf der Universität Florenz in Italien an. Dort erschien vor kurzem seine historisch-soziologische Abhandlung über die Entstehung von Viktor Orbans sogenanntem "System der nationalen Kooperation": "Orbán - Un despota in Europa" (mehr hier). Im Gespräch mit Ferenc M. László sagt er: "Wenn wir anerkennen, dass wir es mit einem regionalen Phänomen nach 1990 zu tun haben, dann wurde in gewisser Hinsicht tatsächlich die Idee aufgegeben, dass Ungarns Platz im Westen ist. ... Orban hat verstanden, wie er gleichzeitig drinnen und draußen sein kann. Er weiß, dass die ungarische Gesellschaft westliche Sehnsüchte und Attitüden hat und er erkannte frühzeitig - was man im Westen jetzt erst langsam begreift -, dass er sein System ohne EU-Gelder nicht aufrechterhalten kann. Darauf baut das ganze wirtschaftliche Hinterland seiner Partei. Pfauentanz, könnten wir sagen. Aber es wäre ein Fehler zu glauben, dass dies die Essenz seines Systems sei: die Unterordnung der Prinzipien unter die Interessen. Es wird immer öfter darüber gesprochen, dass die Ungarn ein halb-asiatisches Volk seien. Auf der Ebene der Rhetorik entfernen wir uns immer weiter vom Westen."London Review of Books (UK), 19.12.2019
 Verbunden mit Erinnerungen an das Hongkong seiner Kindheit berichtet John Lanchester von seiner Reise in die Stadt, in der auch dicke Schwaden von Tränengas den Hongkonger Spirit nicht überdecken können. Und noch eine Schwäche ist ihm klargeworden, als er am Flughafen die Schilder sah, mit denen die Ausfuhr von Milchpulver verboten wurde: "Wenn man im Internet liest, scheint es, als würden Festlandchinesen die Protestler allesamt für verdorbene, undankbare Kinder halten, manipuliert von ausländischen Akteuren. Aber wenn ich das zur Sprache bringe, schneiden mir die Hongkonger das Wort ab. 'Wir wissen nicht, was die Chinesen denken. Du kannst nicht nach dem gehen, was im Internet steht.' Das ist Konsens in Hongkong. Die kommunistische Partei hat das Netz komplett übernommen, und jeder weiß, dass man die Trolle nicht ernst nehmen kann. Da aber die KPC auf das Netz angewiesen ist, um zu verkünden, was die Menschen denken sollen, heißt es eigentlich, dass das Internet vom Standpunkt der Partei nicht mehr funktioniert... Ein kommunistisch-autoritärer Staat, der davon träumt, ein System technokratischer Totalkontrolle zu errichten, aber nicht mal Nahrungsmittel für Babies rein halten kann. Ich habe in den vergangenen Monaten so viel und düster über diesen Traum der KPC vom KI-getriebenen autoritär-technokratischen Staat nachgedacht. Aber der Flughafen war ein wichtiges Korrektiv. Wenn die Partei allwissend und allmächtig ist, wer ist dann schuld am verseuchten Milchpulver? Wenn sie nicht einmal Milchpulver sauber halten können, wie stehen dann die Chancen, dass sie kontrollieren können, wie die Menschen denken und handeln, in einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern und keinem funktionierenden Mechanismus, um Unzufriedenheit zu äußern?"
Verbunden mit Erinnerungen an das Hongkong seiner Kindheit berichtet John Lanchester von seiner Reise in die Stadt, in der auch dicke Schwaden von Tränengas den Hongkonger Spirit nicht überdecken können. Und noch eine Schwäche ist ihm klargeworden, als er am Flughafen die Schilder sah, mit denen die Ausfuhr von Milchpulver verboten wurde: "Wenn man im Internet liest, scheint es, als würden Festlandchinesen die Protestler allesamt für verdorbene, undankbare Kinder halten, manipuliert von ausländischen Akteuren. Aber wenn ich das zur Sprache bringe, schneiden mir die Hongkonger das Wort ab. 'Wir wissen nicht, was die Chinesen denken. Du kannst nicht nach dem gehen, was im Internet steht.' Das ist Konsens in Hongkong. Die kommunistische Partei hat das Netz komplett übernommen, und jeder weiß, dass man die Trolle nicht ernst nehmen kann. Da aber die KPC auf das Netz angewiesen ist, um zu verkünden, was die Menschen denken sollen, heißt es eigentlich, dass das Internet vom Standpunkt der Partei nicht mehr funktioniert... Ein kommunistisch-autoritärer Staat, der davon träumt, ein System technokratischer Totalkontrolle zu errichten, aber nicht mal Nahrungsmittel für Babies rein halten kann. Ich habe in den vergangenen Monaten so viel und düster über diesen Traum der KPC vom KI-getriebenen autoritär-technokratischen Staat nachgedacht. Aber der Flughafen war ein wichtiges Korrektiv. Wenn die Partei allwissend und allmächtig ist, wer ist dann schuld am verseuchten Milchpulver? Wenn sie nicht einmal Milchpulver sauber halten können, wie stehen dann die Chancen, dass sie kontrollieren können, wie die Menschen denken und handeln, in einem Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern und keinem funktionierenden Mechanismus, um Unzufriedenheit zu äußern?"Eher als ein Buch für Fans denn als ernsthafte Autobiografie liest Jenny Turner Debbie Harrys "Face it", findet aber einige ganz erhellende Passagen darin. Toll an Debbie Harry bei Blondie war, dass sie so süß und püppchenhaft aussehen und klingen konnte, dabei war sie offenkundig und, ohne es zu verbergen, eine Frau mit Vergangenheit."
Eurozine (Österreich), 04.12.2019
 Das von Christelle Taraud mit herausgegebene Buch "Sexe, race & colonies - La domination des corps du XVe siècle à nos jours" hat in Frankreich riesiges Aufsehen erregt - Libération hat sogar eine Titelgeschichte zu dieser Aufarbeitung der Prostitution in den ehemaligen Kolonien gebracht. Das Buch ist auch umstritten, weil es Hunderte von historischen Fotos dokumentiert, die Frauen aus den Kolonien in erotischen Posen zeigen. Aber das Bildmaterial ist wichtig für die historische Lektüre, sagt Taraud im Gespräch mit dem Green European Journal, das von Eurozine übernommen wird. Prostitution, insistiert Taraud im übrigen, ist kein Randphänomen, sondern führt ins Zentrum von Machtstrukturen in einer Gesellschaft: "In kolonialer Prostitution wird dies noch verstärkt, da Prostituierte extremer Herrschaft ausgesetzt sind. Wir können nicht so tun, als ginge es hier nur um Sex: Es ist eine Staatsangelegenheit. Algerien etwa war seit dem Zeitalter der Phönizier fast immer besetzt. Seit 1830 aber war das Hauptcharakteristikum der Kolonisierung eine nie dagewesene Monopolisierung der Frauen. Dies ist umso wichtiger angesichts einer massiv patriarchalischen Gesellschaft, die männliche Ehre nach der Kontrolle über Frauen bemisst. Frauen wurden von beiden Seiten genutzt, um Machtverhältnisse auszutarieren."
Das von Christelle Taraud mit herausgegebene Buch "Sexe, race & colonies - La domination des corps du XVe siècle à nos jours" hat in Frankreich riesiges Aufsehen erregt - Libération hat sogar eine Titelgeschichte zu dieser Aufarbeitung der Prostitution in den ehemaligen Kolonien gebracht. Das Buch ist auch umstritten, weil es Hunderte von historischen Fotos dokumentiert, die Frauen aus den Kolonien in erotischen Posen zeigen. Aber das Bildmaterial ist wichtig für die historische Lektüre, sagt Taraud im Gespräch mit dem Green European Journal, das von Eurozine übernommen wird. Prostitution, insistiert Taraud im übrigen, ist kein Randphänomen, sondern führt ins Zentrum von Machtstrukturen in einer Gesellschaft: "In kolonialer Prostitution wird dies noch verstärkt, da Prostituierte extremer Herrschaft ausgesetzt sind. Wir können nicht so tun, als ginge es hier nur um Sex: Es ist eine Staatsangelegenheit. Algerien etwa war seit dem Zeitalter der Phönizier fast immer besetzt. Seit 1830 aber war das Hauptcharakteristikum der Kolonisierung eine nie dagewesene Monopolisierung der Frauen. Dies ist umso wichtiger angesichts einer massiv patriarchalischen Gesellschaft, die männliche Ehre nach der Kontrolle über Frauen bemisst. Frauen wurden von beiden Seiten genutzt, um Machtverhältnisse auszutarieren."Guardian (UK), 16.12.2019

Vor allem als Gegengift zum überbordenen Narzissmus der Selfie-Gesellschaft empfindet Barbara Ehrenreich die prähistorische Höhlenmalerei, die in geradezu übernatürlicher Genauigkeit die Welt der Fleisch- und Pflanzenfresser an die Wände projizierte und den Menschen als kleine Strichfigur an den Rand drängte. Welche Wohltat! "Es war ein Moment von 'großer spiritueller Symbolik', proklamierte ein berühmter Kunsthistoriker, als der Mensch aus seiner rein zoologischen Exitenz heraustrat und begann, das Tier zu beherrschen, statt von ihm beherrscht zu werden. Die Strichmännchen in den Höhlen von Lascaux und Chauvet strahlen keinen Triumph aus. Nach heutigen Maßstäben sind sie von exzessiver Bescheidenheit und verglichen mit den porträtierten Tieren um sie herum schrecklich schwach. Ob diese gesichtslosen Schöpfungen triumphierend grinsen sollten, können wir nicht wissen. Wir haben einen spärlichen Hinweis darauf, wie die Höhlenkünstler ihren eigenen Status im steinzeitlichen Universum empfunden haben. Während Archäologen prähistorische Kunst als 'magisch-religiös' oder 'schamanisch' feierten, entdecken heute eher säkulare Betrachter einen Hauch von blanker Albernheit. Indiens mittelsteinzeitliche Felsenkunst zum Beispiel zeigt wenige menschliche Strichmännchen; wer sie gesehen hat, beschreibt sie als komisch, tierähnlich oder grotesk. Oder nehmen wir das berühmte Vogelmenschen-Bild von Lascaux, auf dem eine Figur mit einer langen dünnen Erektion beim Anblick eines Bisons hintenüber fällt. Ganz im Sinne des magisch-religiösen Paradigmas schrieb Joseph Campbell: 'Ein riesiger Bisonbulle, von einem Speer durchbohrt, der durch den Anus ein- und seine Sexualorgane wieder austritt, steht vor einem ausgestreckten Mann. Dieser - die einzige schlicht gemalte Figur und die einzige menschliche Gestalt in der Höhle - ist von einer schamanischen Trance ergriffen. Er trägt eine Vogelmaske, sein eregierter Phallus zeigt auf den aufgespießten Bullen; ein Wurfholz liegt auf dem Boden zu seinen Füßen; und daneben ein Stab, der an der Spitze das Bild eines Vogels trägt. Und hinter diesem ausgetreckten Schamanen sehen wir ein großes Nashorn, das sich defäkierend abwendet."
La regle du jeu (Frankreich), 16.12.2019
 In Nigeria findet vor den Augen einer wie stets indifferenten Weltöffentlichkeit ein Morden statt, über das Bernard-Henri Lévy in der Pariser Zeitschrift Paris Match berichtet (online steht sein Text in La Règle du Jeu). Milizen der Fulani, auch Peul genannt, richten - immer mit einem Koran-Vers auf den Lippen - entsetzliche Massaker an Christen des Landes an, besonders im "Mittelgürtel" des Landes, dessen Regionen den Norden vom Süden trennen. Armee und Polizei greifen nicht ein: "'Wer sollte sich darüber wundern', fragt Dalyop Solomon Mwantiri, einer der wenigen Anwälte der Region, die sich für die Opfer einsetzen. Der Generalstab der nigerianischen Armee gehört selbst den Fulani an. In der Verwaltung gibt es starke Gruppen von Fulani. Und Präsident Mohammadu Buhari, diese afrikanische Mischung aus Erdogan und Mohammed Bin Salman, der das Land schon von 1983 bis 85 nach einem Staatstreich regierte und der heute dank der Subventionen aus Ankara, Katar und der Chinesen überlebt, ist selbst ein Fulani."
In Nigeria findet vor den Augen einer wie stets indifferenten Weltöffentlichkeit ein Morden statt, über das Bernard-Henri Lévy in der Pariser Zeitschrift Paris Match berichtet (online steht sein Text in La Règle du Jeu). Milizen der Fulani, auch Peul genannt, richten - immer mit einem Koran-Vers auf den Lippen - entsetzliche Massaker an Christen des Landes an, besonders im "Mittelgürtel" des Landes, dessen Regionen den Norden vom Süden trennen. Armee und Polizei greifen nicht ein: "'Wer sollte sich darüber wundern', fragt Dalyop Solomon Mwantiri, einer der wenigen Anwälte der Region, die sich für die Opfer einsetzen. Der Generalstab der nigerianischen Armee gehört selbst den Fulani an. In der Verwaltung gibt es starke Gruppen von Fulani. Und Präsident Mohammadu Buhari, diese afrikanische Mischung aus Erdogan und Mohammed Bin Salman, der das Land schon von 1983 bis 85 nach einem Staatstreich regierte und der heute dank der Subventionen aus Ankara, Katar und der Chinesen überlebt, ist selbst ein Fulani."New York Review of Books (USA), 19.12.2019
 Roberto Saviano erklärt in einem langen Artikel die Symbole, deren sich verschiedene Mafiaorganisationen bedienen, um ihre Macht zu demonstrieren. Dazu zählt der Kuss: "Bei der Cosa Nostra beispielsweise bestätigt ein Kuss auf die Stirn die Wahl eines neuen Chefs. Im Jahr 2015 wurde der alte Palermo-Chef Salvatore Profeta von den Strafverfolgungsbehörden erwischt und küsste die Stirn von Giuseppe Greco, dem neuen Paten, der bei den bevorstehenden 'Wahlen' Bezirkschef werden will. Mit diesem Kuss gab er sein Placet und zeigte seine öffentliche Unterstützung für die Kandidatur des neuen Chefs. In der Camorra - der neapolitanischen Mafia - wurden in jüngster Zeit mehrere Mitarbeiter beobachtet, die unmittelbar nach ihrer Verhaftung auf die Lippen geküsst wurden. Oft ist es ein anderer Mann - ein Sohn, ein Bruder, ein Schwager, eine rechte Hand, die den verhafteten Mann küsst, und dieser Kuss versiegelt seine Lippen und verspricht der Welt, dass er nicht reden wird, nicht zum Zeugen des Staates werden wird. Die Person, die den Kuss gibt, ist der Garant des Pfandes: Würde der Gefangene sprechen, wäre er der erste, der den Preis zu zahlen hätte, also die Person (immer jemand, der dem Gefangenen lieb ist), die ihn geküsst hat."
Roberto Saviano erklärt in einem langen Artikel die Symbole, deren sich verschiedene Mafiaorganisationen bedienen, um ihre Macht zu demonstrieren. Dazu zählt der Kuss: "Bei der Cosa Nostra beispielsweise bestätigt ein Kuss auf die Stirn die Wahl eines neuen Chefs. Im Jahr 2015 wurde der alte Palermo-Chef Salvatore Profeta von den Strafverfolgungsbehörden erwischt und küsste die Stirn von Giuseppe Greco, dem neuen Paten, der bei den bevorstehenden 'Wahlen' Bezirkschef werden will. Mit diesem Kuss gab er sein Placet und zeigte seine öffentliche Unterstützung für die Kandidatur des neuen Chefs. In der Camorra - der neapolitanischen Mafia - wurden in jüngster Zeit mehrere Mitarbeiter beobachtet, die unmittelbar nach ihrer Verhaftung auf die Lippen geküsst wurden. Oft ist es ein anderer Mann - ein Sohn, ein Bruder, ein Schwager, eine rechte Hand, die den verhafteten Mann küsst, und dieser Kuss versiegelt seine Lippen und verspricht der Welt, dass er nicht reden wird, nicht zum Zeugen des Staates werden wird. Die Person, die den Kuss gibt, ist der Garant des Pfandes: Würde der Gefangene sprechen, wäre er der erste, der den Preis zu zahlen hätte, also die Person (immer jemand, der dem Gefangenen lieb ist), die ihn geküsst hat."epd Film (Deutschland), 22.11.2019
 Natürlich hat auch Georg Seeßlen den neuen, den Haupterzählstrang der "Star Wars"-Saga fürs Erste angeblich abschließenden Teil der Geschichte rund um den "Krieg der Sterne" noch nicht gesehen. Das hindert ihn aber nicht, in einem Essay über die mittlerweile drei Trilogien umfassende Space Opera auf Grundsätzliches zu sprechen zu kommen: Bildeten die ursprünglichen drei Filme aus den 70er- und 80er-Jahren noch "eine neue Form des Kinos", bei der man "dem Auseinanderfallen des Kino-Epos in seine Bestandteile" zusehen konnte, und bildete die zweite Trilogie um 2000 noch eine Konsolidierung altmodischen Blockbustererzählens, so treffen die neuen Filme aus den letzten Jahren auf die veränderten Rahmenbedingungen eines Blockbuster-Kinos, für die das Franchise einst selbst die Voraussetzungen geschafft hatte. Die Blockbuster seit dem Siegeszug der Marvel-Filme um 2010 "hatten etwas erreicht, was 'Star Wars' mit seinem archetypischen Erzählen nicht gelingen konnte: eine neue Subjektivität. Hier war es immer um die großen Unterscheidungen gegangen, gut und böse, hell und dunkel, richtig und falsch. Längst aber ging es darum, dass diese Unterscheidungen so einfach nicht mehr zu treffen sind, auch im Kino nicht, auch für Kinder nicht. Und selbst bei der Metatraumfabrik Disney nicht mehr, die 'Star Wars' in ihren gewaltigen Korpus an Bildwelten einverleibte. Worum es bei der dritten Trilogie also ging, war, wieder offenere und dynamischere Charaktere zu schaffen (wozu sich die Rebellion mit nicht ganz festgelegtem Ausgang und verschiedenen Figuren dazwischen durchaus anbot), zweitens wieder zu einem mehr subjekt- und emotionsbezogenen Erzählen zu gelangen und drittens neue Spannungsmomente zu erzeugen, die aus der Überkonstruktion des Handlungsbogens hinausführten. ... Aus einer geschlossenen soll eine offene Erzählung werden. Ein ständig sich selbst erneuerndes Bild- und Handlungssystem, das sich den wandelnden Märkten anpasst. Und so wurde aus der dritten Trilogie, bei aller notwendigen Kontinuität, auch ein exakter Gegenentwurf zur zweiten: Auf ein System, das semantisch zu versteinern drohte, folgt eines, das nach allen Seiten nach Anschlussmöglichkeiten sucht."
Natürlich hat auch Georg Seeßlen den neuen, den Haupterzählstrang der "Star Wars"-Saga fürs Erste angeblich abschließenden Teil der Geschichte rund um den "Krieg der Sterne" noch nicht gesehen. Das hindert ihn aber nicht, in einem Essay über die mittlerweile drei Trilogien umfassende Space Opera auf Grundsätzliches zu sprechen zu kommen: Bildeten die ursprünglichen drei Filme aus den 70er- und 80er-Jahren noch "eine neue Form des Kinos", bei der man "dem Auseinanderfallen des Kino-Epos in seine Bestandteile" zusehen konnte, und bildete die zweite Trilogie um 2000 noch eine Konsolidierung altmodischen Blockbustererzählens, so treffen die neuen Filme aus den letzten Jahren auf die veränderten Rahmenbedingungen eines Blockbuster-Kinos, für die das Franchise einst selbst die Voraussetzungen geschafft hatte. Die Blockbuster seit dem Siegeszug der Marvel-Filme um 2010 "hatten etwas erreicht, was 'Star Wars' mit seinem archetypischen Erzählen nicht gelingen konnte: eine neue Subjektivität. Hier war es immer um die großen Unterscheidungen gegangen, gut und böse, hell und dunkel, richtig und falsch. Längst aber ging es darum, dass diese Unterscheidungen so einfach nicht mehr zu treffen sind, auch im Kino nicht, auch für Kinder nicht. Und selbst bei der Metatraumfabrik Disney nicht mehr, die 'Star Wars' in ihren gewaltigen Korpus an Bildwelten einverleibte. Worum es bei der dritten Trilogie also ging, war, wieder offenere und dynamischere Charaktere zu schaffen (wozu sich die Rebellion mit nicht ganz festgelegtem Ausgang und verschiedenen Figuren dazwischen durchaus anbot), zweitens wieder zu einem mehr subjekt- und emotionsbezogenen Erzählen zu gelangen und drittens neue Spannungsmomente zu erzeugen, die aus der Überkonstruktion des Handlungsbogens hinausführten. ... Aus einer geschlossenen soll eine offene Erzählung werden. Ein ständig sich selbst erneuerndes Bild- und Handlungssystem, das sich den wandelnden Märkten anpasst. Und so wurde aus der dritten Trilogie, bei aller notwendigen Kontinuität, auch ein exakter Gegenentwurf zur zweiten: Auf ein System, das semantisch zu versteinern drohte, folgt eines, das nach allen Seiten nach Anschlussmöglichkeiten sucht."New Yorker (USA), 23.12.2019
 Für einen Beitrag des neuen Hefts stellt Adam Entous den ukrainischen Staatsanwalt Jurij Luzenko vor, der zusammen mit Trumps Anwalt Rudolph Giuliani der Verleumdung Joe Bidens zugearbeitet haben soll: "Von allen Namen in den Anhörungen des Impeachment-Verfahrens wurde der von Luzenko mit am häufigsten genannt. In den Reden von Marie Yovanovitch und George Kent taucht Luzenkos Name 230 Mal auf, fast zweimal so häufig wie der Trumps. Luzenko, der auch einfach 'der korrupte Staatsanwalt' genannt wird, wurde als skrupelloser Politiker bezeichnet, der für seine Karriere lügt. Luzenko gab Informationen an Giuliani weiter, die von diesem, Trump und ihre Verbündeten benutzten wurden, um den Ruf der Bidens und den von Yovanovitch zu beschmutzen. Ein Hauptzeuge des Verfahrens behauptet: Ohne Luzenko wären wir nicht hier."
Für einen Beitrag des neuen Hefts stellt Adam Entous den ukrainischen Staatsanwalt Jurij Luzenko vor, der zusammen mit Trumps Anwalt Rudolph Giuliani der Verleumdung Joe Bidens zugearbeitet haben soll: "Von allen Namen in den Anhörungen des Impeachment-Verfahrens wurde der von Luzenko mit am häufigsten genannt. In den Reden von Marie Yovanovitch und George Kent taucht Luzenkos Name 230 Mal auf, fast zweimal so häufig wie der Trumps. Luzenko, der auch einfach 'der korrupte Staatsanwalt' genannt wird, wurde als skrupelloser Politiker bezeichnet, der für seine Karriere lügt. Luzenko gab Informationen an Giuliani weiter, die von diesem, Trump und ihre Verbündeten benutzten wurden, um den Ruf der Bidens und den von Yovanovitch zu beschmutzen. Ein Hauptzeuge des Verfahrens behauptet: Ohne Luzenko wären wir nicht hier."Weitere Artikel: Adam Gopnik überlegt, was alle Diktatoren gemein haben: den Willen zur Einschüchterung. Peter Schjeldahl denkt über das eigene Sterben nach: "Der Tod gleicht eher einer Malerei als einer Skulptur, wir kennen ihn nur von einer Seite." Benjamin Wallace-Wells porträtiert Pete Buttigieg als vielleicht größte Hoffnung der Demokraten bei den nächsten Präsidentschaftswahlen. Und Anthony Lane sah im Kino Jay Roaches "Bombshell".
Clarin (Argentinien), 13.12.2019

"Wie alle intelligenten und schönen Frauen war sie stets der Ansicht, Männer seien ziemlich einfache Wesen." So Jorge Luis Borges über seine Schwester, die Malerin und Illustratorin Norah Borges (1901 - 1998), der das argentinische Nationalmuseum zum ersten Mal eine große Werkausstellung widmet. Der Schriftsteller Matías Serra Bradford stellt sie vor: "Wunder, Landkarten, Gespenster, Häuser, in denen es spukte, das faszinierte sie. Jeden Abend betete sie, bevor sie ins Bett ging und auf Französisch träumte. Über Krankheiten zu sprechen verbot sie sich, 'um ihnen keine Wirklichkeit zuzugestehen'. Mit dem spanischen Surrealisten und Dadaisten Guillermo de Torre verheiratet, kannte sie viele berühmte spanische Schriftsteller wie Juan Ramón Jiménez, Rafael Alberti und León Felipe und illustrierte ihre Bücher, wie sie auch erklärte, solange der Franquismus Pablo Picasso nicht als großen Künstler anerkenne, sei die gesamte spanische Kunst nichts wert. Jorge Luis Borges nannte sie Noringa, und sie ihn Giorgino. Was der Dichterbruder jedoch am meisten an seiner Schwester bewunderte, war ihr Ausspruch: 'Die Kinder leben in einer Zeit vor dem Christentum.'"
Harper's Magazine (USA), 31.01.2020
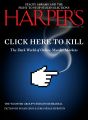 Man muss schon ganz schön schlucken bei dieser Geschichte: Im Netz gibt es inzwischen auch einen Markt für Mord, erzählt Brian Merchant, der für seine Reportage mit potentiellen Opfern, Tätern und Plattformbetreibern gesprochen hat. "Eine Schwelle wurde überschritten. Jahrelang sorgten 'Dark Net Hit Man'-Geschichten für gute Clickbait und wenig mehr. Erfahrene Technikjournalisten haben diese Geschichten nachdrücklich als Mythen entlarvt, denn das ist seit Jahren alles, was sie waren: Mythen und Angstmacherei. Aber die Tatsache, dass die Hits nicht stattfanden, war nie wirklich eine Frage der Technologie; es war eine Frage des Vertrauens. Es stand nie ernsthaft in Frage, dass die Technologie hinter dem dunklen Netz die Anonymität wahren und es den Nutzern ermöglichen könnte, sich ungehindert durch seine Seiten zu bewegen: sie kann es absolut. Deshalb greift das FBI auf altmodische Methoden zurück, um als Drogenkäufer, Kinderpornografen und Auftragskiller undercover auf Kriminellenfang zu gehen. Als das Dark web reifte, konnten Drogen- und Waffenkäufer dokumentieren, dass, jawohl, dieses Pfund Marihuana tatsächlich an meine Adresse geliefert wurde; jawohl, ich erhielt diese Glock, wie angekündigt. Die Benutzer verifizierten und begannen, diesen Märkten zu vertrauen. 'Im frühen Dark web war es beispielsweise unmöglich, das Horn eines echten Nashorns zu kaufen', erklärt Monteiro. 'Es waren alles Scherzartikel. Jetzt sind sie das nicht mehr.' Die Veränderung ist wichtig, aber wie sehr, kann man noch nicht sagen. Ein Mord wurde online beauftragt, und die Kryptowährung wechselte den Besitzer, völlig anonym. Die Mörder wurden erwischt, nicht weil sie ein Motiv hatten, sondern weil Überwachungskameras ihre Gesichter erfasst hatten."
Man muss schon ganz schön schlucken bei dieser Geschichte: Im Netz gibt es inzwischen auch einen Markt für Mord, erzählt Brian Merchant, der für seine Reportage mit potentiellen Opfern, Tätern und Plattformbetreibern gesprochen hat. "Eine Schwelle wurde überschritten. Jahrelang sorgten 'Dark Net Hit Man'-Geschichten für gute Clickbait und wenig mehr. Erfahrene Technikjournalisten haben diese Geschichten nachdrücklich als Mythen entlarvt, denn das ist seit Jahren alles, was sie waren: Mythen und Angstmacherei. Aber die Tatsache, dass die Hits nicht stattfanden, war nie wirklich eine Frage der Technologie; es war eine Frage des Vertrauens. Es stand nie ernsthaft in Frage, dass die Technologie hinter dem dunklen Netz die Anonymität wahren und es den Nutzern ermöglichen könnte, sich ungehindert durch seine Seiten zu bewegen: sie kann es absolut. Deshalb greift das FBI auf altmodische Methoden zurück, um als Drogenkäufer, Kinderpornografen und Auftragskiller undercover auf Kriminellenfang zu gehen. Als das Dark web reifte, konnten Drogen- und Waffenkäufer dokumentieren, dass, jawohl, dieses Pfund Marihuana tatsächlich an meine Adresse geliefert wurde; jawohl, ich erhielt diese Glock, wie angekündigt. Die Benutzer verifizierten und begannen, diesen Märkten zu vertrauen. 'Im frühen Dark web war es beispielsweise unmöglich, das Horn eines echten Nashorns zu kaufen', erklärt Monteiro. 'Es waren alles Scherzartikel. Jetzt sind sie das nicht mehr.' Die Veränderung ist wichtig, aber wie sehr, kann man noch nicht sagen. Ein Mord wurde online beauftragt, und die Kryptowährung wechselte den Besitzer, völlig anonym. Die Mörder wurden erwischt, nicht weil sie ein Motiv hatten, sondern weil Überwachungskameras ihre Gesichter erfasst hatten."
Kommentieren








