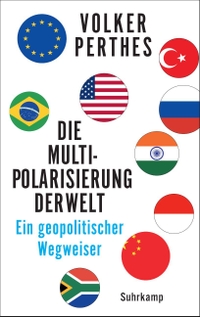Im Kino
Kaleidoskop spontaner Empfindungen
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Patrick Holzapfel
15.03.2017. Michaël Dudok de Wit verbindet in "Die rote Schildkröte" grandiose Landschaftstableaus mit kitschverdächtiger Sexualontologie. Robert Beavers' avantgardistischer Tagebuchfilm "From the Notebook of..." evoziert den Blick der Tauben.
Das "Studio Ghibli"-Logo zu Beginn dürfte, oder sollte zumindest das Herz von jedem, der eines hat, höher schlagen lassen. Erst recht, weil zuletzt die endgültige Schließung des vermutlich großartigsten Studios in der Geschichte des Animationsfilms unmittelbar bevorzustehen schien. "Die rote Schildkröte" kommt als Hoffnungsschimmer wie gerufen, ist allerdings, muss man gleich dazu sagen, höchstens ein halber Ghibli-Film. Das Projekt hat zwar der Legende nach durch die Initiative des Ghibli-Gründers Hayao Miyazaki seinen Ausgang genommen, das kreative Team stammt jedoch fast zur Gänze aus Europa, der Großteil des Geldes kommt aus Frankreich, Regie führt der Niederländer Michaël Dudok de Wit.
Tatsächlich schließt der Film nur auf den ersten Blick an Ghibli-Motive an: Zwar ist die mysteriöse rote Schildkröte des Titels, die der Hauptfigur, einem namen- und (wie alle anderen Figuren) dialogzeilenlosen Schiffbrüchigen, auf einer einsamen Insel Gesellschaft leistet, ähnlich wie zB Miyazakis Ponyo und Totoro als ein Kippwesen angelegt, das Tierisches mit Menschlichem, Kreatürliches mit zivilisatorischer Überformung, Triebsymbolik mit intellektueller Sublimierung verbindet. Aber anders als bei Miyazaki sind solche Gegensatzpaare nicht dialektisch aufeinander bezogen; stattdessen überwiegt stets das Erstgenannte. In "Die Rote Schildkröte" drängt alles zum Elementaren: Wasser, Land, Mensch, Tier, Mann, Frau. Beziehungsweise: Mann, Frau, Kind. Denn der erzählerische Horizont des Films ist nicht die Zivilisierung der einsamen Insel am Ende der Welt (die Spuren, die der Mensch der Natur aufprägt, beschränken sich auf Fußabdrücke im Sand und niedergetrampelte Grashalme), sondern eine Art Sexualontologie - die sich dann noch nicht einmal grafisch austoben darf und schließlich, im schwächsten Bild des Films, in einem letzten Walzer über einen idyllischen Sandstrand stillgestellt wird.

Fast schon ein Wunder andererseits, dass der Film sich erst in seinen letzten Minuten dem Kitsch ergibt. Der lauert zwar vorher schon hier und da, in poetisch-realistischen Kunsthandwerksminiaturen (Dinge oder auch Menschen schwerelos werden zu lassen ist im Animationsfilm eine allzu leichte Übung - da sollte man die Finger von lassen, wenn man keine wirklich guten Gründe vorzuweisen hat), auch in einem deutlich zu mellow vor sich hin schwelgenden Soundtrack; aber er bricht lange nicht ganz an die Oberfläche, weil er von einer durchaus bewundernswerten Formanstrengung im Zaum gehalten wird. Wenn überhaupt, dann findet man den Ghibli-Touch, vielleicht auch allgemeiner den Einfluss japanischer ästhetischer Traditionen, an dieser Stelle: im visuellen Stil. Vor allem in den menschlichen und tierischen Figuren, die mit Ausnahme der CGI-Schildkröte komplett von Hand animiert sind, minimalistisch, in klaren Linien, die Gesichter nur ein paar hingetupfte Punkte. Der Mann, die Krebse und Schildkröten, die sich um ihn herum bewegen (und die hauptsächlich mit fressen und gefressen werden beschäftigt sind), später die Frau, das Kind. Alles an diesen Geschöpfen ist auf eine unaufdringliche Weise expressiv. Wie in den Miyazaki-Filmen bewahrt sich das animierte Leben eine stille Autonomie gegenüber dem Film, der es umgibt.
Noch toller sind die Landschaftstableaus, in die de Wit seine Figuren eher einträgt als platziert. Wo im computeranimierten Mainstream des Genres die totale Verlebendigung gepredigt wird und alles wie mechanisch aufgezogen vor sich hin kreucht und fleucht, weiß "Die rote Schildkröte" um den Wert der Stasis. Oft sind die Bilder fast komplett eingefroren, bis auf ein kleines Bewegungselement, das dann allerdings seinerseits nicht stillzustellen ist. Der Bildraum wird für einmal tatsächlich zur Leinwand. Soll heißen: Die Bilder sind nicht auf Informationsvermittlung hin ausgelegt, sondern atmosphärisch durchkomponiert, und zwar ganz besonders dann, wenn sie fast komplett flächig bleiben. Das Meer ist nicht blau, sondern schillert in unendlich vielen sanft ineinander übergehenden Mischfarben. Das Grün des Waldes ist genauso spektakulär, aber noch erstaunlicher ist seine fein ausdifferenzierte Schraffur. Und in den Nachtszenen gelingt es de Wit, seiner Welt die eben noch so wunderlich vielseitig blühenden Farben auf immer wieder neue Art zu entziehen.
Man bekommt die Zeit ganz gut herum, wenn man sich einfach nur auf das Spiel der Farben und Bewegungen konzentriert; in sich selbst sind die Bilder um Längen klüger als die doofe Geschichte von Mann, Schildkröte und Frau, und es ist nur eine unerhebliche Konvention, dass für gewöhnlich das eine als bloße Illustration des anderen betrachtet wird. Dennoch bleibt am Ende vor allem die Sehnsucht nach einem richtigen Ghibli-Film; tatsächlich kam erst vor kurzem die erlösende Nachricht: Miyazaki zeichnet wieder!
Lukas Foerster
Die rote Schildkröte - Frankreich, Belgien, Japan 2016 - Originaltitel: La tortue rouge - Regie: Michaël Dudok de Wit - Laufzeit: 80 Minuten.
---

Ein wenig ist es so, als würde der Filmemacher Licht und Schatten wie ein anhaltendes Pusten durch seine Bilder wehen lassen, sodass Farben, Formen und Bewegungen sich jederzeit im Inbegriff einer Transformation befinden und dadurch eine neue, zerbrechliche Schönheit offenbaren. Das Leben wird Kunst. Das könnte man wohl über jeden Film des amerikanischen Filmemachers Robert Beavers schreiben, aber selten hat er so deutlich den Prozess gezeigt, der seine Poesie ermöglicht, wie in "From the Notebook of…". Ein Film, der gleichermaßen eine Selbstfindung wie eine Selbstdarstellung ist, eine Wahrnehmung und eine Spielerei, eine Vergangenheit und eine Gegenwart.
Verschiedene Zeiten und verschiedene Orte sind am Werk in "From the Notebook of…". Sie treffen sich nicht an Locations oder in einer Dauer, sondern in der Kamera. Immer wieder schlägt der Film überraschende Verbindungen zwischen der Welt und dem Objektiv vor. Gedreht und "abgeschlossen" 1971 überarbeitete Beavers den Film, wie viele seiner Werke (zum Beispiel auch "Work Done" oder "The Painting") 1998 neu. Es findet bereits in dieser Tätigkeit ein Dialog statt zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Auf der einen Seite der junge Beavers, der mit seinem Partner und Mentor Gregory Markopoulos in Florenz lebt und sich von den Notizbüchern Leonardo Da Vincis sowie einem Essay Paul Valerys über die Arbeitsweise von Da Vinci inspirieren lässt. Gedreht auf 16mm fängt er Orte ein, die Da Vinci beschreibt und praktiziert ein virtuoses Spiel mit Bewegungen, Filtern und dem Kompendium seiner Bolex-Kamera. Auf der anderen Seite der Transfer des Materials auf 35mm, die neue Tonspur und die gealterten Hände, die das vergangene Material bearbeiten und die Parallelstrukturen des Films bis ins Unendliche multiplizieren. Selten hat ein Filmemacher die verwandten Wörter "Kamera" und "Zimmer" so einheitlich gedacht wie Beavers, der aus der Erfahrung seines Zimmers und der Blicke dort eine Kinowelt basteln kann. Doch dabei verlässt Beavers kaum sein eigentliches Zimmer, die Kamera. So ist der Blick aus dem Fenster der Wohnung in Florenz immer auch ein Blick durch das Objektiv der Kamera.

Der abrupte Rhythmus des Films wird geleitet von der Illusion umgeblätterter Seiten, die Beavers ähnlich der Hand in seinem "The Ground" strukturierend zwischen Bildern einsetzt und in seinem Arbeitsgerät herstellt. Dabei ergänzt sich das Geräusch tatsächlich umgeblätterter Seiten mit den beweglichen Verdunkelungen des Bildkaders durch die Mattebox. Ähnlich arbeitet Beavers hier mit Farbfiltern, die er im Fokus hält oder aus ihm verschwinden lässt. Darüber hinaus und damit gleichzeitig sieht man Notizen über das Filmemachen, Eindrücke eines Raumes mit Fenster, Studien von Farben und Körpern und verschiedene Orte in Florenz, die abgeschwenkt werden bis am Rand des Bildes der Filmemacher selbst in die Kadrierung rückt. Doch nicht nur der Körper des Autors, der an seiner Kunstwerdung arbeitet ist von Bedeutung, sondern auch sein Pinsel, die Bolex, die in einigen Einstellungen gezeigt wird, während sie das macht, was man nach dem Schnitt im Bild sieht.
Fast didaktisch führt Beavers Ursache und Wirkung seiner Methode vor. So zeigt er beispielsweise in einem Bild, wie er oder Markopoulos einen Filter vor die Kamera halten und im nächsten, wie dieser Filter arbeitet. Die Montage freilich emanzipiert sich von der Didaktik in einem Kaleidoskop spontaner Empfindungen. Wer hätte zum Beispiel gedacht, dass der Flügelschlag von Vögeln ähnlich klingt wie das Rattern von Filmmaterial? Wer hätte erwartet, dass die Bewegung der Kamera den Flug eines Vogels vorausahnen oder dass die Form eines Daches jener eines Notizbuches entsprechen kann? Immer wieder findet Beavers unbewusste, fast unterbewusste Analogien, die jederzeit das betonen, was zwischen den Bildern vor sich geht. Nicht das, was auf einer Seite des Notizbuchs steht, ist entscheidend, sondern wie umgeblättert wird.
Die poetische Verdichtung des Films ist kaum zu verarbeiten. Alles was man sieht existiert in Relationen, die sich beständig verändern, durch Schärfenverlagerungen, wiederkehrende Motive oder schlicht das nächste Bild. Jean-Luc Godard hat einmal gesagt, dass der optimale Film eine Kamera im Spiegel zeigen würde. Beavers kommt diesem Gedanken hier ziemlich nahe. Der Blick verliert gar seine Richtung und man ist sich nicht sicher, ob der Filmemacher den Zuseher betrachtet oder der Zuseher den Filmemacher. Auch eine gehörige Portion jugendlicher Narzissmus ist nicht zu verleugnen. Aber von zwei Filmemachern, die einen rituellen Ort (Temenos) errichteten, um nur ihre eigenen Filme zu zeigen, ist auch nichts anderes zu erwarten. Letztlich könnte alles die Wahrnehmung der Tauben sein, deren blickende Augen Beavers immer wieder in Nahaufnahmen festhält.
Das Umblättern des Notizbuchs/der Einsatz der Mattebox erzählt auch von einer Distanz zwischen dem Blickenden und dem was er sieht. In dieser Hinsicht ist "From the Notebook of…" insbesondere nach der Überarbeitung Ende der 1990er Jahre auch ein Film über Erinnerung. Nicht nur ein erstaunliches Dokument über die Arbeit mit Film und das Leben in Florenz von Beavers und Markopoulos, sondern auch ein Film, der die Flüchtigkeit und Intensität dieser Vergangenheit deutlich macht. Am Ende steht eine Art Aufbruch. Eine Tasche wird geschlossen, vermutlich befindet sich darin die Kamera. Auch das Fenster schließt sich und man sieht den Arm eines Mannes neben einem Zeitungsstand, die Tasche klemmt unter dem Arm. Dann erscheint eine Notiz: "To film all my actions having nothing to do with making films." Eine neue Forderung, ein neuer Weg. Das Rattern der Kamera verstummt, Beavers schließt noch einmal sein Fenster. Aber wie von selbst scheint es sich wieder zu öffnen. Das Kino geht weiter und neue Schatten dringen in das Licht. Nur die Kamera ist nicht mehr zu sehen.
Patrick Holzapfel
From the Notebook of… - USA 1971/1998 - Regie: Robert Beavers - Laufzeit: 48 Minuten.
Die tadellose Neu-Restaurierung von "From the Notebook of…" war im Jahr 2016 auf der Berlinale zu sehen und wurde vom Österreichischen Filmmuseum durchgeführt. In dessen Verlag ist auch die erste Buchpublikation über den Filmemacher erschienen, unter dem Titel "Robert Beavers".
---
Außerdem startet "Mit Siebzehn" von André Techiné. Hier unsere Kritik von der Berlinale 2016.
Kommentieren