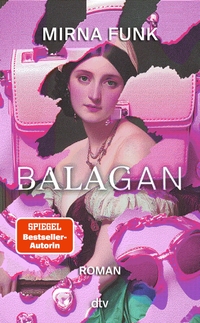Im Kino
Sie atmet, sie pulsiert
Die Filmkolumne. Von Jochen Werner
04.12.2024. Die Kamera ist die eigentliche Erzählerin in Dea Kulumbegashvilis neuem Film. "April" erzählt zwar von den Härten der patriarchalen Ordnung und scheut auch nicht vor brutalen Abtreibungsszenen, in bloßem Sozialrealismus geht dieser soghafte Film jedoch keineswegs auf.
Alles beginnt in einem tiefen, grenzenlosen Schwarz. Eine gesichtslose Kreatur schält sich schemenhaft aus dem Dunkel, vielleicht eine Art Dämon in Gestalt einer nackten, greisen Frau. Sie watet durch flaches, schwarzes Wasser, dazu dräut die unheimliche Filmmusik des britischen Komponisten Matthew Herbert, irgendwoher erklingen Stimmen. Irgendwann ein Schnitt, es fällt Regen. Wieder ein Schnitt, wir wohnen einer Geburt bei. Die ist echt, und Dea Kulumbegashvili zeigt sie uns explizit und ungeschnitten. Das Kind aber schreit nicht, nachdem es den Mutterleib verlässt. Es ist eine Totgeburt, und die Ärztin Nina (Ia Sukhitashvili) muss sich in einer Untersuchung dafür verantworten. Warum hat sie keinen Kaiserschnitt durchgeführt? Die Schwangerschaft war nicht registriert, es gab keine Untersuchungen von Mutter und Fötus vor der Geburt. Der Kindsvater macht sie gleichwohl für das Geschehen verantwortlich, und als ihre Vorgesetzten den Besprechungsraum verlassen haben, spuckt er ihr ins Gesicht.
Auch wenn die Untersuchung zu Ninas Freispruch führen wird, ist es für die von ihren Kollegen hochgeschätzte Gynäkologin gefährlich, ins Blickfeld der ermittelnden Autoritäten zu geraten. Denn Nina führt in den umliegenden Dörfern illegale Abtreibungen durch und macht jungen, unaufgeklärten Mädchen, denen ansonsten nur der Aberglaube bleibt, um ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden, heimlich die Antibabypille zugänglich. Ihre gesamte Existenz setze sie damit aufs Spiel, wirft ihr einmal ihr in sie verliebter Kollege David (Kakha Kintsurashvili) vor. Warum ausgerechnet sie? Niemand nehme gern Abtreibungen vor, erwidert Nina. Aber irgendjemand müsse es tun.
Das klingt auf der Plotebene nach einem typischen Vertreter jenes osteuropäischen, sozialrealistischen Miserabilismus, den noch jeder Filmfestivaljahrgang, der etwas auf sich hält, im Programm hat. Aber wie passt da diese seltsame, spukhafte Präsenz der ersten Einstellung hinein? Diese gespenstische Kreatur, die im folgenden Film immer wieder auftaucht und der auch die verstörend schöne, enigmatische Schlusseinstellung gehören wird, ohne jemals ganz offenzulegen, welcher Realitätsebene sie angehört. Überhaupt könnte "April" formal kaum weniger mit klassischem Sozialrealismus zu tun haben - jedenfalls wenn man genau hinschaut.

Denn oft sind die Verschiebungen subtil, mitunter unmerklich. Die langen Einstellungen wirken nur auf den ersten Blick statisch, tatsächlich sind sie nahezu alle von einem Vibrieren, einem Zittern knapp oberhalb der Wahrnehmungsschwelle erfasst - einem Atmen, das schwerer werden kann, das sich mitunter zu einem nervösen Beben auswächst. Diese Einstellungen leben, und die brillante Kameraarbeit Arseni Khachaturans erweckt sie nicht nur zum Leben, sondern erhebt sich zur eigentlichen Erzählerin dieses soghaften Films.
Mal schwebt diese Kamera über dem Geschehen und offenbart es in erbarmungsloser Draufsicht, wie während der eröffnenden Totgeburt. Mal zentriert sie sich und lässt mit notwendiger Pietät alles Explizite, Exploitative weg, wie in einer dieser Dezenz zum Trotz schwer erträglichen Abtreibungssequenz. Mal drängt sie die Protagonisten an den Bildrand, aus dem Bild hinaus, macht sich autonom, distanziert sich, stürzt sich ins Geschehen hinein oder zieht sich zurück, ruht im Vordergrund, lauernd. Und immer wieder gleitet sie, zunächst unmerklich, in Figurensubjektiven hinein, offenbart sich als die das Geschehen eigentlich strukturierende auktoriale Instanz. Diese Instanz schwebt keineswegs über dem Menschlichen, dem Organischen, ganz im Gegenteil: sie atmet, sie pulsiert, sie wird von emotionalen Aufwallungen ergriffen. Sie lässt den Blick umherschweifen, in langen, nächtlichen Autofahrten über das Land, durch die Städtchen und Dörfer. Einmal, als Nina einen Mann im Auto mitnimmt, den sie zunächst vergeblich oral zu befriedigen versucht, woraufhin sie ihn auffordert, dann eben sie stattdessen zu lecken, übt sie gar Gewalt aus.
Diese Gewalt ist eine patriarchale, und alles ist von ihr durchdrungen in der Welt, die Dea Kulumbegashvili in ihrem erschütternden zweiten Film beschreibt. Männer bestimmen über weibliche Körper und schreiben das Gesetz, Männer missbrauchen wehrlose Schutzbefohlene. Und Männer lassen sich auf Ninas Begehren nach schnellem, anonymem Sex ein - und greifen zu Gewalt als Übersprungshandlung, wenn sie mit dieser ungewohnt unverschämten weiblichen Sexualität nicht umgehen können.
Ganz ohne Bezugspunkte in Filmgeschichte und kontemporärem Kino verbleibt "April" nicht, obgleich in seiner Formgebung durchweg originell und eigen. Der Kunstgriff mit der monströsen Kreatur erinnert an Zulawskis "Possession", oder aus jüngeren Jahren an Escalantes "The Untamed". Die Art und Weise der Realitätskonstruktion, die stets offen für den Einbruch von Naturmystik Übersinnlichem bleibt, lässt vielleicht am ehesten an die Filme von Carlos Reygadas denken. Epigonal aber ist hier nichts, die Form ist unverkennbar eine eigene. Dea Kulumbegashvili hat sich mit ihrem zweiten Film als eine der aufregendsten Filmemacherinnen des Gegenwartskinos etabliert.
Nach ihrem bereits beeindruckenden Debüt "Beginning" hat sie ihre kraftvolle Filmsprache noch einmal deutlich weiterentwickelt - und zu einer originellen Form gefunden, die unverkennbar ihre eigene ist. Auch wenn die Erzählung schlicht anmutet - die Art, wie sie den Film erzählt, ist es keineswegs. Vor Symbolismus habe sie Angst, gibt Kulumbegashvili im Filmgespräch nach der Berlin-Premiere an - tatsächlich gelingt es ihr, unterschiedlichste Schichten von Narration und Bedeutung (oder Rätsel) so ineinander zu verflechten, dass der daraus entstehende Film weder im Symbolischen noch in Realismus aufgeht. Was hier als Realität geschildert wird, wird zwar harsch und auch erbarmungslos präsentiert, bleibt aber in seiner Form viel zu prekär und brüchig, um in den simplen Formeln des Sozialrealismus verortet zu werden. Der Film behält sein Geheimnis, weit über den Abspann hinaus.
Jochen Werner
April - Georgien 2024 - Regie: Dea Kulumbegashvili - Kamera: Arseni Khachaturan - Darsteller: Ia Sukhitashvili, Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze, Roza Kacheishvili, Ana Nikolava - Lautzeit: 134 Minuten.
"April" war im Rahmen des Festivals "Around the World in 14 Films" zu sehen. Ein deutscher Kinostart ist noch nicht angekündigt.
Kommentieren