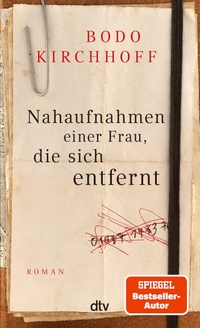Im Kino
Cannes und die große Kopflosigkeit
Die Filmkolumne. Von Lutz Meier
18.05.2018. Stolz und Beliebigkeit kratzen am Ruf des glanzvollsten aller Filmfeste. Eine gefährliche Rückwärtsgewandtheit hat die Verteidiger des Kinos ergriffen. Wenn nicht an der Côte d'Azur Filme wie die von Matteo Garrone oder Ulrich Köhler gezeigt würden, könnte man den Glauben ganz verlieren. Aus CannesÜber der brutal zugebauten Stadt Cannes, dort wo die Grafen der Provence sich im Mittelalter eine Festung errichtet haben, sitzt um einen großen rechteckigen Tisch die Jury der 71. Filmfestspiele. Unter dem Vorsitz der Schauspielerin Cate Blanchett haben die neun Mitglieder dieses Jahr eine doppelt schwere Aufgabe: Einerseits aus der diesjährigen Auswahl einen wegweisenden Film für die nähere Ewigkeit zu finden. Andererseits den etwas ramponierten Ruf des lange Zeit glanzvollsten aller Filmfeste zu retten. Der Bürgermeister der überaus wohlhabenden Gemeinde hat hier oben einige Tage vor der Entscheidung zum traditionellen Aioli geladen. Eigentlich eine ausgelassene Angelegenheit, doch rund um den Tisch der Jury hat sich ein Kordon hochgerüsteter Polizisten mit Maschinengewehren im Anschlag postiert. Es ist das ein seltsames Bild für eine Gruppe, die ein ästhetisches Urteil fällen soll - bei einer Veranstaltung, bei der es immer auch um die Freiheit gehen soll, nämlich die der Kunst. Und man kann das Bild der martialischen Männer mit den Knarren auch gegen deren eigentliche Mission interpretieren: Entscheidet hier etwas, was eine Perspektive für die ganze Sause schafft - sonst knallt's!

Szene aus Kirill Serebrennikows "Leto"
Das diesjährige Festivalprogramm hat nämlich die ganze Problematik der Veranstaltung offengelegt. Sicher, es waren stellenweise wieder sehr sehenswerte Filme dabei. Aber die Auswahl insgesamt hatte etwas Beliebiges und Richtungsloses. Es fehlt einfach an den zwingenden Filmen die den Anspruch einlösen, dass hier etwas für die ganze (Film-)Welt Relevantes verhandelt wird. Dass, wenn es irgendwo etwas Neues zu sehen gibt, dann hier. Das alte Rezept war es, dreierlei zu mischen: ein paar alternde Stammgäste mit großen Namen. Ein paar Hollywood-Blockbuster für die Massen und die Klatsch-Schlagzeilen. Sowie einige wenige selbst herangezüchtete Nachwuchs-Stammkräfte. Dieses Rezept geht nicht mehr auf. Weil die Alten nicht liefern. Weil Hollywood sich zurückzieht. Und weil das elitäre Konzept von Cannes nicht unbedingt die richtigen Nachwuchskräfte in den Kreis der Erlesenen erhebt.
Wir erinnern uns, dass um die Jahreswende in Deutschland eine Riesendiskussion um die Zukunft der Berlinale losbrach, welche teilweise ähnliche Probleme hat wie Cannes, teilweise andere, jedenfalls auch riesige. Anlass für die Diskussion um die Berlinale ist der Umstand, dass den Verantwortlichen, namentlich Kulturstaatsministerin Monika Grütters, bei der Regelung der Nachfolge für den scheidenden Berlinale-Chef Dieter Kosslick jede Idee fehlt, sei es inhaltlich oder personell. In das Ideenvakuum sprang damals der Regisseur Christoph Hochhäusler als informeller Anführer einer Gruppe von deutschen Filmleuten und -kritikern, die ausgerechnet mit dem Verweis auf Cannes argumentierte: Hier nämlich werde noch eine autoritative kuratorische Entscheidung über das filmästhetisch Wichtige getroffen, hier sei noch das gemeinsame Gespräch über einen reduzierten Kanon von Filmen möglich, hier gebe das Festival noch eine Richtung vor, anstatt im Strudel und Gewurstel unterzugehen.
Man muss sich nur kurze Zeit in Cannes aufhalten, um zu sehen, was für eine riesige Illusion das ist. An einem Tag rufen sie aus lauter schlechtem Gewissen das Festival der Frauen aus und zeigen dann ein fragwürdiges Machwerk ("Les Filles du Soleil" von Eva Husson), in dem Frauen nicht als Akteurinnen vorkommen, sondern als verheulte und augenaufschlagende Abziehbilder. Dann lassen sie sich vom Disney-Konzern vorführen, um überhaupt einen Hauch Hollywood zu erhaschen, obwohl das Studio den neuen "Starwars"-Ableger bereits zur Premiere in L.A. gezeigt hat, was früher niemals mit dem Anspruch von Cannes zu vereinen gewesen wäre. Alte Festivalgetreue wie der 68er-Held Romain Goupil dürfen sogar eine handwerklich komplett verhunzte geschwätzige Fernsehdokumentation über den sehr selbstgewissen Dany Cohn-Bendit hier zeigen, um irgendwie das Thema "50 Jahre 1968" noch aufzunehmen, das sonst gemieden wird, obgleich es doch gerade für Cannes eine Bedeutung hat (was der misslungene Film dann paradoxerweise konsequent vermeidet).

Szene aus Spike Lees "BlackKklansman"
Im normalen Wettbewerbsprogramm läuft mal dies, mal das. Das meiste nicht wirklich schlecht und vieles sogar recht gut. Aber die Paukenschläge, die Provokationen, die polarisierenden Standpunkte, die Filme die die Grenzen von dem sprengen, was wir uns unter einem Spielfilm vorstellen - Fehlanzeige. Die Tatsache, dass Digitalisierung und künstliche Intelligenz unsere Begriffe nicht nur vom Audiovisuellen über den Haufen werden, die bestürzende Entwicklung, dass Nationalismus und Angst unsere Idee von - nicht nur - künstlerischer Freiheit angreifen, die Beobachtung, dass eine Generation heranwächst die eine fundamental andere Vorstellung von Erzählungen und Bildern hat - all das kommt in den Filmen von Cannes dieses Jahr nicht vor.
Sicher, es sind die Kompromisse, die jeder Festivaldirektor machen muss, der gleichzeitig ein attraktives, ein relevantes und die Aufmerksamkeit der Weltmedien erregendes Ereignis auf die Beine stellen will. Sicher, man kann sich als Auswahlkommission die wahnsinnig wegweisenden Filme nicht backen, wenn sie eben gerade nicht fertig sind. Aber die Erfahrung zeigt doch zumindest zwei Dinge: Erstens dass Hochhäusler und seine Mitstreiter mit ihrem romantischen Traum von der autoritativen Auswahl auf dem Holzweg sind, weil Vielfalt, Auswahl, kalkuliertes Chaos ("Brei" nannte es Hochhäusler in einer gemeinsam mit Thomas Heise verfassten Vorrede für eine Diskussion im Haus der Kulturen der Welt) im Zweifelsfall eher zu Entdeckungen führen als Beschränkung und die Fiktion einer Strenge, die am Ende ohnehin niemand aufrecht erhalten kann. Und zweitens dass der französische Festivaldirektor Thierry Frémaux einen großen Fehler begangen hat, indem er sich mit vermeintlichen Verteidigern des Kinos verbündet hat, die in Wahrheit nur ängstliche Verteidiger der Vergangenheit des Kinos sind. Indem er nämlich seit vergangenen Jahr unbedingt vorschreiben will, dass ein Film, der in Cannes läuft, in Frankreich einen Kinostart haben muss. Das bedeutet praktisch einen Bann für Produktionen der Streaminganbieter wie Netflix und Amazon, die aber derzeit zu den wichtigsten Geldgebern für gute (zumindest amerikanische) Regisseure und Drehbuchschreiber zählen.
Laut dem Branchenblatt Variety stand Frémaux vergangenes Jahr in dem Streit um die Sache kurz vor dem Rausschmiss. Die französischen Kinoketten, die im Aufsichtsrat des Festival de Cannes das Wort führen, hätten eine klare Anti-Netflix-Position verlangt. Gleichzeitig steht Frémaux aber wegen des mittelmäßigen Programms mit weniger Filmen als in den Vorjahren in der Kritik. Und auch weil an der Croisette merkbar weniger Halligalli ist, Hotelkapazitäten ungenutzt bleiben, der ganze Party- und Eventbetrieb seinen Zenit überschritten zu haben scheint. Schließlich, weil es Frémaux nicht mehr schaffe, die Amerikaner nach Cannes zu locken.
In der Tat gab es nur zwei amerikanische Filme im Wettbewerb: Zum einen Spike Lees furiose politische Mainstream-Komödie "BlackKklansman", die sicher Chancen auf eine Goldene Palme hat. Das wäre eine Entscheidung, mit der sich die Jury elegant aus dem oben beschriebenen Entscheidungsdilemma herauswinden könnte. Der zweite US-Film allerdings belegt wieder die Misere: David Robert Mitchells "Under the Silver Lake" ist eine handwerklich saubere, aber inhaltlich fragwürdige Simulation von Hollywood-Kritik, über deren Berechtigung, im Wettbewerb von Cannes zu laufen, man 139 lange Minuten lang zweifeln darf.
Das leichteste für die Jury wäre wie gesagt eine politische Entscheidung. Wenn nicht für Spike Lee, dann für den russischen Theater- und Kinoregisseur Kirill Serebrennikow, der in seiner Heimat wegen dubioser Vorwürfe unter Hausarrest steht und der in Cannes in erzwungener Abwesenheit das Punk-Historiendrame "Leto" zeigte. Oder ein Hauptpreis für einen der beiden iranischen Beiträge, sei es Asgar Farhadi, oder Jafar Panahi, die aber beide schon für bessere Filme große Festivalpreise bekommen haben.

Szene aus Matteo Garrones "Dogman"
Und ein politischer Preis wäre gerade in diesem Jahr unpassend, denn es war dieses Jahr das Festival der Märchen, der Magie, der Innenschauen, nicht aber der Politik. Vor zehn Jahren hat Matteo Garrone für seinen Camorra-Film "Gomorrha" hier einen Jurypreis geholt. Das war die pure Wirklichkeit, aber in seinem neuen Film "Dogman" kommt eben das Märchenhafte und Groteske ins Spiel. Mindestens Hauptdarsteller Marcello Fonte sollte (wenn es gerecht zugeht auf der Welt) für diesen Film einen Darstellerpreis erhalten. Fonte spielt hinreißend den kleinen schmalen Hundefriseur Marcello, der in einer zwischen pittoresk und trostlos heruntergekommenen Wohn- und Geschäftsanlage am Meer klarkommen muss. Und das heißt vor allem, sich gegen den fast doppelt so großen und dreimal so breiten Simone zu behaupten. Kleine Gangster sind sie hier alle und Recht und Staat sind so gut wie abwesend. Aber es würde Eintracht herrschen ohne den gewalttätigen Simone. Auf diese Weise kommt ein so genaues wie ausweglos trauriges Lehrstück über hündische Treue und das Ende von Gesellschaft zustande.
Auf die Liste der preiswürdigen Filme gehört noch der koreanische Beitrag "Burning" von Lee Chang-Dong, der eine Studie über Sehnsucht und den "Großen Hunger" liefert, nämlich den Hunger seiner jungen Protagonisten nach Leben. Die Geschichte mit Anleihen bei Haruki Murakami und William Faulkner sollte erklärtermaßen ein Film gegen die große Verunsicherung werden und ist dennoch alles andere als ein Feelgood-Movie.

Szene aus Ulrich Koehlers "In my Room"
Von Magie lebt übrigens auch der einzig deutschen Cannes-Beitrag "In my Room" von Ulrich Köhler. Köhler war 2011 mit "Schlafkrankheit" im Wettbewerb der Berlinale, das war eine eher zähe und müde Angelegenheit, ganz im Unterschied zu Köhlers neuem Film, der es unbegreiflicherweise nur in die Nebenreihe "Un certain Regard" geschafft hat. Wäre es der Wettbewerb, man hätte den Film zweifellos zu den Favoriten zählen müssen. Denn Köhlers Geschichte hat das, was so vielen anderen in diesem Jahr fehlt: Sie ist zwingend. Es ist die auf den ersten Blick einfache Geschichte des buchstäblich letzten Menschen in unserer modernen Welt. Die Hauptfigur Armin (Hans Löw) ist ein unglücklicher Medienarbeiter aus Berlin, der in seine ostwestfälische Heimat zurückkehrt, um seine sterbende Großmutter noch einmal zu sehen. Und dann sind plötzlich die Menschen verschwunden, alle außer Armin, alles bleibt stehen und liegen. Und Armin wird doch noch (soweit man das beurteilen kann) glücklich. Das ist eine so schöne Parabel, mit so viel Gespür für das Nie-zuviel erzählt, dass die Stimmung von Köhlers Film auch nach dessen Schluss nach zwei kinosatten Stunden noch lange in der Luft hängt.
Ist das jetzt noch die Berliner Schule? Zu den Vertretern dieser eher frugalen Filmergruppe wird auch Köhler gezählt und Christoph Hochhäusler. Und so stand auch Köhler auf der oben erwähnten Unterschriftenliste im Kampf gegen den "Brei" bei Filmfesten und die Reinheit von Cannes.
Dabei scheint doch Köhlers wunderbarer neuer Film das Gegenteil zu belegen: Mehr Brei wagen! Überhaupt mehr wagen! Dann geht's auch wieder nach vorn.

Szene aus Kirill Serebrennikows "Leto"
Das diesjährige Festivalprogramm hat nämlich die ganze Problematik der Veranstaltung offengelegt. Sicher, es waren stellenweise wieder sehr sehenswerte Filme dabei. Aber die Auswahl insgesamt hatte etwas Beliebiges und Richtungsloses. Es fehlt einfach an den zwingenden Filmen die den Anspruch einlösen, dass hier etwas für die ganze (Film-)Welt Relevantes verhandelt wird. Dass, wenn es irgendwo etwas Neues zu sehen gibt, dann hier. Das alte Rezept war es, dreierlei zu mischen: ein paar alternde Stammgäste mit großen Namen. Ein paar Hollywood-Blockbuster für die Massen und die Klatsch-Schlagzeilen. Sowie einige wenige selbst herangezüchtete Nachwuchs-Stammkräfte. Dieses Rezept geht nicht mehr auf. Weil die Alten nicht liefern. Weil Hollywood sich zurückzieht. Und weil das elitäre Konzept von Cannes nicht unbedingt die richtigen Nachwuchskräfte in den Kreis der Erlesenen erhebt.
Wir erinnern uns, dass um die Jahreswende in Deutschland eine Riesendiskussion um die Zukunft der Berlinale losbrach, welche teilweise ähnliche Probleme hat wie Cannes, teilweise andere, jedenfalls auch riesige. Anlass für die Diskussion um die Berlinale ist der Umstand, dass den Verantwortlichen, namentlich Kulturstaatsministerin Monika Grütters, bei der Regelung der Nachfolge für den scheidenden Berlinale-Chef Dieter Kosslick jede Idee fehlt, sei es inhaltlich oder personell. In das Ideenvakuum sprang damals der Regisseur Christoph Hochhäusler als informeller Anführer einer Gruppe von deutschen Filmleuten und -kritikern, die ausgerechnet mit dem Verweis auf Cannes argumentierte: Hier nämlich werde noch eine autoritative kuratorische Entscheidung über das filmästhetisch Wichtige getroffen, hier sei noch das gemeinsame Gespräch über einen reduzierten Kanon von Filmen möglich, hier gebe das Festival noch eine Richtung vor, anstatt im Strudel und Gewurstel unterzugehen.
Man muss sich nur kurze Zeit in Cannes aufhalten, um zu sehen, was für eine riesige Illusion das ist. An einem Tag rufen sie aus lauter schlechtem Gewissen das Festival der Frauen aus und zeigen dann ein fragwürdiges Machwerk ("Les Filles du Soleil" von Eva Husson), in dem Frauen nicht als Akteurinnen vorkommen, sondern als verheulte und augenaufschlagende Abziehbilder. Dann lassen sie sich vom Disney-Konzern vorführen, um überhaupt einen Hauch Hollywood zu erhaschen, obwohl das Studio den neuen "Starwars"-Ableger bereits zur Premiere in L.A. gezeigt hat, was früher niemals mit dem Anspruch von Cannes zu vereinen gewesen wäre. Alte Festivalgetreue wie der 68er-Held Romain Goupil dürfen sogar eine handwerklich komplett verhunzte geschwätzige Fernsehdokumentation über den sehr selbstgewissen Dany Cohn-Bendit hier zeigen, um irgendwie das Thema "50 Jahre 1968" noch aufzunehmen, das sonst gemieden wird, obgleich es doch gerade für Cannes eine Bedeutung hat (was der misslungene Film dann paradoxerweise konsequent vermeidet).

Szene aus Spike Lees "BlackKklansman"
Im normalen Wettbewerbsprogramm läuft mal dies, mal das. Das meiste nicht wirklich schlecht und vieles sogar recht gut. Aber die Paukenschläge, die Provokationen, die polarisierenden Standpunkte, die Filme die die Grenzen von dem sprengen, was wir uns unter einem Spielfilm vorstellen - Fehlanzeige. Die Tatsache, dass Digitalisierung und künstliche Intelligenz unsere Begriffe nicht nur vom Audiovisuellen über den Haufen werden, die bestürzende Entwicklung, dass Nationalismus und Angst unsere Idee von - nicht nur - künstlerischer Freiheit angreifen, die Beobachtung, dass eine Generation heranwächst die eine fundamental andere Vorstellung von Erzählungen und Bildern hat - all das kommt in den Filmen von Cannes dieses Jahr nicht vor.
Sicher, es sind die Kompromisse, die jeder Festivaldirektor machen muss, der gleichzeitig ein attraktives, ein relevantes und die Aufmerksamkeit der Weltmedien erregendes Ereignis auf die Beine stellen will. Sicher, man kann sich als Auswahlkommission die wahnsinnig wegweisenden Filme nicht backen, wenn sie eben gerade nicht fertig sind. Aber die Erfahrung zeigt doch zumindest zwei Dinge: Erstens dass Hochhäusler und seine Mitstreiter mit ihrem romantischen Traum von der autoritativen Auswahl auf dem Holzweg sind, weil Vielfalt, Auswahl, kalkuliertes Chaos ("Brei" nannte es Hochhäusler in einer gemeinsam mit Thomas Heise verfassten Vorrede für eine Diskussion im Haus der Kulturen der Welt) im Zweifelsfall eher zu Entdeckungen führen als Beschränkung und die Fiktion einer Strenge, die am Ende ohnehin niemand aufrecht erhalten kann. Und zweitens dass der französische Festivaldirektor Thierry Frémaux einen großen Fehler begangen hat, indem er sich mit vermeintlichen Verteidigern des Kinos verbündet hat, die in Wahrheit nur ängstliche Verteidiger der Vergangenheit des Kinos sind. Indem er nämlich seit vergangenen Jahr unbedingt vorschreiben will, dass ein Film, der in Cannes läuft, in Frankreich einen Kinostart haben muss. Das bedeutet praktisch einen Bann für Produktionen der Streaminganbieter wie Netflix und Amazon, die aber derzeit zu den wichtigsten Geldgebern für gute (zumindest amerikanische) Regisseure und Drehbuchschreiber zählen.
Laut dem Branchenblatt Variety stand Frémaux vergangenes Jahr in dem Streit um die Sache kurz vor dem Rausschmiss. Die französischen Kinoketten, die im Aufsichtsrat des Festival de Cannes das Wort führen, hätten eine klare Anti-Netflix-Position verlangt. Gleichzeitig steht Frémaux aber wegen des mittelmäßigen Programms mit weniger Filmen als in den Vorjahren in der Kritik. Und auch weil an der Croisette merkbar weniger Halligalli ist, Hotelkapazitäten ungenutzt bleiben, der ganze Party- und Eventbetrieb seinen Zenit überschritten zu haben scheint. Schließlich, weil es Frémaux nicht mehr schaffe, die Amerikaner nach Cannes zu locken.
In der Tat gab es nur zwei amerikanische Filme im Wettbewerb: Zum einen Spike Lees furiose politische Mainstream-Komödie "BlackKklansman", die sicher Chancen auf eine Goldene Palme hat. Das wäre eine Entscheidung, mit der sich die Jury elegant aus dem oben beschriebenen Entscheidungsdilemma herauswinden könnte. Der zweite US-Film allerdings belegt wieder die Misere: David Robert Mitchells "Under the Silver Lake" ist eine handwerklich saubere, aber inhaltlich fragwürdige Simulation von Hollywood-Kritik, über deren Berechtigung, im Wettbewerb von Cannes zu laufen, man 139 lange Minuten lang zweifeln darf.
Das leichteste für die Jury wäre wie gesagt eine politische Entscheidung. Wenn nicht für Spike Lee, dann für den russischen Theater- und Kinoregisseur Kirill Serebrennikow, der in seiner Heimat wegen dubioser Vorwürfe unter Hausarrest steht und der in Cannes in erzwungener Abwesenheit das Punk-Historiendrame "Leto" zeigte. Oder ein Hauptpreis für einen der beiden iranischen Beiträge, sei es Asgar Farhadi, oder Jafar Panahi, die aber beide schon für bessere Filme große Festivalpreise bekommen haben.

Szene aus Matteo Garrones "Dogman"
Und ein politischer Preis wäre gerade in diesem Jahr unpassend, denn es war dieses Jahr das Festival der Märchen, der Magie, der Innenschauen, nicht aber der Politik. Vor zehn Jahren hat Matteo Garrone für seinen Camorra-Film "Gomorrha" hier einen Jurypreis geholt. Das war die pure Wirklichkeit, aber in seinem neuen Film "Dogman" kommt eben das Märchenhafte und Groteske ins Spiel. Mindestens Hauptdarsteller Marcello Fonte sollte (wenn es gerecht zugeht auf der Welt) für diesen Film einen Darstellerpreis erhalten. Fonte spielt hinreißend den kleinen schmalen Hundefriseur Marcello, der in einer zwischen pittoresk und trostlos heruntergekommenen Wohn- und Geschäftsanlage am Meer klarkommen muss. Und das heißt vor allem, sich gegen den fast doppelt so großen und dreimal so breiten Simone zu behaupten. Kleine Gangster sind sie hier alle und Recht und Staat sind so gut wie abwesend. Aber es würde Eintracht herrschen ohne den gewalttätigen Simone. Auf diese Weise kommt ein so genaues wie ausweglos trauriges Lehrstück über hündische Treue und das Ende von Gesellschaft zustande.
Auf die Liste der preiswürdigen Filme gehört noch der koreanische Beitrag "Burning" von Lee Chang-Dong, der eine Studie über Sehnsucht und den "Großen Hunger" liefert, nämlich den Hunger seiner jungen Protagonisten nach Leben. Die Geschichte mit Anleihen bei Haruki Murakami und William Faulkner sollte erklärtermaßen ein Film gegen die große Verunsicherung werden und ist dennoch alles andere als ein Feelgood-Movie.

Szene aus Ulrich Koehlers "In my Room"
Von Magie lebt übrigens auch der einzig deutschen Cannes-Beitrag "In my Room" von Ulrich Köhler. Köhler war 2011 mit "Schlafkrankheit" im Wettbewerb der Berlinale, das war eine eher zähe und müde Angelegenheit, ganz im Unterschied zu Köhlers neuem Film, der es unbegreiflicherweise nur in die Nebenreihe "Un certain Regard" geschafft hat. Wäre es der Wettbewerb, man hätte den Film zweifellos zu den Favoriten zählen müssen. Denn Köhlers Geschichte hat das, was so vielen anderen in diesem Jahr fehlt: Sie ist zwingend. Es ist die auf den ersten Blick einfache Geschichte des buchstäblich letzten Menschen in unserer modernen Welt. Die Hauptfigur Armin (Hans Löw) ist ein unglücklicher Medienarbeiter aus Berlin, der in seine ostwestfälische Heimat zurückkehrt, um seine sterbende Großmutter noch einmal zu sehen. Und dann sind plötzlich die Menschen verschwunden, alle außer Armin, alles bleibt stehen und liegen. Und Armin wird doch noch (soweit man das beurteilen kann) glücklich. Das ist eine so schöne Parabel, mit so viel Gespür für das Nie-zuviel erzählt, dass die Stimmung von Köhlers Film auch nach dessen Schluss nach zwei kinosatten Stunden noch lange in der Luft hängt.
Ist das jetzt noch die Berliner Schule? Zu den Vertretern dieser eher frugalen Filmergruppe wird auch Köhler gezählt und Christoph Hochhäusler. Und so stand auch Köhler auf der oben erwähnten Unterschriftenliste im Kampf gegen den "Brei" bei Filmfesten und die Reinheit von Cannes.
Dabei scheint doch Köhlers wunderbarer neuer Film das Gegenteil zu belegen: Mehr Brei wagen! Überhaupt mehr wagen! Dann geht's auch wieder nach vorn.
Kommentieren