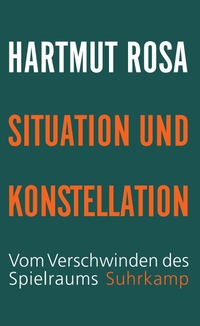Außer Atem: Das Berlinale Blog
Berlinale 2. Tag
Von Thekla Dannenberg, Lukas Foerster, Thomas Groh, Ekkehard Knörer
07.02.2009. Radu Judes "The Happiest Girl in the World" klammert sich so fest an ihre Chance wie an ihre gehäkelte Handtasche. Informationspolitische Cleverness beweist Asghar Farhadi in seinem Wettbewerbsfilm "Darbareye Elly - About Elly". Verstreut symbolisch Samen: Mans Manssons "Mr. Governor". Francois Ozons "Ricky" fliegt, hebt aber nicht ab. Stephen Daldrys "Der Vorleser" scheitert an seiner obszönen Symbolik. Dante Lams "The Beast Stalker" ist feines Pulp-Entertainment über Menschen mit Narben.Radu Judes "Cea mai fericita fata din lume - The Happiest Girl in the World" klammert sich an ihre Chance (Forum)
Im Autoradio singen die Pet Shop Boys "I love you, you pay my rent", auf der Rückbank des klapprigen Dacia liegt Delia, fühlt sich hundeelend und muss sich von ihren Eltern nerven lassen, die gar nicht merken, wie sie ihr den großen Tag, die Chance ihres Lebens verderben: Im Preisausschreiben hat sie ein Auto gewonnen und, damit alle Welt mitbekommt, wie großzügig dieser Safthersteller gegenüber einfachen Menschen aus der Provinz ist, muss sie in einem Werbeclip auftreten und beteuern: "Ich bin Delia Cristina Fratila, und ich bin das glücklichste Mädchen der Welt."

Man ahnt sehr schnell, worauf dies hinausläuft: Natürlich ist Delia (schön verstockt gespielt von Andrea Bosneag) mit ihrem Übergewicht, dem toupierten Haar und den Pickeln absolut nicht sexy genug für das coole Bukarest, und jeder lässt es sie spüren. Immer wieder müssen die Szenen neu gedreht werden, und das Leichteste, was Delia dabei herunterzuschlucken hat, ist der halbe Liter O-Saft pro Aufnahme. Damit er besser aussieht, wird er mit Cola versetzt. Nach jeder vermasselten Szene lassen die Werber mehr Frust an Delia aus. Geht es nicht auch ein bisschen zielorientierter? Weniger phlegmatisch? Ohne die hässliche blaue Jacke? Ohne den Damenbart? Aber wehe sie lächelt nicht herzlich genug zu ihrem bescheuerten Spruch.
Genau hier will Delia aber hin, ins kalte Bukarest, an die Universität, mit dem schicken neuen Auto, weg aus dem Provinzkaff, weg von ihren Eltern, die das Auto lieber verkaufen wollen, um selbst mit dem Geld eine Pension zu eröffnen. Als sie dies ihrer Mutter (Violeta Popa mit herrlich rumänischer Grandezza) eröffnet, bricht hinterm Filmset die Hölle los. Aus dem Kampf ums Auto wird der Kampf um die Sehnsüchte und das bisschen Glück, auf das jeder ein Anrecht zu haben meint. Schließlich hat der Vater Diabetes, die Mutter auf alles verzichtet, und Delia überhaupt keinen Führerschein.

"The Happiest Girl in the World" lief vor einem Jahr auf dem Sundance Filmfestival, es ist Radu Judes erster Spielfilm. Zuvor hat er als Werbefilmer sowie als Assistent bei Cristi Puiu gearbeitet. Und ganz wie es sich für einen Regisseur der rumänischen Schule gehört, verzichtet Jude auf jede suggestivere Form der Bildführung. Die Kamera bleibt an dem Platz, für den sie sich einmal entschieden hat, oft mehrere Minuten lang ohne Schnitt, schwenkt mal ein wenig nach links und nach rechts, hält aber immer Äquidistanz, wenn Mutter und Tochter, Vater und Tochter oder alle drei gegen- und miteinander ringen. Je härter die Bandagen werden, mit denen die Eltern und die Filmleute Delia zusetzen, umso größere Kräfte entwickelt dieses Mädchen, das sich an das Auto, an die Chance auf ein Leben in Bukarest genauso fest klammert wie an ihre gehäkelte Handtasche mit den Glasperlen.
Thekla Dannenberg
Radu Jude: "Cea mai fericita fata din lume - The Happiest Girl in the World". Mit Andreea Bosneag, Violeta Popa und Vasile Muraru. Rumänien, Niederlande 2008, 100 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Asghar Farhadis "Darbareye Elly - About Elly" (Wettbewerb)
Hochzeitsanbahnungsvorbereitungen auf dem Lande. Ein Ausflug. Ehepaare mit Kindern, plus zwei Singles. Der Mann ist nur für eine gute Woche aus Deutschland zu Besuch und geschieden. Die Frau heißt Elly, ist Kindergärtnerin, eigentlich kennt sie keiner. Nicht einmal ihren ganzen Namen wissen sie. Was genau sich alle dabei denken, wissen wir nicht, der Film wirft uns erst einmal hinein in diese Situation. Alles ist erst einmal ganz alltäglich. Sepide, eine der verheirateten Frauen, hat die Hauptrolle der wohlmeinenden Intrigantin inne. Sie hat das alles eingefädelt, Elly unter einem Vorwand mit eingeladen und will sie in Wahrheit verkuppeln. Auch sonst kennt Sepide nichts, wenn es darum geht, den eigenen Wünschen auf die Sprünge zu helfen. Als sich herausstellt, dass die gemietete Villa nicht für die geplanten drei Nächte frei ist, erzählt sie der Vermieterin, dass Elly und Ahmed das bereits sind, was sie, wenn der Plan aufgeht, erst werden sollen: ein Ehepaar auf Hochzeitsreise. Da werden die Vermieter weich und stellen ein heruntergekommenes Strandhaus zur Verfügung.

Man richtet sich häuslich ein für entspannte Tage. Der Boiler wird eingebaut und funktioniert, die Löcher in den Fenstern werden abgedichtet, abends spielt man zur Unterhaltung Scharaden. Elly, die, erfahren wir, nicht weiß, was Sepide da im Schilde führt, und Ahmed, der, erfahren wir, weiß, worum es geht, kommen sich näher, im Auto. Alles macht bis dahin einen ganz alltäglichen Eindruck, die Kamera gibt sich, oft aus der Hand geführt, wie der flotte Schnitt kolloquial, Musik gibt es nicht. In diese Beobachtung einer freundlichen Gemeinschaft setzt Asghar Farhadi mit einem Knall ein Ereignis, das die ganze Situation neu konfiguriert. Erst ertrinkt um ein Haar eines der Kinder - und dann stellt sich heraus: Elly ist verschwunden. Alle befürchten, sie könnte ertrunken sein; man sucht, aber ihr Körper taucht nicht auf.

Regisseur Asghar Farhadi hat sich nicht nur im Film, sondern auch als Mann des Theaters im Iran einen Namen gemacht. Wie ein Theaterstück funktioniert in der Tat "About Elly". Nicht zuletzt in der informationspolitischen Cleverness, mit der nach und nach Dinge enthüllt werden, die manches doch in einem anderen Licht erscheinen lassen, als es zuvor erschien. Beinahe bleibt die Einheit von Raum, Zeit und Handlung gewahrt. Und Farhadi hat mit seiner Gemeinschaftsaufstellung, in der er mal gewaltsam, mal behutsam Menschen und Dinge und Verhältnisse verschiebt und wendet und dreht, durchaus immer auch die Gesellschaft als ganze im Blick. Moralvorstellungen werden auf die Probe gestellt, latente Feindschaften brechen auf, Religion ist im Spiel, aber nur am Rande. (Ganz genau beurteilen können wird man dieses und jenes nur mit sehr guter Kenntnis der iranischen Gesellschaft; einfach so aufs Allgemeinmenschliche will der Film nicht hinaus.)
Dennoch. Mehr als ein "well made play" ist das nicht. Das Verschwinden und Verschwundenbleiben von Elly fungiert dramaturgisch als Spannungseffekt, aber auf Dauer nimmt man gerade diesen gekonnten Einsatz der Mittel doch etwas übel. Zumal sich das Karussell der aufbrechenden Konflikte und Leidenschaften doch insgesamt eher gemächlich dreht. Und am Ende, wenn die Mittel erschöpft sind, ist man's als Zuschauer auch.
Ekkehard Knörer
Asghar Farhadi: "Darbareye Elly - About Elly". Mit Golshifteh Farahani, Taraneh Alidousti, Mani Haghighi, Saber Abar. Iran 2009, 119 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Verstreut symbolisch Samen: Mans Manssons "H:r Landshövding - Mr Governor" (Forum)
Ein Film über die Arbeit des schwedischen Politikers und einstigen Verteidigungsministers Anders Björck, gedreht auf grobkörnigem 16mm-Material, in Schwarzweiß und mit vielen langen Einstellungen, in denen wir Björck beim Essen, beim Telefonieren, beim Notizenmachen sehen. Da denkt man an das Cinema Verite. An die Meister der Form, die Maysles Brothers und Frederick Wiseman, der vor zwei Jahren selbst im Forum mit dem meisterlichen "State Legislature" Einblick in die Gesetzesentwicklungsprozesse in Idaho gestattete.
Solches Wollen der Form gibt "Mr. Governor" an jeder Stelle zu erkennen, genau darin liegt seine Schwäche: 16 Millimeter und grobes Korn, Schwarzweiß und lange Einstellungen sind, auch gut abgeschaut, an sich noch keine Filmkunst. Bei den Maysles und Wiseman ergeben sich lange Einstellungen aus der beobachteten Haltung, aus dem Gegenstand heraus, hier sind sie, wenn man das Gebäude sieht, in dem Björck seinem Werk nach geht, oder wenn Björck auf kleine Blättchen Notizen schreibt, oft nur deshalb schon lang, weil sie eben lang sein sollen.
"Mr. Governor" findet und zweigt wenig. Die Aufgaben von Anders Björck beschränken sich im wesentlichen auf Repräsentation. Eine Gartenschau, eine Buchveröffentlichung, japanischen Adel begrüßen und die Hand schütteln, eine Einweihung hier, eine Kunstwerkenthüllung dort. Dass es bei der Inszenierung solch symbolischer Politik, die lediglich Medienbilder produzieren soll, mitunter absurd zugehen kann, zeigt "Mr. Governor" zwar mit Fleiß. Foto-Shootings für die Öffentlichkeitsarbeit sind, ausnahmsweise nicht von ihrem Produkt her beobachtet, eine ziemlich alberne Sache; dasselbe gilt für den Politiker auf dem Acker, der symbolisch Samen verstreuen soll und dies mit gelassener Miene denn auch tut, während Mans Manssons Kamera ihm stoisch folgt - ein freilich grandioser Moment, wenngleich nur einer von wenig wirklich geglückten.
Für institutionelle Strukturen, wie das (eben doch nur ästhetische) Vorbild Wiseman, für Erkenntnis interessiert sich Mans Mansson ansonsten herzlich wenig. So geraten die gerade mal 80 Minuten streckenweise zäh, wenn man erneut minutenlang einem Telefongespräch mit irgendwem zu folgen hat, nur weil Anders Björck eben telefoniert oder wenn irgendein Gebäude von außen aussieht wie es eben aussieht.
Thomas Groh
Mans Mansson: "H:r Landshövding - Mr Governor". Dokumentarfilm, Schweden 2008, 81 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Dann fliegt er eben, na und? Francois Ozons "Ricky" (Wettbewerb)
Die falsche Fährte sieht so aus: Katie (Alexandra Lamy) arbeitet in einer Fabrik, in der etwas in etwas gefüllt wird, und lernt da Paco (Sergi Lopez) kennen. Sie sitzen auf einer Bank, sie rauchen eine Zigarette, sie haben Sex auf der Toilette, sie haben ein Date, er zieht bei ihr ein (Sozialbau), Katies Tochter beäugt ihn erst scheel, Katie wird schwanger. Alles sehr oberflächlich erzählt, Francois Ozon zeigt kein besonderes Interesse an genauer Schilderung des Milieus, der sozialen Umstände oder des innerfamiliären Eifersuchtsdramas. Ein paar Signale gestreut, ein paar Zeichen gesetzt, ein paar Andeutungen gemacht, ein paar Mal übers Wasser auf die Wohnblöcke hochgeschwenkt, damit hat es sich. Als die Familie zusammensitzt und Hähnchen isst und Lisa (Melusine Mayance), die Tochter von Katie, einen Flügel verlangt, denkt man sich nichts dabei.

Oh, wie man aber sollte! Dies ist eine Vorausdeutung auf das, was später geschieht. Ricky, das Baby, entwickelt sich seltsam. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er hat Beulen und Wunden an den Schulterblättern. Unvermittelt sitzt er auf dem Schrank. Er schreit, aber nicht weil er zahnt. Ricky flügelt. Aus seinen Schulterblättern wachsen hässliche kleine Flügelchen. Sie wachsen und wachsen, man sieht es, wie anders, mit Staunen. Auch Katie staunt, aber gar nicht so sehr. Sie nimmt, als gute Mutter, ihren Ricky, wie er ist. Dann fliegt er eben, na und?
"Ricky", der Film, allerdings, handelt sich mit dem Flügel-Wunder Probleme ein, die ihn, wenn nicht auf der Stelle, dann doch recht bald um jeden Sinn bringen. Erstens wird die ganze, sowieso eher hingeschluderte Milieu-Exploration auf der Stelle als langer Anlauf erkennbar zu einer Pointe, die den Anlauf selbst und seinen Schein-Realismus komplett entwertet. Der Film ist buchstäblich ein Witz. Ich zitiere aus der Wikipedia: "Als Witz bezeichnet man einen kurzen Text (Erzählung, Wortwechsel, Frage mit Antwort oder Ähnliches), der einen Sachverhalt so mitteilt, dass nach der ersten Darstellung unerwartet eine ganz andere Auffassung zutage tritt." Genau so funktioniert "Ricky". Erwartungen werden aufgebaut und mit einem Schlag dann zerstört. Man ist für ein paar Minuten verblüfft. Dann aber dämmert einem, dass der Film mit seiner Pointe komplett implodiert.

Denn erstens: Es hat seinen Grund, dass der Witz als Erzählform mit Kürze assoziiert wird. Ozons Versuch, ihn auf Spielfilmlänge zu strecken, ist gewiss ein mutiges Experiment, geht aber, wie leider nicht anders zu erwarten, völlig nach hinten los. Es hat, zweitens, seinen guten Grund, dass ein Witz in der Regel mit der Pointe endet. "Ricky" mitnichten. Der Film geht noch weiter, und zwar eine Weile. Nicht als angewandte Witzforschung und also, um weitere überraschende Wendungen zu nehmen, sondern erst mal in mehrfachen Wiederholungen der Pointe. Das Baby fliegt! Das Baby fliegt! Das Baby fliegt! Ozon mischt Boulevardjournalismuskritik darunter, andeutungsweise. Und dann, Rohmers "Komödien und Sprichwörter"-Filme als Farce sozusagen, wird er zur verfilmten Redensart und illustriert, was mit der Wendung "Man muss loslassen können" ganz buchstäblich gemeint sein könnte.
"Ricky" ist ein Witz, und in jeder Hinsicht ein schlechter. Probleme, die man durchaus Ernst nehmen kann - Eifersucht zwischen Geschwistern, Misstrauen zwischen Partnern, der Umgang mit dem Monströsen bzw. einem Wunder -, nimmt er leicht. Aber wie oft bei Ozon das keine Leichtigkeit, hinter der sich in irgendeiner Weise Lebensweisheit verbirgt. Es ist die reine Oberfläche, die Geringschätzung seines Gegenstands und seiner Figuren. Aus einer dünnen Kurzfilmidee macht er ein Film-Souffle. Je genauer man drüber nachdenkt, desto bitterer schmeckt es.
Ekkehard Knörer
Francois Ozon: "Ricky". Mit Alexandra Lamy, Sergi Lopez, Melusine Mayance, Arthur Peyret. Frankreich, Italien 2009, 90 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Obszön: Stephen Daldrys "Der Vorleser - The Reader" (Wettbewerb)
Eine denkwürdige Szene in der letztjährigen Hollywood-Satire "Tropic Thunder" klärt den von Ben Stiller verkörperten Schauspieler darüber auf, warum das mit dem Oscar für seine Performance in "Simple Jack" als geistig behindertes Mannskind mit Herz aus Gold nicht hingehauen hat: Man spielt einfach keine Vollbehinderten. Nur ein bisschen Handicap, dies aber mit Eifer in Richtung Publikumsherzen ausgewalzt, führt zum begehrten goldenen Jungen, siehe etwa "Forrest Gump". Zwar ist nicht überliefert, ob Kate Winslet und Stephen Daldry sich dies zu Herzen genommen haben; doch wenn die von Winslet in "Der Vorleser" verkörperte Ex-KZ-Aufseherin Hanna Schmitz, im fortgeschrittenen Alter und für ihre Verbrechen in der Nazizeit im Gefängnis eingesperrt, sich selbst das Lesen beibringt - ungelenk, mit dem Eifer kindlicher Goldherzen, mit viel Streicherunterlegung -, dann ist das schon nicht nur ein kleines bisschen die taschentuchlastige Ver-Forrest-Gump-ierung einer Nazitäterin.

Überhaupt, die Streicher. Ein ganzes Konzert wurde, scheint's, eingespielt, zu dem der Film ein paar Bilder beisteuert. Nach Frühling klingt es, wenn, freilich früher in den späten 50ern, die herbe und rund 20 Jahre ältere Schmitz den Knaben Michael Berg verführt, bitter-süßlich, wenn diese erotische Affäre nach einem Sommer mit dem plötzlichen Verschwinden der Schmitz zuende geht, hochdramatisch, wenn Berg Jahre später im Jurastudium den Prozess gewahrt, der gegen Schmitz ihrer Naziverbrechen wegen geführt, melodramatisch, wenn Berg darob durchs leere Auschwitzlager stiefelt und er sich entscheidet, die wichtige Information, dass die Schmitz illiterat ist, dem Gericht vorenthält, was sie der Beweislage nach entlasten würde. Denn Berg hat der Schmitz immer aus der Weltliteratur vorgelesen vor dem Sex, und erst jetzt, im Gerichtssaal, wenn's drum geht, eine Handschriftprobe vorzulegen, fällt ihm Schmitzens Defizit wie Schuppen von den Augen.
Ob Berg sich aus narzisstischen Gründen fürs einstige Verlassenwerden rächt, ob er aus blankem Entsetzen über die Verbrechen seiner mütterlichen Geliebten kein entlastendes Zeugnis ablegt, ob das Gefühlschaos, in das er stürzt und von dem er - der Film ist in Rückblenden erzählt - nie wieder ganz genesen wird, ihn zu einem weiteren von Schmitz' Opfern macht, ob sein Schweigen, dass Schmitz jahrzehntelang hinter Gitter bringt, eine Täterschaft ist, sind Fragen, die "The Reader" vollmundig aufdrängt, allein ihre Perspektive schon ist tendenziell falsch, so wie das im Sentiment sich suhlende Melodram, dass Daldry als Form wählt, von vornherein an Zumutung grenzt. So dürfen - immer unterlegt von Streichern, Streichern und noch mehr Streichern - sanft Tränen abgedrückt werden, wenn Berg seinen Beschädigungen nachgeht, sinnierend über die Felder von Auschwitz spaziert und Schmitz im Gefängnis erste von ihm mit Literaturlesungen besprochene Kassetten erhält, anhand derer sie sich das Lesen beibringt, und bitter mitschluchzen darf man, wenn Schmitz schließlich, am Tag ihrer Entlassung, den Freitod in der Zelle wählt: So schlimm ist es, sagt dieser Film, was der Holocaust Menschen antut, vor allem ehemaligen KZ-Aufseherinnen und jungen deutschen Knaben.

Gerade die Freitodszene in der Vollzugsanstalt beinhaltet ein Offenbarungsmoment dieser betrunken an der Grenze zur Obszönität hin und her schwankenden Täter-Vermelodramatisierung: Die Toten von Auschwitz sind in "The Reader" an einer einzigen Stelle nur - und auch hier nur in Form eines indexikalischen Verweises - anwesend, wenn der Student Berg mit demonstrativ entsetztem Gesichtsausdruck an den Massen von im Konzentrationslager gesammelten Schuhe der Opfer vorbeistreicht; wenn Hanna Schmitz in ihrer Zelle den eigenen Tod vorbereitet, zieht auch sie ihre Schuhe aus. Im Close-Up fokussiert der ganze Film auf diesen Vorgang, die Schuhe bleiben, leer, als Überbleibsel einer bald Toten, im Bild zurück, als ließe sich Schuh und Schuh einfach so zusammenzählen (und, fürchtet man, genau solche schlichte Überlegung mag am Ende auch dahinter stecken).
Der Erfolg, auf den allein und nichts anderes "The Reader" mit dem Holzhammer hininszeniert ist, immerhin bestätigt die Wahl der ästhetischen Mittel - und "Tropic Thunder". Nominiert als beste Hauptdarstellerin: Kate Winslet.
Thomas Groh
Stephen Daldry: "The Reader". Mit Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Bruno Ganz, Lena Olin, Hannah Herzsprung, Karoline Herfurth, Matthias Habich, Burghart Klaussner, Alexandra Maria Lara, Jeanette Hain u.v.a. USA, Deutschland 2008. 119 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Erst fließt das Blut, dann fließen die Tränen in Dante Lams "Ching yan - The Beast Stalker" (Forum)
Ein Film über Menschen mit Narben. Der Polizist Tong (Nicholas Tse) hat welche, genau wie sein Partner (Liu Kai Chi). Auch der brutale Entführer Hung (Nick Cheung), den Tong jagt, ist vernarbt, ebenso dessen Frau. Die ist außerdem stumm und muss von Hung ganztägig gepflegt werden. Opfer der Entführung ist die kleine Ling, und auch deren Gesicht wird den Film nicht unbeschadet überstehen. Lings Mutter ist die Staatsanwältin Ann Gao (Zhang Jingchu). Sie soll Hungs Auftraggeber, das ist denn auch der Grund der Entführung, ins Gefängnis bringen. Gleichzeitig ist sie die einzige narbenfreie Figur im Film. Das Gesicht des weiblichen Stars ist auch für einen Dante Lam tabu.

Dante Lam ist kein Johnny To, soviel vorweg. Sein Kino hat nichts von der Eleganz, auch nichts von der formalistischen Spielfreude des derzeit wahrscheinlich einzigen Regisseurs von Weltformat im Hongkong-Kino. Dante Lams Filme - der Triadenstreifen "Jiang Hu" war 2001 ebenfalls im Forum zu sehen, empfehlenswert ist aber vor allem sein wildes Frühwerk "Beast Cops" - sind keine durchgestylten Milkyway-Produktionen, sie sind krude, dreckig und oft ein bisschen trashig. Höchstwahrscheinlich kosten sie auch deutlich weniger Geld als die Produkte der To-Schmiede, gerade die Actionszenen sehen trotz souveränem Handkameraeinsatz nicht allzu teuer aus. Wenn sich in "The Beast Stalker" das Polizeiauto überschlagen soll, schneidet Lam auf eine Nahaufnahme von Tong und seinem Partner, wie sie sich an die Autotür klammern und verängstigte Gesichter schneiden. Nicht für einen Moment entsteht da die Illusion, dass sich die beiden im Moment der Aufnahme tatsächlich in der Luft befinden.
Dass Lams beste Filme, und zu diesen darf man "The Beast Stalker" ruhig zählen, mit so etwas durchkommen, verdanken sie einer dynamischen Regiearbeit, die aus beschränkten Budgets und mittelmäßigen Drehbüchern feines Pulp-Entertainment zimmert. Mit viel Elan und erfrischend wenig Ironie geht Lam dabei zu Werke, er taucht sein Hongkong in besonders knallige Farben, und wenn es hart auf hart kommt, fließt erst jede Menge Blut und danach fließen die Tränen. Zurück bleiben Narben.

Auch "The Beast Stalker" ist bisweilen ein kruder Film. Seinen oben skizzierten Plot organisiert Lam etwas holprig um einen Autounfall herum, in den mehrere der Hauptfiguren verwickelt sind (und auf dessen Konto ein Teil der Narben gehen). Ein wenig im Stil, aber nicht im Geist von Paul Haggis' unerträglicher Rassismusparabel "L.A. Crash", erzählt Lam diesen Unfall mehrmals aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Schicksalsverwicklungen, die dabei konstruiert werden, sind zwar nicht ärgerlich (schließlich fügen sie sich, anders als bei Haggis, nicht zum reaktionären gesellschaftspolitischen Argument, sondern bleiben harmloser Drehbuchunfug), aber doch eher dreist als clever. Beim ersten Durchlauf des Unfalls etwa tötet Tong in einer absurden Drehbuchpointe aus Versehen Lins Schwester und muss sich dann mit Schuldgefühlen gegenüber Ann Gao herumschlagen. Was das ewige Milchgesicht Nicholas Tse, nebenbei bemerkt, rein mimisch überraschend gut hinbekommt. Vielleicht wird der Mann eines Tages doch noch erwachsen.

Der Film hält sich zum Glück mit solchen Schicksalsverrenkungen nicht lange auf. Überhaupt ist die nichtlineare Erzählweise nur ein Gimmick, hinter der alsbald klassisch melodramatische Figurenzeichnungen und -konstellationen zum Vorschein kommen. Der Cop ist tough und ein melancholischer Romantiker, der Gangster ist brutal und ein wilder Romantiker, das Kind ist niedlich. Sogar das Stockholm-Syndrom hat einen Gastauftritt wenn Ling sich gemeinsam mit ihrem Entführer um dessen Frau kümmert. "The Beast Stalker" bleibt in den Grenzen des Genrekinos und fühlt sich dabei so wohl, dass man nicht anders kann, als es ihm gleich zu tun.
Lukas Foerster
Dante Lam: "Ching yan - The Beast Stalker". Mit Nicholas Tse, Nick Cheung, Zhang Jingchu u.a. Hongkong / China 2008, 111 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Alles Empirische muss draußen bleiben in Richard Brouillettes Dokumentarfilm "L'encerclement - Encirclement" (Forum)
Das Genre des globalisierungskritischen Dokumentarfilms ist aus den deutschen Arthauskinos spätestens seit "We Feed the World" und "Darwins Alptraum" nicht mehr wegzudenken. Fische, die sterben, Menschen, die hungern, Turnschuhe, die böse sind: All dies erscheint auf der Leinwand und wird dort, begleitet vom mahnenden Voice-Over-Kommentar, nur allzu schnell selbst zur leicht konsumierbaren Ware und zum Katalysator für sozial- statt neoliberale, aber folgenlose Publikumsempörung. Richard Brouillette will einen Schritt weiter gehen. Es geht ihm, nach eigener Aussage, primär nicht um die Globalisierung der Wirtschaft, sondern um den globalen Siegeszug der neoliberalen Ideologie. Anfang 2008 entstanden, scheint Brouillettes 160-minütigem Film nach dem Ausbruch der Finanzkrise eine gesteigerte Aktualität zu eignen.

Brouillette organisiert seinen Film in zehn Kapiteln. "L'Encerclement: La democratie dans les rets du neoliberalisme" (Die Umzingelung: Demokratie in den Fängen des Neoliberalismus) setzt mit einem historischen Abriss ein. Der moderne Neoliberalismus entstand, so lernen wir, in den siebziger Jahren als antidemokratische Antwort konservativer Eliten auf die emanzipatorischen Bestrebungen der Sechziger Jahre. Institutioneller Kern des Neoliberalismus sind konservative Think Tanks, die steuerrechtlich besser dastehen als beispielsweise Greenpeace, weil niemand ihren Nutzen für die Allgemeinheit in Frage stellt. Anschließend beschäftigt sich der Film mit den philosophischen und wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen der Ideologie und derer Verbreitung via Bildung und Medien. Schließlich fährt Brouillette in den beiden letzten Kapiteln schwereres Geschütz auf und bringt den Neoliberalismus in Zusammenhang mit einer neuen Form von Kolonialismus.



Noam Chomsky, Donald J. Boudreaux und Jean-Luc Migue
Der Film ist aufgebaut wie ein rhetorisches Argument. Da ist es dann nur folgerichtig, dass "L'Encerclement" vor allem auf das gesprochene Wort setzt. Der Film besteht fast ausschließlich aus Großaufnahmen von selbsterklärten oder tatsächlichen Neoliberalismusexperten, aus Talking Heads, vorwiegend hinter hohen Bücherstapeln, die den jeweiligen Argumentationsstrang ausformulieren. Viele Ökonomen kommen zu Wort, einige Soziologen, mehrere Attac-Aktivisten und natürlich Noam Chomsky, seines Zeichens Linguist, Allzweckintellektueller und in den letzten Jahren fast schon ein Muss für linken middlebrow-Agitprop.
Es ist eine sonderbare Form des Diskurses, die da entsteht: Die Expertenausführungen werden nicht in einen Interviewzusammenhang eingelassen, sind aber auch keine direkten Zitate aus Aufsätzen oder Büchern der Sprecher. Man kann zwar davon ausgehen, dass die Ausgestaltung der Monologe ausschließlich vom jeweiligen Experten zu verantworten war; Brouillette legt Wert darauf, dass dem auch tatsächlich so ist. Aber dennoch passen diese Monologe sich stets allzu genau ein in Brouillettes Gesamtargument. Man darf sich dann schon fragen, wer da eigentlich spricht: Brouillette oder der Experte?
In einem Dokumentarfilm sollte man sich eine solche Frage nicht stellen müssen. Außerdem bleibt den Experten im Film eben nur die Rhetorik im engeren Sinne, die Kunst des gut gewählten Worts. Alles Empirische muss draußen bleiben, allzu komplexe Argumentationslinien ebenfalls. Wenn Bernard Maris äußerst eloquent über den Schwachsinn des Neoliberlalismus doziert, bekommt man durchaus Lust, sein soeben erschienenes Buch "Capitalisme et pulsion de mort: Freud et Keynes" (gemeinsam verfasst mit Gilles Dostaler) zu lesen. Ersetzen aber kann der Film eine solche Lektüre in keiner Weise. Ausgerechnet die kurzen Einschübe zwischen den Monologen, die deren Argumentation mit düster antikapitalistischen Parolen in Schriftform unterfüttern und die Brouillette mit expressiver Klaviermusik unterlegt, sind in mancher Hinsicht noch das Ehrlichste in diesem Film.



Michel Chossudovsky, Susan George und Filmemacher Richard Brouillette
Auch Verfechter des Neoliberalismus kommen zu Wort: Im vierten Kapitel "Brief Liberal Anthology - Libertarianism and the Theory of Public Choice" sprechen Ökonomen wie Jean-Luc Migue und Donald J. Boudreaux (teilweise ebenfalls äußerst eloquent) über den libertären Freiheitsbegriff und die Übel des Sozialstaates. Ein Dialog entzündet sich an diesen Ausführungen nicht, da sie zwar notwendiger Bestandteil der internen Dialektik des Films sind, aber keinen Eigenwert haben dürfen.
Man kann dem Film schon das eine oder andere zugute halten. Zum Beispiel, dass er sich fernhält von Verschwörungstheorien und statt dessen versucht, konkrete Manifestationen neoliberaler Einflussnahme in Staaten und Organisationen zu identifizieren. Zum Beispiel in der Verfassung von Bosnien-Herzegowina, die in den neunziger Jahren von amerikanischen Bürokraten aufgesetzt wurde und die die Währungspolitik des Landes direkt der Weltbank unterstellt. Oder in den Rechtsstatuten der WTO, nach denen kleine Geheimgremien, die effektiv von keiner Instanz kontrolliert werden, in zwischenstaatlichen Handelsstreitigkeiten entscheiden und im schlimmsten Fall ganze Volkswirtschaften in den Ruin stürzen können. Freilich erfährt man auch das ausschließlich via Expertenrhetorik, in diesem Fall via Susan George und Michel Chossudovsky. Das Problem von "L'Encerclement" ist, dass er eher Predigt als eine ergebnisoffene Auseinandersetzung mit seinem Sujet ist. Da nützt auch alle Aktualität nichts.
Lukas Foerster
Richard Brouillette: "L'encerclement - Encirclement". Dokumentarfilm. Kanada 2008, 160 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Im Autoradio singen die Pet Shop Boys "I love you, you pay my rent", auf der Rückbank des klapprigen Dacia liegt Delia, fühlt sich hundeelend und muss sich von ihren Eltern nerven lassen, die gar nicht merken, wie sie ihr den großen Tag, die Chance ihres Lebens verderben: Im Preisausschreiben hat sie ein Auto gewonnen und, damit alle Welt mitbekommt, wie großzügig dieser Safthersteller gegenüber einfachen Menschen aus der Provinz ist, muss sie in einem Werbeclip auftreten und beteuern: "Ich bin Delia Cristina Fratila, und ich bin das glücklichste Mädchen der Welt."

Man ahnt sehr schnell, worauf dies hinausläuft: Natürlich ist Delia (schön verstockt gespielt von Andrea Bosneag) mit ihrem Übergewicht, dem toupierten Haar und den Pickeln absolut nicht sexy genug für das coole Bukarest, und jeder lässt es sie spüren. Immer wieder müssen die Szenen neu gedreht werden, und das Leichteste, was Delia dabei herunterzuschlucken hat, ist der halbe Liter O-Saft pro Aufnahme. Damit er besser aussieht, wird er mit Cola versetzt. Nach jeder vermasselten Szene lassen die Werber mehr Frust an Delia aus. Geht es nicht auch ein bisschen zielorientierter? Weniger phlegmatisch? Ohne die hässliche blaue Jacke? Ohne den Damenbart? Aber wehe sie lächelt nicht herzlich genug zu ihrem bescheuerten Spruch.
Genau hier will Delia aber hin, ins kalte Bukarest, an die Universität, mit dem schicken neuen Auto, weg aus dem Provinzkaff, weg von ihren Eltern, die das Auto lieber verkaufen wollen, um selbst mit dem Geld eine Pension zu eröffnen. Als sie dies ihrer Mutter (Violeta Popa mit herrlich rumänischer Grandezza) eröffnet, bricht hinterm Filmset die Hölle los. Aus dem Kampf ums Auto wird der Kampf um die Sehnsüchte und das bisschen Glück, auf das jeder ein Anrecht zu haben meint. Schließlich hat der Vater Diabetes, die Mutter auf alles verzichtet, und Delia überhaupt keinen Führerschein.

"The Happiest Girl in the World" lief vor einem Jahr auf dem Sundance Filmfestival, es ist Radu Judes erster Spielfilm. Zuvor hat er als Werbefilmer sowie als Assistent bei Cristi Puiu gearbeitet. Und ganz wie es sich für einen Regisseur der rumänischen Schule gehört, verzichtet Jude auf jede suggestivere Form der Bildführung. Die Kamera bleibt an dem Platz, für den sie sich einmal entschieden hat, oft mehrere Minuten lang ohne Schnitt, schwenkt mal ein wenig nach links und nach rechts, hält aber immer Äquidistanz, wenn Mutter und Tochter, Vater und Tochter oder alle drei gegen- und miteinander ringen. Je härter die Bandagen werden, mit denen die Eltern und die Filmleute Delia zusetzen, umso größere Kräfte entwickelt dieses Mädchen, das sich an das Auto, an die Chance auf ein Leben in Bukarest genauso fest klammert wie an ihre gehäkelte Handtasche mit den Glasperlen.
Thekla Dannenberg
Radu Jude: "Cea mai fericita fata din lume - The Happiest Girl in the World". Mit Andreea Bosneag, Violeta Popa und Vasile Muraru. Rumänien, Niederlande 2008, 100 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Asghar Farhadis "Darbareye Elly - About Elly" (Wettbewerb)
Hochzeitsanbahnungsvorbereitungen auf dem Lande. Ein Ausflug. Ehepaare mit Kindern, plus zwei Singles. Der Mann ist nur für eine gute Woche aus Deutschland zu Besuch und geschieden. Die Frau heißt Elly, ist Kindergärtnerin, eigentlich kennt sie keiner. Nicht einmal ihren ganzen Namen wissen sie. Was genau sich alle dabei denken, wissen wir nicht, der Film wirft uns erst einmal hinein in diese Situation. Alles ist erst einmal ganz alltäglich. Sepide, eine der verheirateten Frauen, hat die Hauptrolle der wohlmeinenden Intrigantin inne. Sie hat das alles eingefädelt, Elly unter einem Vorwand mit eingeladen und will sie in Wahrheit verkuppeln. Auch sonst kennt Sepide nichts, wenn es darum geht, den eigenen Wünschen auf die Sprünge zu helfen. Als sich herausstellt, dass die gemietete Villa nicht für die geplanten drei Nächte frei ist, erzählt sie der Vermieterin, dass Elly und Ahmed das bereits sind, was sie, wenn der Plan aufgeht, erst werden sollen: ein Ehepaar auf Hochzeitsreise. Da werden die Vermieter weich und stellen ein heruntergekommenes Strandhaus zur Verfügung.

Man richtet sich häuslich ein für entspannte Tage. Der Boiler wird eingebaut und funktioniert, die Löcher in den Fenstern werden abgedichtet, abends spielt man zur Unterhaltung Scharaden. Elly, die, erfahren wir, nicht weiß, was Sepide da im Schilde führt, und Ahmed, der, erfahren wir, weiß, worum es geht, kommen sich näher, im Auto. Alles macht bis dahin einen ganz alltäglichen Eindruck, die Kamera gibt sich, oft aus der Hand geführt, wie der flotte Schnitt kolloquial, Musik gibt es nicht. In diese Beobachtung einer freundlichen Gemeinschaft setzt Asghar Farhadi mit einem Knall ein Ereignis, das die ganze Situation neu konfiguriert. Erst ertrinkt um ein Haar eines der Kinder - und dann stellt sich heraus: Elly ist verschwunden. Alle befürchten, sie könnte ertrunken sein; man sucht, aber ihr Körper taucht nicht auf.

Regisseur Asghar Farhadi hat sich nicht nur im Film, sondern auch als Mann des Theaters im Iran einen Namen gemacht. Wie ein Theaterstück funktioniert in der Tat "About Elly". Nicht zuletzt in der informationspolitischen Cleverness, mit der nach und nach Dinge enthüllt werden, die manches doch in einem anderen Licht erscheinen lassen, als es zuvor erschien. Beinahe bleibt die Einheit von Raum, Zeit und Handlung gewahrt. Und Farhadi hat mit seiner Gemeinschaftsaufstellung, in der er mal gewaltsam, mal behutsam Menschen und Dinge und Verhältnisse verschiebt und wendet und dreht, durchaus immer auch die Gesellschaft als ganze im Blick. Moralvorstellungen werden auf die Probe gestellt, latente Feindschaften brechen auf, Religion ist im Spiel, aber nur am Rande. (Ganz genau beurteilen können wird man dieses und jenes nur mit sehr guter Kenntnis der iranischen Gesellschaft; einfach so aufs Allgemeinmenschliche will der Film nicht hinaus.)
Dennoch. Mehr als ein "well made play" ist das nicht. Das Verschwinden und Verschwundenbleiben von Elly fungiert dramaturgisch als Spannungseffekt, aber auf Dauer nimmt man gerade diesen gekonnten Einsatz der Mittel doch etwas übel. Zumal sich das Karussell der aufbrechenden Konflikte und Leidenschaften doch insgesamt eher gemächlich dreht. Und am Ende, wenn die Mittel erschöpft sind, ist man's als Zuschauer auch.
Ekkehard Knörer
Asghar Farhadi: "Darbareye Elly - About Elly". Mit Golshifteh Farahani, Taraneh Alidousti, Mani Haghighi, Saber Abar. Iran 2009, 119 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Verstreut symbolisch Samen: Mans Manssons "H:r Landshövding - Mr Governor" (Forum)
Ein Film über die Arbeit des schwedischen Politikers und einstigen Verteidigungsministers Anders Björck, gedreht auf grobkörnigem 16mm-Material, in Schwarzweiß und mit vielen langen Einstellungen, in denen wir Björck beim Essen, beim Telefonieren, beim Notizenmachen sehen. Da denkt man an das Cinema Verite. An die Meister der Form, die Maysles Brothers und Frederick Wiseman, der vor zwei Jahren selbst im Forum mit dem meisterlichen "State Legislature" Einblick in die Gesetzesentwicklungsprozesse in Idaho gestattete.
Solches Wollen der Form gibt "Mr. Governor" an jeder Stelle zu erkennen, genau darin liegt seine Schwäche: 16 Millimeter und grobes Korn, Schwarzweiß und lange Einstellungen sind, auch gut abgeschaut, an sich noch keine Filmkunst. Bei den Maysles und Wiseman ergeben sich lange Einstellungen aus der beobachteten Haltung, aus dem Gegenstand heraus, hier sind sie, wenn man das Gebäude sieht, in dem Björck seinem Werk nach geht, oder wenn Björck auf kleine Blättchen Notizen schreibt, oft nur deshalb schon lang, weil sie eben lang sein sollen.
"Mr. Governor" findet und zweigt wenig. Die Aufgaben von Anders Björck beschränken sich im wesentlichen auf Repräsentation. Eine Gartenschau, eine Buchveröffentlichung, japanischen Adel begrüßen und die Hand schütteln, eine Einweihung hier, eine Kunstwerkenthüllung dort. Dass es bei der Inszenierung solch symbolischer Politik, die lediglich Medienbilder produzieren soll, mitunter absurd zugehen kann, zeigt "Mr. Governor" zwar mit Fleiß. Foto-Shootings für die Öffentlichkeitsarbeit sind, ausnahmsweise nicht von ihrem Produkt her beobachtet, eine ziemlich alberne Sache; dasselbe gilt für den Politiker auf dem Acker, der symbolisch Samen verstreuen soll und dies mit gelassener Miene denn auch tut, während Mans Manssons Kamera ihm stoisch folgt - ein freilich grandioser Moment, wenngleich nur einer von wenig wirklich geglückten.
Für institutionelle Strukturen, wie das (eben doch nur ästhetische) Vorbild Wiseman, für Erkenntnis interessiert sich Mans Mansson ansonsten herzlich wenig. So geraten die gerade mal 80 Minuten streckenweise zäh, wenn man erneut minutenlang einem Telefongespräch mit irgendwem zu folgen hat, nur weil Anders Björck eben telefoniert oder wenn irgendein Gebäude von außen aussieht wie es eben aussieht.
Thomas Groh
Mans Mansson: "H:r Landshövding - Mr Governor". Dokumentarfilm, Schweden 2008, 81 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Dann fliegt er eben, na und? Francois Ozons "Ricky" (Wettbewerb)
Die falsche Fährte sieht so aus: Katie (Alexandra Lamy) arbeitet in einer Fabrik, in der etwas in etwas gefüllt wird, und lernt da Paco (Sergi Lopez) kennen. Sie sitzen auf einer Bank, sie rauchen eine Zigarette, sie haben Sex auf der Toilette, sie haben ein Date, er zieht bei ihr ein (Sozialbau), Katies Tochter beäugt ihn erst scheel, Katie wird schwanger. Alles sehr oberflächlich erzählt, Francois Ozon zeigt kein besonderes Interesse an genauer Schilderung des Milieus, der sozialen Umstände oder des innerfamiliären Eifersuchtsdramas. Ein paar Signale gestreut, ein paar Zeichen gesetzt, ein paar Andeutungen gemacht, ein paar Mal übers Wasser auf die Wohnblöcke hochgeschwenkt, damit hat es sich. Als die Familie zusammensitzt und Hähnchen isst und Lisa (Melusine Mayance), die Tochter von Katie, einen Flügel verlangt, denkt man sich nichts dabei.

Oh, wie man aber sollte! Dies ist eine Vorausdeutung auf das, was später geschieht. Ricky, das Baby, entwickelt sich seltsam. Irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er hat Beulen und Wunden an den Schulterblättern. Unvermittelt sitzt er auf dem Schrank. Er schreit, aber nicht weil er zahnt. Ricky flügelt. Aus seinen Schulterblättern wachsen hässliche kleine Flügelchen. Sie wachsen und wachsen, man sieht es, wie anders, mit Staunen. Auch Katie staunt, aber gar nicht so sehr. Sie nimmt, als gute Mutter, ihren Ricky, wie er ist. Dann fliegt er eben, na und?
"Ricky", der Film, allerdings, handelt sich mit dem Flügel-Wunder Probleme ein, die ihn, wenn nicht auf der Stelle, dann doch recht bald um jeden Sinn bringen. Erstens wird die ganze, sowieso eher hingeschluderte Milieu-Exploration auf der Stelle als langer Anlauf erkennbar zu einer Pointe, die den Anlauf selbst und seinen Schein-Realismus komplett entwertet. Der Film ist buchstäblich ein Witz. Ich zitiere aus der Wikipedia: "Als Witz bezeichnet man einen kurzen Text (Erzählung, Wortwechsel, Frage mit Antwort oder Ähnliches), der einen Sachverhalt so mitteilt, dass nach der ersten Darstellung unerwartet eine ganz andere Auffassung zutage tritt." Genau so funktioniert "Ricky". Erwartungen werden aufgebaut und mit einem Schlag dann zerstört. Man ist für ein paar Minuten verblüfft. Dann aber dämmert einem, dass der Film mit seiner Pointe komplett implodiert.

Denn erstens: Es hat seinen Grund, dass der Witz als Erzählform mit Kürze assoziiert wird. Ozons Versuch, ihn auf Spielfilmlänge zu strecken, ist gewiss ein mutiges Experiment, geht aber, wie leider nicht anders zu erwarten, völlig nach hinten los. Es hat, zweitens, seinen guten Grund, dass ein Witz in der Regel mit der Pointe endet. "Ricky" mitnichten. Der Film geht noch weiter, und zwar eine Weile. Nicht als angewandte Witzforschung und also, um weitere überraschende Wendungen zu nehmen, sondern erst mal in mehrfachen Wiederholungen der Pointe. Das Baby fliegt! Das Baby fliegt! Das Baby fliegt! Ozon mischt Boulevardjournalismuskritik darunter, andeutungsweise. Und dann, Rohmers "Komödien und Sprichwörter"-Filme als Farce sozusagen, wird er zur verfilmten Redensart und illustriert, was mit der Wendung "Man muss loslassen können" ganz buchstäblich gemeint sein könnte.
"Ricky" ist ein Witz, und in jeder Hinsicht ein schlechter. Probleme, die man durchaus Ernst nehmen kann - Eifersucht zwischen Geschwistern, Misstrauen zwischen Partnern, der Umgang mit dem Monströsen bzw. einem Wunder -, nimmt er leicht. Aber wie oft bei Ozon das keine Leichtigkeit, hinter der sich in irgendeiner Weise Lebensweisheit verbirgt. Es ist die reine Oberfläche, die Geringschätzung seines Gegenstands und seiner Figuren. Aus einer dünnen Kurzfilmidee macht er ein Film-Souffle. Je genauer man drüber nachdenkt, desto bitterer schmeckt es.
Ekkehard Knörer
Francois Ozon: "Ricky". Mit Alexandra Lamy, Sergi Lopez, Melusine Mayance, Arthur Peyret. Frankreich, Italien 2009, 90 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Obszön: Stephen Daldrys "Der Vorleser - The Reader" (Wettbewerb)
Eine denkwürdige Szene in der letztjährigen Hollywood-Satire "Tropic Thunder" klärt den von Ben Stiller verkörperten Schauspieler darüber auf, warum das mit dem Oscar für seine Performance in "Simple Jack" als geistig behindertes Mannskind mit Herz aus Gold nicht hingehauen hat: Man spielt einfach keine Vollbehinderten. Nur ein bisschen Handicap, dies aber mit Eifer in Richtung Publikumsherzen ausgewalzt, führt zum begehrten goldenen Jungen, siehe etwa "Forrest Gump". Zwar ist nicht überliefert, ob Kate Winslet und Stephen Daldry sich dies zu Herzen genommen haben; doch wenn die von Winslet in "Der Vorleser" verkörperte Ex-KZ-Aufseherin Hanna Schmitz, im fortgeschrittenen Alter und für ihre Verbrechen in der Nazizeit im Gefängnis eingesperrt, sich selbst das Lesen beibringt - ungelenk, mit dem Eifer kindlicher Goldherzen, mit viel Streicherunterlegung -, dann ist das schon nicht nur ein kleines bisschen die taschentuchlastige Ver-Forrest-Gump-ierung einer Nazitäterin.

Überhaupt, die Streicher. Ein ganzes Konzert wurde, scheint's, eingespielt, zu dem der Film ein paar Bilder beisteuert. Nach Frühling klingt es, wenn, freilich früher in den späten 50ern, die herbe und rund 20 Jahre ältere Schmitz den Knaben Michael Berg verführt, bitter-süßlich, wenn diese erotische Affäre nach einem Sommer mit dem plötzlichen Verschwinden der Schmitz zuende geht, hochdramatisch, wenn Berg Jahre später im Jurastudium den Prozess gewahrt, der gegen Schmitz ihrer Naziverbrechen wegen geführt, melodramatisch, wenn Berg darob durchs leere Auschwitzlager stiefelt und er sich entscheidet, die wichtige Information, dass die Schmitz illiterat ist, dem Gericht vorenthält, was sie der Beweislage nach entlasten würde. Denn Berg hat der Schmitz immer aus der Weltliteratur vorgelesen vor dem Sex, und erst jetzt, im Gerichtssaal, wenn's drum geht, eine Handschriftprobe vorzulegen, fällt ihm Schmitzens Defizit wie Schuppen von den Augen.
Ob Berg sich aus narzisstischen Gründen fürs einstige Verlassenwerden rächt, ob er aus blankem Entsetzen über die Verbrechen seiner mütterlichen Geliebten kein entlastendes Zeugnis ablegt, ob das Gefühlschaos, in das er stürzt und von dem er - der Film ist in Rückblenden erzählt - nie wieder ganz genesen wird, ihn zu einem weiteren von Schmitz' Opfern macht, ob sein Schweigen, dass Schmitz jahrzehntelang hinter Gitter bringt, eine Täterschaft ist, sind Fragen, die "The Reader" vollmundig aufdrängt, allein ihre Perspektive schon ist tendenziell falsch, so wie das im Sentiment sich suhlende Melodram, dass Daldry als Form wählt, von vornherein an Zumutung grenzt. So dürfen - immer unterlegt von Streichern, Streichern und noch mehr Streichern - sanft Tränen abgedrückt werden, wenn Berg seinen Beschädigungen nachgeht, sinnierend über die Felder von Auschwitz spaziert und Schmitz im Gefängnis erste von ihm mit Literaturlesungen besprochene Kassetten erhält, anhand derer sie sich das Lesen beibringt, und bitter mitschluchzen darf man, wenn Schmitz schließlich, am Tag ihrer Entlassung, den Freitod in der Zelle wählt: So schlimm ist es, sagt dieser Film, was der Holocaust Menschen antut, vor allem ehemaligen KZ-Aufseherinnen und jungen deutschen Knaben.

Gerade die Freitodszene in der Vollzugsanstalt beinhaltet ein Offenbarungsmoment dieser betrunken an der Grenze zur Obszönität hin und her schwankenden Täter-Vermelodramatisierung: Die Toten von Auschwitz sind in "The Reader" an einer einzigen Stelle nur - und auch hier nur in Form eines indexikalischen Verweises - anwesend, wenn der Student Berg mit demonstrativ entsetztem Gesichtsausdruck an den Massen von im Konzentrationslager gesammelten Schuhe der Opfer vorbeistreicht; wenn Hanna Schmitz in ihrer Zelle den eigenen Tod vorbereitet, zieht auch sie ihre Schuhe aus. Im Close-Up fokussiert der ganze Film auf diesen Vorgang, die Schuhe bleiben, leer, als Überbleibsel einer bald Toten, im Bild zurück, als ließe sich Schuh und Schuh einfach so zusammenzählen (und, fürchtet man, genau solche schlichte Überlegung mag am Ende auch dahinter stecken).
Der Erfolg, auf den allein und nichts anderes "The Reader" mit dem Holzhammer hininszeniert ist, immerhin bestätigt die Wahl der ästhetischen Mittel - und "Tropic Thunder". Nominiert als beste Hauptdarstellerin: Kate Winslet.
Thomas Groh
Stephen Daldry: "The Reader". Mit Kate Winslet, Ralph Fiennes, David Kross, Bruno Ganz, Lena Olin, Hannah Herzsprung, Karoline Herfurth, Matthias Habich, Burghart Klaussner, Alexandra Maria Lara, Jeanette Hain u.v.a. USA, Deutschland 2008. 119 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Erst fließt das Blut, dann fließen die Tränen in Dante Lams "Ching yan - The Beast Stalker" (Forum)
Ein Film über Menschen mit Narben. Der Polizist Tong (Nicholas Tse) hat welche, genau wie sein Partner (Liu Kai Chi). Auch der brutale Entführer Hung (Nick Cheung), den Tong jagt, ist vernarbt, ebenso dessen Frau. Die ist außerdem stumm und muss von Hung ganztägig gepflegt werden. Opfer der Entführung ist die kleine Ling, und auch deren Gesicht wird den Film nicht unbeschadet überstehen. Lings Mutter ist die Staatsanwältin Ann Gao (Zhang Jingchu). Sie soll Hungs Auftraggeber, das ist denn auch der Grund der Entführung, ins Gefängnis bringen. Gleichzeitig ist sie die einzige narbenfreie Figur im Film. Das Gesicht des weiblichen Stars ist auch für einen Dante Lam tabu.

Dante Lam ist kein Johnny To, soviel vorweg. Sein Kino hat nichts von der Eleganz, auch nichts von der formalistischen Spielfreude des derzeit wahrscheinlich einzigen Regisseurs von Weltformat im Hongkong-Kino. Dante Lams Filme - der Triadenstreifen "Jiang Hu" war 2001 ebenfalls im Forum zu sehen, empfehlenswert ist aber vor allem sein wildes Frühwerk "Beast Cops" - sind keine durchgestylten Milkyway-Produktionen, sie sind krude, dreckig und oft ein bisschen trashig. Höchstwahrscheinlich kosten sie auch deutlich weniger Geld als die Produkte der To-Schmiede, gerade die Actionszenen sehen trotz souveränem Handkameraeinsatz nicht allzu teuer aus. Wenn sich in "The Beast Stalker" das Polizeiauto überschlagen soll, schneidet Lam auf eine Nahaufnahme von Tong und seinem Partner, wie sie sich an die Autotür klammern und verängstigte Gesichter schneiden. Nicht für einen Moment entsteht da die Illusion, dass sich die beiden im Moment der Aufnahme tatsächlich in der Luft befinden.
Dass Lams beste Filme, und zu diesen darf man "The Beast Stalker" ruhig zählen, mit so etwas durchkommen, verdanken sie einer dynamischen Regiearbeit, die aus beschränkten Budgets und mittelmäßigen Drehbüchern feines Pulp-Entertainment zimmert. Mit viel Elan und erfrischend wenig Ironie geht Lam dabei zu Werke, er taucht sein Hongkong in besonders knallige Farben, und wenn es hart auf hart kommt, fließt erst jede Menge Blut und danach fließen die Tränen. Zurück bleiben Narben.

Auch "The Beast Stalker" ist bisweilen ein kruder Film. Seinen oben skizzierten Plot organisiert Lam etwas holprig um einen Autounfall herum, in den mehrere der Hauptfiguren verwickelt sind (und auf dessen Konto ein Teil der Narben gehen). Ein wenig im Stil, aber nicht im Geist von Paul Haggis' unerträglicher Rassismusparabel "L.A. Crash", erzählt Lam diesen Unfall mehrmals aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Schicksalsverwicklungen, die dabei konstruiert werden, sind zwar nicht ärgerlich (schließlich fügen sie sich, anders als bei Haggis, nicht zum reaktionären gesellschaftspolitischen Argument, sondern bleiben harmloser Drehbuchunfug), aber doch eher dreist als clever. Beim ersten Durchlauf des Unfalls etwa tötet Tong in einer absurden Drehbuchpointe aus Versehen Lins Schwester und muss sich dann mit Schuldgefühlen gegenüber Ann Gao herumschlagen. Was das ewige Milchgesicht Nicholas Tse, nebenbei bemerkt, rein mimisch überraschend gut hinbekommt. Vielleicht wird der Mann eines Tages doch noch erwachsen.

Der Film hält sich zum Glück mit solchen Schicksalsverrenkungen nicht lange auf. Überhaupt ist die nichtlineare Erzählweise nur ein Gimmick, hinter der alsbald klassisch melodramatische Figurenzeichnungen und -konstellationen zum Vorschein kommen. Der Cop ist tough und ein melancholischer Romantiker, der Gangster ist brutal und ein wilder Romantiker, das Kind ist niedlich. Sogar das Stockholm-Syndrom hat einen Gastauftritt wenn Ling sich gemeinsam mit ihrem Entführer um dessen Frau kümmert. "The Beast Stalker" bleibt in den Grenzen des Genrekinos und fühlt sich dabei so wohl, dass man nicht anders kann, als es ihm gleich zu tun.
Lukas Foerster
Dante Lam: "Ching yan - The Beast Stalker". Mit Nicholas Tse, Nick Cheung, Zhang Jingchu u.a. Hongkong / China 2008, 111 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Alles Empirische muss draußen bleiben in Richard Brouillettes Dokumentarfilm "L'encerclement - Encirclement" (Forum)
Das Genre des globalisierungskritischen Dokumentarfilms ist aus den deutschen Arthauskinos spätestens seit "We Feed the World" und "Darwins Alptraum" nicht mehr wegzudenken. Fische, die sterben, Menschen, die hungern, Turnschuhe, die böse sind: All dies erscheint auf der Leinwand und wird dort, begleitet vom mahnenden Voice-Over-Kommentar, nur allzu schnell selbst zur leicht konsumierbaren Ware und zum Katalysator für sozial- statt neoliberale, aber folgenlose Publikumsempörung. Richard Brouillette will einen Schritt weiter gehen. Es geht ihm, nach eigener Aussage, primär nicht um die Globalisierung der Wirtschaft, sondern um den globalen Siegeszug der neoliberalen Ideologie. Anfang 2008 entstanden, scheint Brouillettes 160-minütigem Film nach dem Ausbruch der Finanzkrise eine gesteigerte Aktualität zu eignen.

Brouillette organisiert seinen Film in zehn Kapiteln. "L'Encerclement: La democratie dans les rets du neoliberalisme" (Die Umzingelung: Demokratie in den Fängen des Neoliberalismus) setzt mit einem historischen Abriss ein. Der moderne Neoliberalismus entstand, so lernen wir, in den siebziger Jahren als antidemokratische Antwort konservativer Eliten auf die emanzipatorischen Bestrebungen der Sechziger Jahre. Institutioneller Kern des Neoliberalismus sind konservative Think Tanks, die steuerrechtlich besser dastehen als beispielsweise Greenpeace, weil niemand ihren Nutzen für die Allgemeinheit in Frage stellt. Anschließend beschäftigt sich der Film mit den philosophischen und wirtschaftswissenschaftlichen Grundlagen der Ideologie und derer Verbreitung via Bildung und Medien. Schließlich fährt Brouillette in den beiden letzten Kapiteln schwereres Geschütz auf und bringt den Neoliberalismus in Zusammenhang mit einer neuen Form von Kolonialismus.



Noam Chomsky, Donald J. Boudreaux und Jean-Luc Migue
Der Film ist aufgebaut wie ein rhetorisches Argument. Da ist es dann nur folgerichtig, dass "L'Encerclement" vor allem auf das gesprochene Wort setzt. Der Film besteht fast ausschließlich aus Großaufnahmen von selbsterklärten oder tatsächlichen Neoliberalismusexperten, aus Talking Heads, vorwiegend hinter hohen Bücherstapeln, die den jeweiligen Argumentationsstrang ausformulieren. Viele Ökonomen kommen zu Wort, einige Soziologen, mehrere Attac-Aktivisten und natürlich Noam Chomsky, seines Zeichens Linguist, Allzweckintellektueller und in den letzten Jahren fast schon ein Muss für linken middlebrow-Agitprop.
Es ist eine sonderbare Form des Diskurses, die da entsteht: Die Expertenausführungen werden nicht in einen Interviewzusammenhang eingelassen, sind aber auch keine direkten Zitate aus Aufsätzen oder Büchern der Sprecher. Man kann zwar davon ausgehen, dass die Ausgestaltung der Monologe ausschließlich vom jeweiligen Experten zu verantworten war; Brouillette legt Wert darauf, dass dem auch tatsächlich so ist. Aber dennoch passen diese Monologe sich stets allzu genau ein in Brouillettes Gesamtargument. Man darf sich dann schon fragen, wer da eigentlich spricht: Brouillette oder der Experte?
In einem Dokumentarfilm sollte man sich eine solche Frage nicht stellen müssen. Außerdem bleibt den Experten im Film eben nur die Rhetorik im engeren Sinne, die Kunst des gut gewählten Worts. Alles Empirische muss draußen bleiben, allzu komplexe Argumentationslinien ebenfalls. Wenn Bernard Maris äußerst eloquent über den Schwachsinn des Neoliberlalismus doziert, bekommt man durchaus Lust, sein soeben erschienenes Buch "Capitalisme et pulsion de mort: Freud et Keynes" (gemeinsam verfasst mit Gilles Dostaler) zu lesen. Ersetzen aber kann der Film eine solche Lektüre in keiner Weise. Ausgerechnet die kurzen Einschübe zwischen den Monologen, die deren Argumentation mit düster antikapitalistischen Parolen in Schriftform unterfüttern und die Brouillette mit expressiver Klaviermusik unterlegt, sind in mancher Hinsicht noch das Ehrlichste in diesem Film.



Michel Chossudovsky, Susan George und Filmemacher Richard Brouillette
Auch Verfechter des Neoliberalismus kommen zu Wort: Im vierten Kapitel "Brief Liberal Anthology - Libertarianism and the Theory of Public Choice" sprechen Ökonomen wie Jean-Luc Migue und Donald J. Boudreaux (teilweise ebenfalls äußerst eloquent) über den libertären Freiheitsbegriff und die Übel des Sozialstaates. Ein Dialog entzündet sich an diesen Ausführungen nicht, da sie zwar notwendiger Bestandteil der internen Dialektik des Films sind, aber keinen Eigenwert haben dürfen.
Man kann dem Film schon das eine oder andere zugute halten. Zum Beispiel, dass er sich fernhält von Verschwörungstheorien und statt dessen versucht, konkrete Manifestationen neoliberaler Einflussnahme in Staaten und Organisationen zu identifizieren. Zum Beispiel in der Verfassung von Bosnien-Herzegowina, die in den neunziger Jahren von amerikanischen Bürokraten aufgesetzt wurde und die die Währungspolitik des Landes direkt der Weltbank unterstellt. Oder in den Rechtsstatuten der WTO, nach denen kleine Geheimgremien, die effektiv von keiner Instanz kontrolliert werden, in zwischenstaatlichen Handelsstreitigkeiten entscheiden und im schlimmsten Fall ganze Volkswirtschaften in den Ruin stürzen können. Freilich erfährt man auch das ausschließlich via Expertenrhetorik, in diesem Fall via Susan George und Michel Chossudovsky. Das Problem von "L'Encerclement" ist, dass er eher Predigt als eine ergebnisoffene Auseinandersetzung mit seinem Sujet ist. Da nützt auch alle Aktualität nichts.
Lukas Foerster
Richard Brouillette: "L'encerclement - Encirclement". Dokumentarfilm. Kanada 2008, 160 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Kommentieren