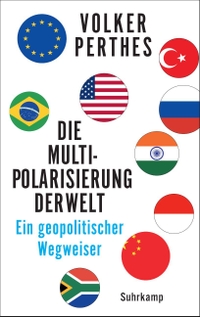Im Kino
Farbbombe mitten ins Gesicht
Die Filmkolumne. Von Lukas Foerster, Thomas Groh
01.11.2017. Die Brüder Josh und Benny Safdie legen mit "Good Time" einen manischen Crime-Noir vor und stellen dabei alle Farb-Regler steil nach oben. Eher in Pastellspektrum verbleibt Stella Meghies Young-Adult-Romanze "Du neben mir", die feinfühlig die Gefühlswelten einer jungen Liebe ausbreitet.n

Bloß nicht in die Irre führen lassen von dem Hochhaus-Panorama des verpanzert wirkenden New Yorks, mit dem dieser Film beginnt: Soviel distanzierte Übersichtlichkeit und klare Strukturiertheit wie in den ersten drei, vier paar Sekunden gönnen einem die Filmemacher Ben und Josh Safdie in den folgenden rund hundert Minuten kaum noch einmal.
Schnitt, Auftritt Nick, gespielt von Regisseur Ben Safdie selbst. Der stellt sich in erster Linie über die prächtigen Mitesser auf seiner Nase vor, so dicht rückt die Kamera ihm auf die fettig-rötliche Pelle. Die Zeichen stehen auf emotionalen Stress: Ein Psychiater wirft ihm Alltagsfloskeln und Begriffe zu, auf die Nick reagieren soll. Was für Nick - schwerhörig, daher sprachlich eingeschränkt und mental nicht in der Lage, seine Impulse und sein Verhältnis zur Außenwelt im Zaum zu halten - mit enormen Schwierigkeiten an der Grenze zur emotionalen Auflösung verbunden ist. Sprich: niemand, mit dem man sich auf einen gemeinsamen Bankraub einlassen sollte. Und doch platzt Nicks Bruder Connie (Robert Pattinson) wenige Sekunden später hektisch zur Tür herein, zerrt den verwirrten Bruder unter aufgebrachten Schandrufen des Psychologen aus dem Raum und schleppt ihn flugs zu einem Bankhaus, wo die Sache steigen soll. Natürlich geht sie schief. Aber sowas von.
Hektik im Anschnitt, Nervosität im Close-Up, fahriges Manövrieren in einer vollgestellten Welt, schlechte Ideen, die zu noch schlechteren Ideen führen: Für Ordnungsfanatiker und Freunde klassisch übersichtlichen Erzählens stellt "Good Time" als Adrenalinreise in die leuchtende Dunkelheit der Neon-Nacht eine gewaltige Herausforderung dar. Der in Cannes zu Recht als beste Filmmusik ausgezeichnete Soundtrack von Daniel Lopatin, der unter seinem Moniker Oneohtrix Point Never sonst eher für hauntologisch-oneironautische Hypnagogik steht, tut mit seiner pulsierend-fahrigen Achtzigerjahre-Kälte das Übrige: In "Good Time" überschlagen sich die Ereignisse, stets kommt eins zum nächsten und übernächsten, Kino im Kokain-Modus. Orientierung stiftende establishing shots sind Mangelware - das Geschehen strukturiert sich weitgehend durch nahe und Close-Up-Einstellungen. Zusätzlich wird das Bild durch störende Elemente im Vordergrund und Lichtreflexe zerfasert.

Die Safdie-Brothers kommen aus dem Independent-Kino, aus dem Mumblecore-Zusammenhang, der vor einigen Jahren die Festivals weltweit hat aufmerken lassen. Mit "Good Time" legen sie nun einen kleinen urbanen, ziemlich manischen Noir mit deutlich auteuristischer Kante vor: Vor allem das Gesicht und wie es sich traktieren lässt, ist für sie von herausragendem Interesse - und Weltstar Robert Pattinson bietet hier eine dankbare Leinwand dar: Der hat von den "Twilight"-Filmen her noch manchen Glitter im Gesicht, den er sich offenbar gründlich abreiben will - seit geraumer Zeit fällt er in Filmen auf, die seinem Star-Image zuwiderlaufen. Hier gibt er alles - er ist strähnig, unrasiert, irrlichtert mit glasigem Blick durch die Welt, versteckt sein Gesicht hinter einer obszön fettigen Latexmaske, färbt sich irgendwann die Haare und bekommt von den Regisseuren eine knallrote Farbbombe mitten ins Gesicht geschleudert - die gestohlene Kohle war präpariert, womit das ganze Unglück seinen Lauf nimmt.
Überhaupt Farbe. Ähnlich wie Paul Schrader, der in seiner späten Tarantino-Variation "Dog Eat Dog" Nicholas Cage durch alle Farben des Neon-Regenbogens als Kommentar zum "Post-Rules-Cinema" der Gegenwart stapfen ließ, stellen auch die Safdie-Brothers alle Regler steil nach oben und tauchen ihre Nachtbilder tief in strahlendes Magenta und sattes Rot, als ginge es darum, den neblig entsättigten Grau- und Chrometönen, die das Gegenwartskino oft vorzieht, die satten Farben der grelleren Kinoentwürfe der siebziger und achtziger Jahre gegenüber zu stellen. Was dem klassischen Film Noir das Chiaroscuro gewesen ist, ist den Safdie-Brothers die kräftige Farbe, mit denen sie ihre Bilder zusehends ins Abstrakte verschieben. Etwa auch während eines vorläufigen Höhepunkts, der sich vollends der Realität enthebt und in den unwägbaren Räumen einer Geisterbahn vonstatten geht.
"Good Time" ist ein schönes Beispiel für obsessiv-getriebenes Filmemachen mit überschaubaren Mitteln - rasant, hungrig, kompromisslos. Kino, das zu unserer heutigen Zeit eigentlich nicht mehr passt, in der Blockbuster wie Verfilmungen von Meinungsumfrage-Ergebnissen wirken, und auch die kleinen Filme zusehends auf Nummer Sicher gehen, weil die Brosamen vom Tisch der Großen ohnehin immer geringer ausfallen, und solche, die, wie zuletzt Ben Wheatleys "Free Fire" oder Rob Zombies "31", verzweifelt auf die Kultfilm-Karte setzen, bloß noch wie müder Karneval wirken. Die Safdie-Brothers spielen demgegenüber auf Risiko, drücken das Gaspedal mächtig durch - und legen einen fulminanten Film vor, für den es kein Widerspruch ist, sich lustvoll an der Kinetik zu berauschen und gleichzeitig ein klares ästhetisches Projekt zu fahren.
Thomas Groh
Good Time - USA 2017 - Regie: Benny Safdie, Josh Safdie - Darsteller: Robert Pattinson, Benny Safdie, Taliah Wester, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi u.a. - Laufzeit: 101 Minuten.
---

"My life is an exercise in restraint." Weil die 18-jährige Maddy (Amandla Stenberg) an einer seltenen Störung des Immunsystems leidet, ist ihr jeder direkter Umweltkontakt unmöglich. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Mutter in einer geschmackvoll, aber Ton in Ton eingerichteten Wohnung, die hermetisch - aber eben, das setzt die Handlung in Gang, nicht blickdicht - gegen die Außenwelt abgeschlossen ist: will man sie betreten oder verlassen, dann muss man eine Schleuse passieren, was mehrmals im Film seltsam arhythmische Handlungsverzögerungen zur Folge hat. Ihre Zeit verbringt Maddy im Internet, mit Büchern und vor allem in ihrer eigenen, psychischen Innenwelt, die reichhaltig auszugestalten der Film sich einige Mühe gibt. Ihre sozialen Kontakte beschränken sich auf eine Pflegerin, deren Tochter und eben ihre Mutter, die mit freundlicher Strenge, aber ohne jeden herzlichen Überschwang über sie wacht. Dass dieses Regime kein durchweg vernünftiges ist, zeigt sich schon daran, dass sie die Garderobe der Tochter normiert und ihr nur schmucklos weiße oder jedenfalls sehr helle Kleidung gestattet.
Handlungslogisch könnte man sich diesen Spleen so zurecht legen, dass die Mutter alles vermeiden will, was in der Tochter auch nur die Sehnsucht nach der bunten, chaotischen Außenwelt erweckt. Aber eigentlich geht es um einen visuellen Kontrast. Denn Olly (Nick Robinson), ein ganz leicht rebellisch ausschauender junger Typ, der mit Eltern und Schwester ins Nachbarhaus einzieht, trägt ausschließlich schwarz. Man kann sich natürlich denken, wie das weitergeht: Durch Olly lernt Maddy einerseits ganz neue Bedeutungsdimensionen von "exercise in restraint" kennen; und andererseits macht sie sich bald daran, die Flexibilität ihres Gefängnisses auszureizen. Das heißt, über kurz oder lang: nichts mehr mit restraint.
Dass man das alles schon mit Maddys erstem Blick auf Olly kommen sieht, und dass die zarte, durch und durch pastellfarbene, alle düsteren und paranoiden Klippen weiträumig umschiffende Young-Adult-Romanze der beiden in erzählerischer Hinsicht tatsächlich weitgehend überraschungsfrei abgespult wird, mag man dem Film vorwerfen. Muss man aber nicht, denn wie in der Liebe ist auch im Film die Form oft wichtiger als der Inhalt (beziehungsweise: als das Liebesobjekt). Und Stella Meghies "Du neben mir" - der deutsche Titel hört sich erst einmal fürchterlich banal an, gefällt mir aber in seiner Verräumlichung fast besser als das originale "Everything, Everything" - ist vor allem deshalb ein schöner Film, weil er die innerdiegetische Liebe von den praktischen Hindernissen her denkt, die sich ihr in den Weg stellen; und erst, wenn diese Hindernisse komplett beseitigt sind, lässt er etwas nach, weil er für die "Befreiung" keine ähnlich schlüssige Form findet und sich mit einer Reihe schaler Naturüberhöhungen, unterlegt mit nicht immer geschmackssicher ausgewählter Popmusik, begnügt. Vor allem schaut die Welt jenseits der Schleuse kaum weniger keimfrei aus als Maddys wattiertes Gefängnis.

Zunächst jedoch sind die einzigen Medien der Liebe, die den beiden zur Verfügung stehen, der Blick und die Schrift. Vom Fenster ihres Schlafzimmers aus kann sie direkt in das seine blicken, und so inszeniert der Film in seinem besten, ersten Teil kleine Theateraufführungen der Intimität: Er kaspert rum und freut sich an ihrem Lächeln, und auch sie macht sich selbst zu einem Spektakel, indem sie auf sein Gestikulieren stets nur mit kaum wahrnehmbaren Mikrobewegungen antwortet, die zum genauen Beobachten auffordern. Wenn dann wenig später die Kommunikation mithilfe von Chat- und SMS-Nachrichten erweitert wird, bricht der Film mit dem Realismus und inszeniert imaginäre Begegnungsräume, die freilich Distanz nicht aufheben, sondern betonen.
Wenn die "echte" Annäherung, auf die der Film natürlich nicht verzichten kann und die sich zunächst in Maddys versiegeltem Reich, sozusagen unter Laborbedingungen vollzieht, in Gang kommt, gibt es einige sorgfältig choreographierte Szenen, in denen sich Maddy und Olly gegenseitig umkreisen. Auf größtmöglichen Abstand haben sie zu achten, wenn sie denn darauf bestehen, einen physischen Raum zu teilen, das ist die Auflage von Maddys Pflegerin, an die die beiden sich selbstverständlich nicht allzu lange halten. Insbesondere diese Passagen, in denen es darum geht, nicht mehr äußere, sichtbare, sondern innere Widerstände zu überwinden, zeigen, dass es dem Film im Kern natürlich weniger um seine (vor allem im ziemlich dominanten Voice Over sowie in einigen teils eher unnötigen technischen Spielereien) fast schon ausgestellt konstruierte Prämisse selbst geht, als darum, durch sie, beziehungsweise durch ihre Übertreibungen, ein anderes, prägnanteres Bild der Mechanismen und Gefühlswelten jeder jugendlichen, beziehungsweise ersten Liebe zu finden.
Die Stärke des Films besteht jedoch genau darin, dass er die Prämisse - in der natürlich auch Märchenmotive mitschwingen, unter anderem Rapunzel - gleichwohl ernst nimmt und ihr eine ganze Reihe schöner Regieideen abgewinnt. Etwa, wenn Meghie eine Fensterscheibe zwischen die Liebenden schiebt und diese dadurch nicht nur voneinander trennt, sondern durch Spiegelreflexe auch miteinander verbindet, fast schon verschmelzen lässt - auf die Idee sind schon zahlreiche andere Filme gekommen, klar, aber in "Du neben mir" hat dieses Bild eine unaufdringliche und gleichzeitig melodramatisch-endgültige Expressivität. Noch schöner ist der erste Kuss der beiden, der, soviel Zuspitzung muss sein, am amerikanischen Nationalfeiertag erfolgt, fast sogar, aber eben doch nicht ganz, vor dem Hintergrund des Feuerwerks: Die explodierenden Leuchtraketen selbst sind nicht zu sehen, nur ihr bunter Abglanz auf den Gesichtern der Küssenden.
Lukas Foerster
Du neben mir - USA 2017 - OT: Everything, Everything - Regie: Stella Meghie - Darsteller: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Ana de la Reguera, Taylor Hickson u.a. - Laufzeit: 96 Minuten.
"Du neben mir" wurde anlässlich des Kinostarts im Juni diesen Jahres kaum beachtet. Diese Woche erscheint der Film auf BluRay und DVD.

Bloß nicht in die Irre führen lassen von dem Hochhaus-Panorama des verpanzert wirkenden New Yorks, mit dem dieser Film beginnt: Soviel distanzierte Übersichtlichkeit und klare Strukturiertheit wie in den ersten drei, vier paar Sekunden gönnen einem die Filmemacher Ben und Josh Safdie in den folgenden rund hundert Minuten kaum noch einmal.
Schnitt, Auftritt Nick, gespielt von Regisseur Ben Safdie selbst. Der stellt sich in erster Linie über die prächtigen Mitesser auf seiner Nase vor, so dicht rückt die Kamera ihm auf die fettig-rötliche Pelle. Die Zeichen stehen auf emotionalen Stress: Ein Psychiater wirft ihm Alltagsfloskeln und Begriffe zu, auf die Nick reagieren soll. Was für Nick - schwerhörig, daher sprachlich eingeschränkt und mental nicht in der Lage, seine Impulse und sein Verhältnis zur Außenwelt im Zaum zu halten - mit enormen Schwierigkeiten an der Grenze zur emotionalen Auflösung verbunden ist. Sprich: niemand, mit dem man sich auf einen gemeinsamen Bankraub einlassen sollte. Und doch platzt Nicks Bruder Connie (Robert Pattinson) wenige Sekunden später hektisch zur Tür herein, zerrt den verwirrten Bruder unter aufgebrachten Schandrufen des Psychologen aus dem Raum und schleppt ihn flugs zu einem Bankhaus, wo die Sache steigen soll. Natürlich geht sie schief. Aber sowas von.
Hektik im Anschnitt, Nervosität im Close-Up, fahriges Manövrieren in einer vollgestellten Welt, schlechte Ideen, die zu noch schlechteren Ideen führen: Für Ordnungsfanatiker und Freunde klassisch übersichtlichen Erzählens stellt "Good Time" als Adrenalinreise in die leuchtende Dunkelheit der Neon-Nacht eine gewaltige Herausforderung dar. Der in Cannes zu Recht als beste Filmmusik ausgezeichnete Soundtrack von Daniel Lopatin, der unter seinem Moniker Oneohtrix Point Never sonst eher für hauntologisch-oneironautische Hypnagogik steht, tut mit seiner pulsierend-fahrigen Achtzigerjahre-Kälte das Übrige: In "Good Time" überschlagen sich die Ereignisse, stets kommt eins zum nächsten und übernächsten, Kino im Kokain-Modus. Orientierung stiftende establishing shots sind Mangelware - das Geschehen strukturiert sich weitgehend durch nahe und Close-Up-Einstellungen. Zusätzlich wird das Bild durch störende Elemente im Vordergrund und Lichtreflexe zerfasert.

Die Safdie-Brothers kommen aus dem Independent-Kino, aus dem Mumblecore-Zusammenhang, der vor einigen Jahren die Festivals weltweit hat aufmerken lassen. Mit "Good Time" legen sie nun einen kleinen urbanen, ziemlich manischen Noir mit deutlich auteuristischer Kante vor: Vor allem das Gesicht und wie es sich traktieren lässt, ist für sie von herausragendem Interesse - und Weltstar Robert Pattinson bietet hier eine dankbare Leinwand dar: Der hat von den "Twilight"-Filmen her noch manchen Glitter im Gesicht, den er sich offenbar gründlich abreiben will - seit geraumer Zeit fällt er in Filmen auf, die seinem Star-Image zuwiderlaufen. Hier gibt er alles - er ist strähnig, unrasiert, irrlichtert mit glasigem Blick durch die Welt, versteckt sein Gesicht hinter einer obszön fettigen Latexmaske, färbt sich irgendwann die Haare und bekommt von den Regisseuren eine knallrote Farbbombe mitten ins Gesicht geschleudert - die gestohlene Kohle war präpariert, womit das ganze Unglück seinen Lauf nimmt.
Überhaupt Farbe. Ähnlich wie Paul Schrader, der in seiner späten Tarantino-Variation "Dog Eat Dog" Nicholas Cage durch alle Farben des Neon-Regenbogens als Kommentar zum "Post-Rules-Cinema" der Gegenwart stapfen ließ, stellen auch die Safdie-Brothers alle Regler steil nach oben und tauchen ihre Nachtbilder tief in strahlendes Magenta und sattes Rot, als ginge es darum, den neblig entsättigten Grau- und Chrometönen, die das Gegenwartskino oft vorzieht, die satten Farben der grelleren Kinoentwürfe der siebziger und achtziger Jahre gegenüber zu stellen. Was dem klassischen Film Noir das Chiaroscuro gewesen ist, ist den Safdie-Brothers die kräftige Farbe, mit denen sie ihre Bilder zusehends ins Abstrakte verschieben. Etwa auch während eines vorläufigen Höhepunkts, der sich vollends der Realität enthebt und in den unwägbaren Räumen einer Geisterbahn vonstatten geht.
"Good Time" ist ein schönes Beispiel für obsessiv-getriebenes Filmemachen mit überschaubaren Mitteln - rasant, hungrig, kompromisslos. Kino, das zu unserer heutigen Zeit eigentlich nicht mehr passt, in der Blockbuster wie Verfilmungen von Meinungsumfrage-Ergebnissen wirken, und auch die kleinen Filme zusehends auf Nummer Sicher gehen, weil die Brosamen vom Tisch der Großen ohnehin immer geringer ausfallen, und solche, die, wie zuletzt Ben Wheatleys "Free Fire" oder Rob Zombies "31", verzweifelt auf die Kultfilm-Karte setzen, bloß noch wie müder Karneval wirken. Die Safdie-Brothers spielen demgegenüber auf Risiko, drücken das Gaspedal mächtig durch - und legen einen fulminanten Film vor, für den es kein Widerspruch ist, sich lustvoll an der Kinetik zu berauschen und gleichzeitig ein klares ästhetisches Projekt zu fahren.
Thomas Groh
Good Time - USA 2017 - Regie: Benny Safdie, Josh Safdie - Darsteller: Robert Pattinson, Benny Safdie, Taliah Wester, Jennifer Jason Leigh, Barkhad Abdi u.a. - Laufzeit: 101 Minuten.
---

"My life is an exercise in restraint." Weil die 18-jährige Maddy (Amandla Stenberg) an einer seltenen Störung des Immunsystems leidet, ist ihr jeder direkter Umweltkontakt unmöglich. Sie lebt gemeinsam mit ihrer Mutter in einer geschmackvoll, aber Ton in Ton eingerichteten Wohnung, die hermetisch - aber eben, das setzt die Handlung in Gang, nicht blickdicht - gegen die Außenwelt abgeschlossen ist: will man sie betreten oder verlassen, dann muss man eine Schleuse passieren, was mehrmals im Film seltsam arhythmische Handlungsverzögerungen zur Folge hat. Ihre Zeit verbringt Maddy im Internet, mit Büchern und vor allem in ihrer eigenen, psychischen Innenwelt, die reichhaltig auszugestalten der Film sich einige Mühe gibt. Ihre sozialen Kontakte beschränken sich auf eine Pflegerin, deren Tochter und eben ihre Mutter, die mit freundlicher Strenge, aber ohne jeden herzlichen Überschwang über sie wacht. Dass dieses Regime kein durchweg vernünftiges ist, zeigt sich schon daran, dass sie die Garderobe der Tochter normiert und ihr nur schmucklos weiße oder jedenfalls sehr helle Kleidung gestattet.
Handlungslogisch könnte man sich diesen Spleen so zurecht legen, dass die Mutter alles vermeiden will, was in der Tochter auch nur die Sehnsucht nach der bunten, chaotischen Außenwelt erweckt. Aber eigentlich geht es um einen visuellen Kontrast. Denn Olly (Nick Robinson), ein ganz leicht rebellisch ausschauender junger Typ, der mit Eltern und Schwester ins Nachbarhaus einzieht, trägt ausschließlich schwarz. Man kann sich natürlich denken, wie das weitergeht: Durch Olly lernt Maddy einerseits ganz neue Bedeutungsdimensionen von "exercise in restraint" kennen; und andererseits macht sie sich bald daran, die Flexibilität ihres Gefängnisses auszureizen. Das heißt, über kurz oder lang: nichts mehr mit restraint.
Dass man das alles schon mit Maddys erstem Blick auf Olly kommen sieht, und dass die zarte, durch und durch pastellfarbene, alle düsteren und paranoiden Klippen weiträumig umschiffende Young-Adult-Romanze der beiden in erzählerischer Hinsicht tatsächlich weitgehend überraschungsfrei abgespult wird, mag man dem Film vorwerfen. Muss man aber nicht, denn wie in der Liebe ist auch im Film die Form oft wichtiger als der Inhalt (beziehungsweise: als das Liebesobjekt). Und Stella Meghies "Du neben mir" - der deutsche Titel hört sich erst einmal fürchterlich banal an, gefällt mir aber in seiner Verräumlichung fast besser als das originale "Everything, Everything" - ist vor allem deshalb ein schöner Film, weil er die innerdiegetische Liebe von den praktischen Hindernissen her denkt, die sich ihr in den Weg stellen; und erst, wenn diese Hindernisse komplett beseitigt sind, lässt er etwas nach, weil er für die "Befreiung" keine ähnlich schlüssige Form findet und sich mit einer Reihe schaler Naturüberhöhungen, unterlegt mit nicht immer geschmackssicher ausgewählter Popmusik, begnügt. Vor allem schaut die Welt jenseits der Schleuse kaum weniger keimfrei aus als Maddys wattiertes Gefängnis.

Zunächst jedoch sind die einzigen Medien der Liebe, die den beiden zur Verfügung stehen, der Blick und die Schrift. Vom Fenster ihres Schlafzimmers aus kann sie direkt in das seine blicken, und so inszeniert der Film in seinem besten, ersten Teil kleine Theateraufführungen der Intimität: Er kaspert rum und freut sich an ihrem Lächeln, und auch sie macht sich selbst zu einem Spektakel, indem sie auf sein Gestikulieren stets nur mit kaum wahrnehmbaren Mikrobewegungen antwortet, die zum genauen Beobachten auffordern. Wenn dann wenig später die Kommunikation mithilfe von Chat- und SMS-Nachrichten erweitert wird, bricht der Film mit dem Realismus und inszeniert imaginäre Begegnungsräume, die freilich Distanz nicht aufheben, sondern betonen.
Wenn die "echte" Annäherung, auf die der Film natürlich nicht verzichten kann und die sich zunächst in Maddys versiegeltem Reich, sozusagen unter Laborbedingungen vollzieht, in Gang kommt, gibt es einige sorgfältig choreographierte Szenen, in denen sich Maddy und Olly gegenseitig umkreisen. Auf größtmöglichen Abstand haben sie zu achten, wenn sie denn darauf bestehen, einen physischen Raum zu teilen, das ist die Auflage von Maddys Pflegerin, an die die beiden sich selbstverständlich nicht allzu lange halten. Insbesondere diese Passagen, in denen es darum geht, nicht mehr äußere, sichtbare, sondern innere Widerstände zu überwinden, zeigen, dass es dem Film im Kern natürlich weniger um seine (vor allem im ziemlich dominanten Voice Over sowie in einigen teils eher unnötigen technischen Spielereien) fast schon ausgestellt konstruierte Prämisse selbst geht, als darum, durch sie, beziehungsweise durch ihre Übertreibungen, ein anderes, prägnanteres Bild der Mechanismen und Gefühlswelten jeder jugendlichen, beziehungsweise ersten Liebe zu finden.
Die Stärke des Films besteht jedoch genau darin, dass er die Prämisse - in der natürlich auch Märchenmotive mitschwingen, unter anderem Rapunzel - gleichwohl ernst nimmt und ihr eine ganze Reihe schöner Regieideen abgewinnt. Etwa, wenn Meghie eine Fensterscheibe zwischen die Liebenden schiebt und diese dadurch nicht nur voneinander trennt, sondern durch Spiegelreflexe auch miteinander verbindet, fast schon verschmelzen lässt - auf die Idee sind schon zahlreiche andere Filme gekommen, klar, aber in "Du neben mir" hat dieses Bild eine unaufdringliche und gleichzeitig melodramatisch-endgültige Expressivität. Noch schöner ist der erste Kuss der beiden, der, soviel Zuspitzung muss sein, am amerikanischen Nationalfeiertag erfolgt, fast sogar, aber eben doch nicht ganz, vor dem Hintergrund des Feuerwerks: Die explodierenden Leuchtraketen selbst sind nicht zu sehen, nur ihr bunter Abglanz auf den Gesichtern der Küssenden.
Lukas Foerster
Du neben mir - USA 2017 - OT: Everything, Everything - Regie: Stella Meghie - Darsteller: Amandla Stenberg, Nick Robinson, Anika Noni Rose, Ana de la Reguera, Taylor Hickson u.a. - Laufzeit: 96 Minuten.
"Du neben mir" wurde anlässlich des Kinostarts im Juni diesen Jahres kaum beachtet. Diese Woche erscheint der Film auf BluRay und DVD.
Kommentieren