Vom Nachttisch geräumt
Die Bücherkolumne. Von Arno Widmann
06.12.2006. "Das Leben ist die Guillotine der Wahrheit." Arno Widmann liest die Aphorismen des kolumbianischen Philosophen Nicolas Gomez Davila, die Erinnerungen der chinesischen Tänzerin Jin Xing, die einmal ein Mann war, Israel Finkelsteins und Neil Silbermans Geschichte des Räuberhauptmanns David, Wolfgang Kemps Foto-Essays, Harry Graf Kesslers Aufzeichnungen über die Revolution 1918 und ein Benjamin-Handbuch. Ein Held unserer Zeit
 Jin Xing wurde 1967 in Shenyang in der Mandschurei geboren. Er wurde - gegen den Willen seiner Eltern - Tänzer. Mit siebzehn Jahren wurde er zum besten Tänzer Chinas gekürt. Er fuhr - gegen den Willen seines Arbeitgebers: der Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China - in die USA und lernte dort modernen Tanz. Er arbeitet als Tänzer und Choreograf in New York, Rom und Brüssel. Er kehrt zurück in die Volksrepublik. 1995 lässt er sich - gegen den Willen seiner Eltern und der meisten seiner Freunde - operieren.
Jin Xing wurde 1967 in Shenyang in der Mandschurei geboren. Er wurde - gegen den Willen seiner Eltern - Tänzer. Mit siebzehn Jahren wurde er zum besten Tänzer Chinas gekürt. Er fuhr - gegen den Willen seines Arbeitgebers: der Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China - in die USA und lernte dort modernen Tanz. Er arbeitet als Tänzer und Choreograf in New York, Rom und Brüssel. Er kehrt zurück in die Volksrepublik. 1995 lässt er sich - gegen den Willen seiner Eltern und der meisten seiner Freunde - operieren.
Seitdem ist er eine Frau. Jin Xing hat ihre Lebensgeschichte von der französischen Autorin Catherine Texier aufschreiben lassen. Unter dem Titel "Shanghai Tango" ist das Buch auf Deutsch erschienen. Wer Gelegenheit hatte, Jin Xing nicht nur auf der Bühne zu sehen, sondern sie auch ihre Lebensgeschichte erzählen zu hören, der wird bedauern, dass sie sich für einen Ghostwriter entschied. Jin Xing ist life hundertmal witziger und intelligenter als in diesem Buch. Sie ist hellwach. Sie denkt und spricht so zügig, so entschlossen, so stark wie die chinesischen Weltmeister Tischtennis spielen. Sie weicht Wortwechseln nicht aus. Sie machen ihr Spaß und sie freut sich, wenn sie losschmettern kann. Das Buch dagegen versackt immer wieder im Bedeutungsschwangeren. Von ihrer Entschlusskraft, ihrer Willensstärke und ihrer unglaublichen Durchsetzungsfähigkeit auch gegen die eigenen Wünsche, erfährt man zwar, aber von diesen Qualitäten ist wenig zu spüren.
Aber es gibt sehr ergreifende Stellen darin, Liebesgeschichten und Augenblicke der Verzweiflung und kalte, darum aber nicht weniger überzeugende Einsichten. Vor allem aber wird man die Heldin für ihren Mut bewundern. Gegen wie viel Widerstand hat sie sich immer wieder durchgesetzt! Wie stark muss jemand sein, um einen solchen Weg gehen zu können! Wie klug muss er aber auch sein, um das zu tun! Woher nimmt ein Junge, der in der Disziplin der chinesischen Volksbefreiungsarmee steckt, die Kraft, so anders zu sein als alle anderen um ihn herum? Wie ist das, wenn man ein Mann ist und Männer mag und doch ganz sicher weiß, dass man nicht schwul, sondern eigentlich eine Frau ist? Wer eine Ahnung davon hat, wie viel Kraft dazu gehört, eine eigene Meinung zu haben, nicht angewiesen zu sein auf das, was die anderen von einem halten, der wird voller Bewunderung für jemanden sein, der nicht nur seine Meinung, sondern selbst seinen Körper, sein Geschlecht, seine Empfindungen, seine Liebe nicht einfach aus dem Spiegel der Anderen entgegennehmen kann, sondern selbst entdecken, ja selbst schaffen muss.
Wollte man heute, 166 Jahre nach Thomas Carlyle Vorlesungen über "Helden und Heldenverehrung" halten, ein Kapitel müsste Jin Xing gewidmet sein. Wie bei allen Heldengeschichten kommt auch bei dieser im Kopf eines ganz unheldischen Otto Normalverbrauchers während der Lektüre der Gedanke auf, dass vielleicht nicht alles stimmt. Ist die Heldin jetzt tatsächlich glücklich mit ihren Kindern, ihrem Hund und mit Hans-Gerd, ihrem deutschen Freund? Oder ist der eine Zutat, die je nach Landesgeschmack gewechselt wird? Aber so ist es mit den wirklich legendären Figuren. Sie werden unscharf, die Erzähler bemächtigen sich ihrer.
Jin Xing: "Shanghai Tango". Mein Leben als Soldat und Tänzerin. Aufgezeichnet von Catherine Texier. Aus dem Französischen von Anne Spielmann. Blanvalet Verlag, München 2006. 223 Seiten, 21 s/w und farbige Fotos, 19,95 Euro. ISBN: 3764502169. ()
Lesen lernen
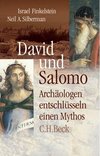 Der israelische Archäologe Israel Finkelstein und sein in Belgien lehrender Kollege Neil A. Silberman haben in ihrem eindrucksvollen Buch "Keine Posaunen vor Jericho" die Geschichte Israels von der biblischen Geschichte befreit und auf den Grund der archäologisch dokumentierten Tatsachen gestellt. Ihr neues Buch "David und Salomo - Archäologen entschlüsseln einen Mythos" ist eine Vertiefung jener wegbereitenden Arbeit. David und Salomo mag es gegeben haben - einige archäologische Funde, zum Beispiel die Stele von Tell Dan aus dem 9. vorchristlichen Jahrhundert, in deren Inschrift vom "Hause Davids" die Rede ist, legen das nahe - aber sie waren keine Könige, es gab keine Paläste. Sie waren die Anführer von Hirtenstämmen. Die Geschichte von König David, das macht die Lektüre dieses Buches so aufregend, ist in ihrem Kern die Geschichte des Anführers einer Räuberbande.
Der israelische Archäologe Israel Finkelstein und sein in Belgien lehrender Kollege Neil A. Silberman haben in ihrem eindrucksvollen Buch "Keine Posaunen vor Jericho" die Geschichte Israels von der biblischen Geschichte befreit und auf den Grund der archäologisch dokumentierten Tatsachen gestellt. Ihr neues Buch "David und Salomo - Archäologen entschlüsseln einen Mythos" ist eine Vertiefung jener wegbereitenden Arbeit. David und Salomo mag es gegeben haben - einige archäologische Funde, zum Beispiel die Stele von Tell Dan aus dem 9. vorchristlichen Jahrhundert, in deren Inschrift vom "Hause Davids" die Rede ist, legen das nahe - aber sie waren keine Könige, es gab keine Paläste. Sie waren die Anführer von Hirtenstämmen. Die Geschichte von König David, das macht die Lektüre dieses Buches so aufregend, ist in ihrem Kern die Geschichte des Anführers einer Räuberbande.
Die Autoren schreiben: "Davids Guerillatruppe ist schnell und mobil. Davids Methoden sind Erpressung, Entführung, Täuschung und körperliche Gewalt." Man kann diese Zeilen nicht lesen, ohne daran zu denken, wie viele in Israel heute die Führung der Palästinenser exakt so charakterisieren. Hier liegt, ganz abgesehen von der Frage nach der historischen Wahrheit, der Sprengstoff von Finkelsteins und Silbermans Entmythologisierung. Die beiden Archäologen haben nicht nur die israelische Erde aufgedeckt, sondern auch den biblischen Text. Man muss sich nur die Situation klarmachen, die im ersten Buch Samuel Davids Truppe beschrieben wird: "Es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster; und es waren bei ihm etwa vierhundert Mann". Dann wird man nicht nur die Aktualität erkennen, die in den alten Geschichten steckt, sondern auch entdecken, aus wessen Perspektive sie aufgeschrieben wurden, wen sie feiern und wen sie verachten.
Finkelstein und Silberman machen klar, dass Jerusalem im 10. Jahrhundert ein kleines Bergdorf war und nicht etwa die Hauptstadt eines Königreichs. David war kein gewaltiger Eroberer. Er hat auf einem sehr übersichtlichen Terrain hier und da ein Scharmützel riskiert, um seinen Männern Wein, Brot und Frauen zu verschaffen. Erst einhundert Jahre nach David entstand ein israelisches Königreich, dessen Hauptstadt allerdings nicht Jerusalem, sondern Samaria war, und regiert wurde es nicht vom Stamme David, sondern von den Omriden.
Finkelstein und Silberman schildern, wessen Interessen die biblischen Texte im Laufe einiger Jahrhunderte formten. Sie zeigen, einer langen hermeneutischen Tradition folgend und widersprechend, wie Schicht sich auf Schicht lagert, wie immer wieder neue Generationen, neue politische Konstellationen eine neue politische Theologie, neue Heilige Texte aus immer wieder demselben Material kreieren. "David und Salomo" ist also nicht nur eine Einführung in das, was früher einmal "biblische Archäologie" genannt wurde. Das Buch öffnet einem auch die Augen dafür, wie offen selbst die geschlossensten Texte sind. Mehr noch als vorderorientalische Archäologie lehrt es uns lesen.
Israel Finkelstein, Neil A. Silberman: "David und Salomo". Archäologen entschlüsseln einen Mythos. Aus dem Englischen von Rita Seuß. C.H. Beck Verlag, München 2006. 298 Seiten, Abbildungen, 24,90 Euro. ISBN: 3406546765.
Die Not des Rezipienten
 Wolfgang Kemps dreibändige Anthologie von Texten zur "Theorie der Fotografie" ist seit einem Vierteljahrhundert das Standardwerk zum Thema. Im Jahr 2000 ergänzte Hubertus von Amelunxen das Kempsche Werk mit einem vierten Band, der die seit 1980 neu hinzugekommenen Reflexionen vorstellte. Zum sechzigstem Geburtstag des in Hamburg lehrenden Kunsthistorikers Wolfgang Kemp hat der Schirmer-Mosel Verlag die vier Bücher in einem einzigen, knapp 1.300 Seiten umfassenden Band zusammengebunden.
Wolfgang Kemps dreibändige Anthologie von Texten zur "Theorie der Fotografie" ist seit einem Vierteljahrhundert das Standardwerk zum Thema. Im Jahr 2000 ergänzte Hubertus von Amelunxen das Kempsche Werk mit einem vierten Band, der die seit 1980 neu hinzugekommenen Reflexionen vorstellte. Zum sechzigstem Geburtstag des in Hamburg lehrenden Kunsthistorikers Wolfgang Kemp hat der Schirmer-Mosel Verlag die vier Bücher in einem einzigen, knapp 1.300 Seiten umfassenden Band zusammengebunden.
Es ist eine Reise durch die Überlegungen zur Fotografie von 1839 bis 1995. Der erste Text stammt von Jules Janin, einem Pariser Kunstkritiker, der über das neue Verfahren der Daguerreotypie schrieb, schon bevor es Mitte 1839 veröffentlicht wurde. Er ist begeistert: "Wenn diese Platte dem hellen Tageslicht ausgesetzt wird, dann bildet sich sofort auf ihr jeder Schatten ab, der sie erreicht, die Erde oder der Himmel, das fließende Wasser, die Kathedrale, die sich in den Wolken verliert, der Stein, das Pflaster, das unsichtbare Sandkorn, das auf der Oberfläche liegt, alle diese Dinge, groß oder klein, die vor der Sonne gleich sind, sie bilden sich in dieser Camera obscura ab, die alle Eindrücke auffängt. Niemals hat die Zeichenkunst der großen Meister eine solche Zeichnung hervorgebracht. Wenn die Verteilung der Massen bewunderungswürdig erscheint, so sind die Details unzählbar. Es ist die Sonne selbst, als allmächtiges Werkzeug einer neuen Kunst, die diese unglaubliche Arbeit vollbringt."
Der jüngste Text stammt von Martha Rosler und beschäftigt sich mit Bildsimulationen und Computermanipulationen. Mit der Arbeit also, die der Mensch sich macht, nachdem die Sonne die ihre getan hat. Die vier Bände wird kaum jemand auf einen Satz lesen, aber es macht großen Spaß darin zu blättern. Natürlich bleibt man hängen bei den Großmeistern der Fototheorie, bei Baudelaire, Stieglitz, Hine, Strand, Teige, Rodtschenko, dessen Plädoyer für den Schnappschuss (mehr) - aus dem Jahre 1928 - daran erinnert, wie alt unsere gegenwärtigen Auseinandersetzungen sind -, Kracauer, Hausmann, Benjamin - der sich in dieser Sammlung viel weniger originell ausmacht als in den seine Texte analysierenden philosophischen Seminaren -, Sternberger, Man Ray, Adams, Bazin, Cartier-Bresson, Barthes, Bourdieu, Sontag - wie wenig Frauen in dieser Sammlung sind! - bis zu Flusser, Schmid, Gerz, Crimp, Baudrillard, Derrida, Virilio, Metz.
Man blättert durch diese Bände und erstmals wird einem klar, was fehlt. Eine Kollektion der Aufsätze aus Indien, China, Afrika, aus Ägypten, Iran, Afghanistan, Indonesien. Die vier Bände sind ein Dokument der fotoästhetischen Reflexion vor der Globalisierung. Fände Lothar Schirmer doch einen zweiten Wolfgang Kemp, der ihm auf noch einmal 1.000 Seiten zusammentrüge, was Hiroshige, Lu Xun, Mahfus vielleicht über Fotografie geschrieben haben. Es wäre ein Buch, das mit der Verblüffung über die Fotografie begänne, und das mit der Virtuosität, mit der heute in Japan, China, Indien nicht nur fotografiert, sondern auch über Fotografie nachgedacht wird, verblüffte. Aber einen zweiten Wolfgang Kemp wird Lothar Schirmer nicht finden. So wird uns die nächsten Jahre nur diese Anthologie bleiben.
 Es sind wunderbare Texte, man möchte viele Sonntagnachmittage darin verbringen. Zum Beispiel Wolfgang Kemps Einleitung in den dritten Band, der Texte aus den Jahren 1945 bis 1980 bringt. Er beginnt mit der Erinnerung daran, dass während der antikommunistischen Hexenjagd in den USA auch die Photo League neben der kommunistischen Partei und dem Ku Klux Klan als subversive Organisation geführt wurde und endet mit der den 68er verratenden Bemerkung des Autors: "Die gesellschaftlich produzierte Entsinnlichung aller Lebensbereiche bedingt den Bildhunger, der vom gleichen System dann (sicher unzureichend) gespeist wird. Der beklagte Konsum ist primär weder als Selbstlauf, noch als Inszenierung zu begreifen, er hat seine Ursache in der Not der Rezipienten, die keine Bewahrpädagogik und keine Aufklärungsarbeit in Sachen Manipulation aufheben wird."
Es sind wunderbare Texte, man möchte viele Sonntagnachmittage darin verbringen. Zum Beispiel Wolfgang Kemps Einleitung in den dritten Band, der Texte aus den Jahren 1945 bis 1980 bringt. Er beginnt mit der Erinnerung daran, dass während der antikommunistischen Hexenjagd in den USA auch die Photo League neben der kommunistischen Partei und dem Ku Klux Klan als subversive Organisation geführt wurde und endet mit der den 68er verratenden Bemerkung des Autors: "Die gesellschaftlich produzierte Entsinnlichung aller Lebensbereiche bedingt den Bildhunger, der vom gleichen System dann (sicher unzureichend) gespeist wird. Der beklagte Konsum ist primär weder als Selbstlauf, noch als Inszenierung zu begreifen, er hat seine Ursache in der Not der Rezipienten, die keine Bewahrpädagogik und keine Aufklärungsarbeit in Sachen Manipulation aufheben wird."
Manche der Texte zeigen Patina. Aber wie auch in der Bildenden Kunst kommt es vor, dass die Patina den Reiz eines Textes erhöht. Da man von ihm nicht mehr erwartet, dass er die Wahrheit über einen Sachverhalt sagt, wird der Blick frei dafür zu erkennen, wie viel Wahrheit er über die Zeit sagt, in der und in die hinein er geschrieben wurde.
"Theorie der Fotografie". Band I-IV, 1839-1995, komplett in einem Band. Herausgegeben von Wolfgang Kemp und Hubertus von Amelunxen. Schirmer/Mosel, München 2006. 1292 Seiten, mit einigen wenigen s/w Abbildungen, 58 Euro. ISBN: 3829602391. ()
Wolfgang Kemp: "Foto-Essays zur Geschichte und Theorie der Fotografie". Erweiterte Ausgabe. Schirmer/Mosel, München 2006. 175 Seiten, 54 s/w Abbildungen, 19,80 Euro. ISBN: 3829602405.
Immer protestiert er
 Martin Mosebach hat ein Vorwort geschrieben, das neugierig macht auf den kolumbianischen Denker Nicolas Gomez Davila (1913-1994), diese ganz und gar unangepasste Existenz, die wie ein Ableger des frühen 19. ins späte 20. Jahrhundert wirkte. Seine "Notas" (Anmerkungen) sind jetzt im Verlag Matthes & Seitz in der Übersetzung von Ulrich Kunzmann erschienen. Alle drei sind nicht genug zu loben für ihre Arbeit. Es wird lange dauern bis Gomez Davilas Rang in Deutschland erkannt werden wird. Nicht weil er so schwierig zu erkennen wäre, sondern weil man ihn langsam lesen muss.
Martin Mosebach hat ein Vorwort geschrieben, das neugierig macht auf den kolumbianischen Denker Nicolas Gomez Davila (1913-1994), diese ganz und gar unangepasste Existenz, die wie ein Ableger des frühen 19. ins späte 20. Jahrhundert wirkte. Seine "Notas" (Anmerkungen) sind jetzt im Verlag Matthes & Seitz in der Übersetzung von Ulrich Kunzmann erschienen. Alle drei sind nicht genug zu loben für ihre Arbeit. Es wird lange dauern bis Gomez Davilas Rang in Deutschland erkannt werden wird. Nicht weil er so schwierig zu erkennen wäre, sondern weil man ihn langsam lesen muss.
Die "Notas" sind kein Buch, das man liest. Entweder man blättert es durch auf der Suche nach etwas, das einen anfällt, wie der auf dem Klappentext zitierte Satz "Das Leben ist die Guillotine der Wahrheit", oder aber man benützt die Notas wie ein frommer Mann das Brevier. Man liest einen Abschnitt, überdenkt ihn, liest ihn noch einmal, denkt gegen ihn, liest ihn wieder und das immer von neuem. "Die Meditation ist unsere Besitznahme der Welt", schreibt Gomez Davila. Auf diese Weise ist man mit den 400 Seiten umfassenden "Notas" ein Leben lang beschäftigt. Wer Gomez Davila liest, hat sich aus der Gegenwart verabschiedet. Er taucht ein nicht in eine sei es noch so entfernte Vergangenheit, sondern in die Zeitlosigkeit selbst.
Jedenfalls geht es dem Autor mehr noch als um die Inhalte seiner Sätze um dieses Gefühl radikaler Entrückung. Er vermittelt es aber nicht nur. Er braucht es auch. Der aristokratische Gestus, mit dem Gomez Davila jede Verwicklung in das wirkliche Leben mit seinen Täuschungen und Enttäuschungen ablehnt, speist sich aus der Angst, vom Leben verschlungen zu werden. Das gibt den Texten etwas von der Komik jener blasierten 17-jährigen jungen Männer, die behaupten, das Leben zu kennen und darum nur Verachtung für es zu empfinden. So dumm das damals war, so sehr weiß man doch, dass man nie wieder so intelligent war wie in jenen Jahren.
Gomez Davila ist aus dieser Haltung gegenüber der Welt und dem Leben nie wieder hinausgekommen. Er hatte es sich darin sehr gemütlich gemacht. Darum sind diese "Anmerkungen" immer unangepasst und mal einfach nur dummes Zeug und dann wieder geniale Lichtblicke. Gomez Davila wusste das sehr genau. So findet sich zwischen den Sätzen: "Eine Partikel gesunden Menschenverstandes wirkt bei einer Frau wie Genie" und "Die Vernunft einer Frau ist das Arsenal ihrer Leidenschaften" die doch durchaus auch selbstkritisch zu verstehende Einsicht "Jeder Gedanke über Frauen ist eine in Grobheit verpackte Trivialität".
Freilich sollte man den selbstkritischen Anteil hier nicht überschätzen. Der Satz selbst ist doch vor allem eine weitere Grobheit. Er will ja nicht den Verfassern solcher Sätze am Zeug flicken, sondern er behauptet, es läge an der Natur der Sache, an den Frauen, wenn über sie nichts als in Grobheiten verpackte Trivialitäten zu sagen ist. Man wird das zu Recht eine Dummheit nennen. Aber es ist dumm, weil Gomez Davila so tut, als könnte man zum Beispiel über die Männer etwas anderes sagen als in Grobheiten verpackte Trivialitäten. Dass das aber gewissermaßen konstitutiv zum Genre des Aphorismus gehört, dass es also nicht am beschriebenen Objekt und vielleicht nicht einmal am schreibenden Subjekt, sondern wesentlich an der literarischen Form, auf die er so Großes hält, liegen könnte, vor diesem Gedanken fliehen die "Notas". Wer freilich auf der Flucht ist vor dem Anspruch, jeder Gedanke habe sich vor seiner Äußerung auf allgemeine Verträglichkeit hin abchecken zu lassen, der wird voller Freude immer wieder nach Gomez Davilas "Notas" greifen: "Der Verstand äußert sich nicht mit einer einladenden und liebevollen Geste. Der Verstand ist heimtückisch und verräterisch, argwöhnisch und misstrauisch, immer stößt er zunächst zurück und widerlegt, immer lehnt er ab, und immer protestiert er."
Nicolas Gomez Davila: "Notas". Unzeitgemäße Gedanken. Mit einem Essay von Martin Mosebach und einem Nachwort von Franco Volpi. Aus dem Spanischen von Ulrich Kunzmann. Matthes & Seitz, Berlin 2005. 444 Seiten, 34,90 Euro. ISBN: 388221855X. ()
Das eben ist der Weltkrieg
 Harry Graf Kessler (1868-1937) war eine der interessantesten Figuren des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Er ist einer der gar nicht so seltenen Spezies des Autors ohne Werk. Ein Mann, der zu viel zu tun hatte, nein, der zu viel tat, um Bücher schreiben zu können, der allerdings auch nicht wirklich etwas tat, sondern wohl eher so sehr damit beschäftigt war, angeregt und anregend zu leben, dass er zum Tun und zum Schreiben nicht kam. Mit dem Schreiben stimmt es nicht so ganz. Kessler hat Tagebuch geschrieben. Von 1880 bis 1937 und jeder der fast 1000seitigen Bände ist es wert aufmerksamst gelesen zu werden. Nur, wer schafft das? Schon 900 Seiten für sich sind ein fettes Programm, aber wenn es nun gar solche Seiten sind!
Harry Graf Kessler (1868-1937) war eine der interessantesten Figuren des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Er ist einer der gar nicht so seltenen Spezies des Autors ohne Werk. Ein Mann, der zu viel zu tun hatte, nein, der zu viel tat, um Bücher schreiben zu können, der allerdings auch nicht wirklich etwas tat, sondern wohl eher so sehr damit beschäftigt war, angeregt und anregend zu leben, dass er zum Tun und zum Schreiben nicht kam. Mit dem Schreiben stimmt es nicht so ganz. Kessler hat Tagebuch geschrieben. Von 1880 bis 1937 und jeder der fast 1000seitigen Bände ist es wert aufmerksamst gelesen zu werden. Nur, wer schafft das? Schon 900 Seiten für sich sind ein fettes Programm, aber wenn es nun gar solche Seiten sind!
Nehmen wir Sonntag, den 18. November 1917. Fast zweieinhalb eng gedruckte Seiten. Auf denen ist die Rede von Rodin, Grosz, der Elsass-Lothringischen Frage, der neuen Berliner Kunst und der drohenden Revolution. In der Zeitung wird von Rodins Tod berichtet. Kessler: "Er war einer meiner verehrtesten und ältesten Freunde, ich habe ihn noch acht Tage vor dem Kriege aus London nach Paris zurückgebracht. Beim Herausfahren aus Dover lagen wir über die Reling gelehnt, ich fragte ihn, ob er nicht hungrig sei? Er antwortete: 'Non, devant la nature je n'ai pas faim; la nature me nourrit.'"
Nach der Zeitungslektüre bekommt Kessler Besuch von George Grosz und John Heartfield. Sie wollen einen Film machen und er hat sich dafür "10.000 Mark vom Auswärtigen Amt bewilligen lassen." Ich weiß nicht, ob aus diesem Projekt etwas geworden ist, ob es die 10.000 Mark noch rechtzeitig vor der Revolution gab. Obwohl: Kessler stieg nach der Revolution noch ein wenig auf im Auswärtigen Amt. Bei Elsass-Lothringen geht es um die Bewilligung der Einrichtung eines elsässischen Büros in Basel. Ich weiß zu wenig über die genaue Chronologie der Auseinandersetzungen, um ermessen zu können, wie wichtig die Sitzung an jenem Sonntagmittag beim Staatssekretär - er war es übrigens auf ausdrücklichen Wunsch Kaiser Wilhelm II. geworden - Richard von Kühlmann war. Den Erläuterungen entnehme ich jedenfalls, dass der drei Wochen zuvor jede Art von Zugeständnis an Frankreich in dieser Frage abgelehnt hatte.
Nachmittags dann bei Grosz im Atelier. Ein Abschnitt, den man in Gänze zitieren müsste, ein Hymnus auf Berlin: "Überhaupt diese neuberlinische Kunst, Grosz, Becher, Benn, Wieland Herzfelde, höchst merkwürdig; Großstadtkunst, von hochgespannter Dichtigkeit der Eindrücke, die bis zur Simultaneität steigt; brutal realistisch und gleichgültig märchenhaft wie die Großstadt selbst, die Dinge wie von Scheinwerfern roh beleuchtet und entstellt und dann in einem Glanz verschwindend. Eine höchst nervöse, cerebrale, illusionistische Kunst, dadurch innerlichst mit dem Varit verwandt. Auch mit dem Kino, wenigstens mit einem möglichen, noch unentdeckten Kino. Blitzlichtkunst mit einem Parfüm von Laster und Perversität wie jede nächtliche Großstadtstraße. Ringsherum tobt der Weltkrieg; im Zentrum diese nervöse Stadt, in der sich so viel drängt und stößt, so viel Menschen und Straßen und Lichter und Farben und Interessen: Politik und Variete, Geschäft und noch immer Kunst, Feldgraue, Geheimräte, Chansonetten, und rechts und links, oben und unten irgendwo, sehr weit weg, die Schützengräben, stürmende Regimenter, Sterbende, U-Boote, Zeppeline, Flugzeuggeschwader, Kolonnen auf Schlammstraßen....."
Kessler steigert sich und besingt die Friedrichstraße, "die unbezwingbare", die nicht von Kosaken, Gurkhas oder Cowboys eingenommene. Aber dann kommt es: "Wenn hier eine Revolution hereinbräche, eine gewaltsame Umwälzung in dieses Chaos, Barrikaden auf der Friedrichstraße, oder der Einsturz der fernen Brustwehren, welch ein Funkenstieben, wie krachte dann der mächtige, unentwirrbar komplizierte Organismus, wie ähnlich dem Weltgericht. Und doch gerade das haben wir in Lüttich, Brüssel, Warschau, Bukarest erlebt, angerichtet, fast sogar in Paris. Das eben ist der Weltkrieg."
Man wird lange suchen können bis man eine vergleichbar hellsichtige Beobachtung - man beachte das "angerichtet" - findet. Nein, man muss nur weiter lesen bei Kessler, da gibt es alle zwanzig, dreißig Seiten Passagen wie diese, da die Nebel weg geschoben werden und man mit einem Mal ganz klar alles zu erkennen glaubt. Man muss Kessler hellwach lesen. Einzelne Abschnitte zwei, drei Mal und es werden einem immer wieder neue Nuancen aufgehen. Kessler beobachtet und macht sich seine Gedanken. Er macht sie sich, weil es ihm Spaß macht, ihnen zu folgen, sich von ihnen auf neue Wege locken zu lassen. Mehr noch aber interessiert ihn, was er sieht. Es ist die "Dichtigkeit der Eindrücke", die seine Tagebücher zu einer so anregenden, aber auch so anstrengenden Lektüre machen. Es gibt Ruhepausen darin.
Wer sich freilich für nichts interessiert, ist natürlich auch hier fein raus. Es gibt in Deutschland keinen mit Kessler vergleichbaren Autor, keinen der so viel und so viel Unterschiedliches wahrgenommen, beschrieben und kommentiert hat. Kessler war ein Wanderer zwischen Hof und Avantgarde, nein, nein, er war kein Wanderer. Er war auch kein Flaneur. Er war unterwegs. Er ging nicht gelangweilt spazieren in der Welt. Er wollte immer etwas. Selten haben, meistens erfahren. Seine Neugierde, sein Hunger nach Stoff, der die kleinen grauen Zellen in Bewegung hielt, war unermesslich. Ein Hochbegabter in den nicht sehr begehrten Fächern Zuschauen, Zuhören.
Sonntag, 17. November 1918, ein Jahr und 450 Seiten später: "Erster Sonntag nach der Revolution. Am späten Nachmittage bewegten sich große Massen von Spaziergängern über die Linden und bis zum Marstall, um die Spuren der Gefechte an den Gebäuden zu sehen. Alles sehr friedlich in spießbürgerlicher Neugier; namentlich die sehr auffallenden Einschläge am Marstall wurden begafft. Das Einzige gegen frühere Sonntage im Straßenbilde Veränderte ist das Fehlen der Schutzleute und die nicht sehr zahlreichen bewaffneten Matrosen, Wachen und Patrouillen." So sah das reale Weltgericht aus. Mit der expressionistischen Fantasie konnte die Berliner Revolution nicht mithalten. Sie war von rührender Unschuld. Jedenfalls an diesem Sonntagvormittag. Kessler hat sie ebenso klar festgehalten wie die Ekstase ihrer Vorahnung.
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch". Sechster Band, 1916-1918. Herausgegeben von Günter Riederer unter Mitarbeit von Christoph Hilse. Cotta Verlag, Stuttgart 2006. 962 Seiten, 58 Euro. (Subskriptionspreis: 49 Euro) ISBN: 3768198162.
Benjaminsche Unschärferelation
 Walter Benjamin, so erklärt uns Burkhardt Lindner im ersten Satz der Vorbemerkung zu dem von ihm herausgegebenen Benjamin-Handbuch, sei "von allen deutschen Intellektuellen der Weimarer Republik und ihres vom Hitlerreich aufgezwungenen Exils der philosophisch Gewichtigste und der wirkungsgeschichtlich Lebendigste". Wer sich von so viel superlativ-seligem PR-Trompetenklang abgestoßen fühlt und darum das Buch beiseite legt, zeigt zwar gute Reflexe, begeht aber dennoch einen Fehler. Benjamin gehört schließlich ganz sicher zu den schwierigeren Autoren, zu denen also, bei deren Lektüre der Leser immer wieder versucht ist, nachzuschlagen, um sich klar zu werden, worauf eine Anspielung zielt, welche Fenster zu welchen Himmeln oder Höllen ein sperriger, sich in die Argumentation kaum einfügender Begriff aufstößt. Benjamin ist also ein Autor, bei dessen Lektüre Einführungen nützlich sein können.
Walter Benjamin, so erklärt uns Burkhardt Lindner im ersten Satz der Vorbemerkung zu dem von ihm herausgegebenen Benjamin-Handbuch, sei "von allen deutschen Intellektuellen der Weimarer Republik und ihres vom Hitlerreich aufgezwungenen Exils der philosophisch Gewichtigste und der wirkungsgeschichtlich Lebendigste". Wer sich von so viel superlativ-seligem PR-Trompetenklang abgestoßen fühlt und darum das Buch beiseite legt, zeigt zwar gute Reflexe, begeht aber dennoch einen Fehler. Benjamin gehört schließlich ganz sicher zu den schwierigeren Autoren, zu denen also, bei deren Lektüre der Leser immer wieder versucht ist, nachzuschlagen, um sich klar zu werden, worauf eine Anspielung zielt, welche Fenster zu welchen Himmeln oder Höllen ein sperriger, sich in die Argumentation kaum einfügender Begriff aufstößt. Benjamin ist also ein Autor, bei dessen Lektüre Einführungen nützlich sein können.
Die Beiträge im Handbuch sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Das versteht sich bei - wenn ich richtig gezählt habe - 48 Autoren von selbst. Man mag zum Beispiel Axel Honneths Ausführungen zur "Kritik der Gewalt" noch so sehr schätzen, aber dass auf den 33 Spalten an keiner Stelle der Zusammenhang der ursprünglichen Veröffentlichung vorgestellt wird, ist für einen "Handbuch"-Beitrag unentschuldbar. Man vergleiche, wie Uwe Steiner dem Leser Benjamins in etwa gleichzeitig entstandenen Text "Kapitalismus und Religion" erschließt. Klar gegliedert führt Steiner von "Entstehung und Überlieferung" über "Werkkontext", "Forschung" und "Inhaltliche Hauptlinien und Einflüsse" bis zu "Die Grenzen des Kapitalismus".
Man tut gut daran, Steiners Erläuterungen, die sich natürlich auch mit der Bedeutung Sorels und der "Kritik der Gewalt" beschäftigen, auch als Koreferat zu Honneths Beitrag zu lesen. Der Leser, der nur schnell nachblättern möchte, der gar, der glaubt, die Artikel dieses Handbuchs würden ihm die Benjamin-Lektüre ersparen, wird enttäuscht sein. Das Handbuch ist zwar auch ein Führer durch das Labyrinth der Benjaminschen Gedankenwelt, mehr noch aber zieht es einen hinein. Nur Dumme und vor allem die, die es bleiben wollen, werden darin ein Argument gegen das Handbuch sehen. Natürlich widersprechen die Artikel auch einander. Das lässt sich bei einem knappen halben Hundert Mitarbeiter nicht vermeiden. Es ist aber auch kein Schaden. Der Leser erkennt so bald das Benjaminsche Oszillieren zwischen Politik, Religion und Kunst - ein heute wieder tödlich aktuelles Thema - als Versuch etwas gleichzeitig festzuhalten, das gleichzeitig so wenig messbar ist wie der Impuls und der Ort eines Teilchens. Die Benjaminsche Unschärfe ist das Ergebnis seiner Bemühung um Präzision.
"Benjamin Handbuch". Leben - Werk - Wirkung. Herausgegeben von Burckhardt Lindner. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2006. 720 zweispaltige Seiten, 64,95 Euro. ISBN: 3476019853.
 Jin Xing wurde 1967 in Shenyang in der Mandschurei geboren. Er wurde - gegen den Willen seiner Eltern - Tänzer. Mit siebzehn Jahren wurde er zum besten Tänzer Chinas gekürt. Er fuhr - gegen den Willen seines Arbeitgebers: der Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China - in die USA und lernte dort modernen Tanz. Er arbeitet als Tänzer und Choreograf in New York, Rom und Brüssel. Er kehrt zurück in die Volksrepublik. 1995 lässt er sich - gegen den Willen seiner Eltern und der meisten seiner Freunde - operieren.
Jin Xing wurde 1967 in Shenyang in der Mandschurei geboren. Er wurde - gegen den Willen seiner Eltern - Tänzer. Mit siebzehn Jahren wurde er zum besten Tänzer Chinas gekürt. Er fuhr - gegen den Willen seines Arbeitgebers: der Volksbefreiungsarmee der Volksrepublik China - in die USA und lernte dort modernen Tanz. Er arbeitet als Tänzer und Choreograf in New York, Rom und Brüssel. Er kehrt zurück in die Volksrepublik. 1995 lässt er sich - gegen den Willen seiner Eltern und der meisten seiner Freunde - operieren. Seitdem ist er eine Frau. Jin Xing hat ihre Lebensgeschichte von der französischen Autorin Catherine Texier aufschreiben lassen. Unter dem Titel "Shanghai Tango" ist das Buch auf Deutsch erschienen. Wer Gelegenheit hatte, Jin Xing nicht nur auf der Bühne zu sehen, sondern sie auch ihre Lebensgeschichte erzählen zu hören, der wird bedauern, dass sie sich für einen Ghostwriter entschied. Jin Xing ist life hundertmal witziger und intelligenter als in diesem Buch. Sie ist hellwach. Sie denkt und spricht so zügig, so entschlossen, so stark wie die chinesischen Weltmeister Tischtennis spielen. Sie weicht Wortwechseln nicht aus. Sie machen ihr Spaß und sie freut sich, wenn sie losschmettern kann. Das Buch dagegen versackt immer wieder im Bedeutungsschwangeren. Von ihrer Entschlusskraft, ihrer Willensstärke und ihrer unglaublichen Durchsetzungsfähigkeit auch gegen die eigenen Wünsche, erfährt man zwar, aber von diesen Qualitäten ist wenig zu spüren.
Aber es gibt sehr ergreifende Stellen darin, Liebesgeschichten und Augenblicke der Verzweiflung und kalte, darum aber nicht weniger überzeugende Einsichten. Vor allem aber wird man die Heldin für ihren Mut bewundern. Gegen wie viel Widerstand hat sie sich immer wieder durchgesetzt! Wie stark muss jemand sein, um einen solchen Weg gehen zu können! Wie klug muss er aber auch sein, um das zu tun! Woher nimmt ein Junge, der in der Disziplin der chinesischen Volksbefreiungsarmee steckt, die Kraft, so anders zu sein als alle anderen um ihn herum? Wie ist das, wenn man ein Mann ist und Männer mag und doch ganz sicher weiß, dass man nicht schwul, sondern eigentlich eine Frau ist? Wer eine Ahnung davon hat, wie viel Kraft dazu gehört, eine eigene Meinung zu haben, nicht angewiesen zu sein auf das, was die anderen von einem halten, der wird voller Bewunderung für jemanden sein, der nicht nur seine Meinung, sondern selbst seinen Körper, sein Geschlecht, seine Empfindungen, seine Liebe nicht einfach aus dem Spiegel der Anderen entgegennehmen kann, sondern selbst entdecken, ja selbst schaffen muss.
Wollte man heute, 166 Jahre nach Thomas Carlyle Vorlesungen über "Helden und Heldenverehrung" halten, ein Kapitel müsste Jin Xing gewidmet sein. Wie bei allen Heldengeschichten kommt auch bei dieser im Kopf eines ganz unheldischen Otto Normalverbrauchers während der Lektüre der Gedanke auf, dass vielleicht nicht alles stimmt. Ist die Heldin jetzt tatsächlich glücklich mit ihren Kindern, ihrem Hund und mit Hans-Gerd, ihrem deutschen Freund? Oder ist der eine Zutat, die je nach Landesgeschmack gewechselt wird? Aber so ist es mit den wirklich legendären Figuren. Sie werden unscharf, die Erzähler bemächtigen sich ihrer.
Jin Xing: "Shanghai Tango". Mein Leben als Soldat und Tänzerin. Aufgezeichnet von Catherine Texier. Aus dem Französischen von Anne Spielmann. Blanvalet Verlag, München 2006. 223 Seiten, 21 s/w und farbige Fotos, 19,95 Euro. ISBN: 3764502169. ()
Lesen lernen
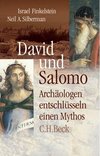 Der israelische Archäologe Israel Finkelstein und sein in Belgien lehrender Kollege Neil A. Silberman haben in ihrem eindrucksvollen Buch "Keine Posaunen vor Jericho" die Geschichte Israels von der biblischen Geschichte befreit und auf den Grund der archäologisch dokumentierten Tatsachen gestellt. Ihr neues Buch "David und Salomo - Archäologen entschlüsseln einen Mythos" ist eine Vertiefung jener wegbereitenden Arbeit. David und Salomo mag es gegeben haben - einige archäologische Funde, zum Beispiel die Stele von Tell Dan aus dem 9. vorchristlichen Jahrhundert, in deren Inschrift vom "Hause Davids" die Rede ist, legen das nahe - aber sie waren keine Könige, es gab keine Paläste. Sie waren die Anführer von Hirtenstämmen. Die Geschichte von König David, das macht die Lektüre dieses Buches so aufregend, ist in ihrem Kern die Geschichte des Anführers einer Räuberbande.
Der israelische Archäologe Israel Finkelstein und sein in Belgien lehrender Kollege Neil A. Silberman haben in ihrem eindrucksvollen Buch "Keine Posaunen vor Jericho" die Geschichte Israels von der biblischen Geschichte befreit und auf den Grund der archäologisch dokumentierten Tatsachen gestellt. Ihr neues Buch "David und Salomo - Archäologen entschlüsseln einen Mythos" ist eine Vertiefung jener wegbereitenden Arbeit. David und Salomo mag es gegeben haben - einige archäologische Funde, zum Beispiel die Stele von Tell Dan aus dem 9. vorchristlichen Jahrhundert, in deren Inschrift vom "Hause Davids" die Rede ist, legen das nahe - aber sie waren keine Könige, es gab keine Paläste. Sie waren die Anführer von Hirtenstämmen. Die Geschichte von König David, das macht die Lektüre dieses Buches so aufregend, ist in ihrem Kern die Geschichte des Anführers einer Räuberbande. Die Autoren schreiben: "Davids Guerillatruppe ist schnell und mobil. Davids Methoden sind Erpressung, Entführung, Täuschung und körperliche Gewalt." Man kann diese Zeilen nicht lesen, ohne daran zu denken, wie viele in Israel heute die Führung der Palästinenser exakt so charakterisieren. Hier liegt, ganz abgesehen von der Frage nach der historischen Wahrheit, der Sprengstoff von Finkelsteins und Silbermans Entmythologisierung. Die beiden Archäologen haben nicht nur die israelische Erde aufgedeckt, sondern auch den biblischen Text. Man muss sich nur die Situation klarmachen, die im ersten Buch Samuel Davids Truppe beschrieben wird: "Es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren, und er wurde ihr Oberster; und es waren bei ihm etwa vierhundert Mann". Dann wird man nicht nur die Aktualität erkennen, die in den alten Geschichten steckt, sondern auch entdecken, aus wessen Perspektive sie aufgeschrieben wurden, wen sie feiern und wen sie verachten.
Finkelstein und Silberman machen klar, dass Jerusalem im 10. Jahrhundert ein kleines Bergdorf war und nicht etwa die Hauptstadt eines Königreichs. David war kein gewaltiger Eroberer. Er hat auf einem sehr übersichtlichen Terrain hier und da ein Scharmützel riskiert, um seinen Männern Wein, Brot und Frauen zu verschaffen. Erst einhundert Jahre nach David entstand ein israelisches Königreich, dessen Hauptstadt allerdings nicht Jerusalem, sondern Samaria war, und regiert wurde es nicht vom Stamme David, sondern von den Omriden.
Finkelstein und Silberman schildern, wessen Interessen die biblischen Texte im Laufe einiger Jahrhunderte formten. Sie zeigen, einer langen hermeneutischen Tradition folgend und widersprechend, wie Schicht sich auf Schicht lagert, wie immer wieder neue Generationen, neue politische Konstellationen eine neue politische Theologie, neue Heilige Texte aus immer wieder demselben Material kreieren. "David und Salomo" ist also nicht nur eine Einführung in das, was früher einmal "biblische Archäologie" genannt wurde. Das Buch öffnet einem auch die Augen dafür, wie offen selbst die geschlossensten Texte sind. Mehr noch als vorderorientalische Archäologie lehrt es uns lesen.
Israel Finkelstein, Neil A. Silberman: "David und Salomo". Archäologen entschlüsseln einen Mythos. Aus dem Englischen von Rita Seuß. C.H. Beck Verlag, München 2006. 298 Seiten, Abbildungen, 24,90 Euro. ISBN: 3406546765.
Die Not des Rezipienten
 Wolfgang Kemps dreibändige Anthologie von Texten zur "Theorie der Fotografie" ist seit einem Vierteljahrhundert das Standardwerk zum Thema. Im Jahr 2000 ergänzte Hubertus von Amelunxen das Kempsche Werk mit einem vierten Band, der die seit 1980 neu hinzugekommenen Reflexionen vorstellte. Zum sechzigstem Geburtstag des in Hamburg lehrenden Kunsthistorikers Wolfgang Kemp hat der Schirmer-Mosel Verlag die vier Bücher in einem einzigen, knapp 1.300 Seiten umfassenden Band zusammengebunden.
Wolfgang Kemps dreibändige Anthologie von Texten zur "Theorie der Fotografie" ist seit einem Vierteljahrhundert das Standardwerk zum Thema. Im Jahr 2000 ergänzte Hubertus von Amelunxen das Kempsche Werk mit einem vierten Band, der die seit 1980 neu hinzugekommenen Reflexionen vorstellte. Zum sechzigstem Geburtstag des in Hamburg lehrenden Kunsthistorikers Wolfgang Kemp hat der Schirmer-Mosel Verlag die vier Bücher in einem einzigen, knapp 1.300 Seiten umfassenden Band zusammengebunden. Es ist eine Reise durch die Überlegungen zur Fotografie von 1839 bis 1995. Der erste Text stammt von Jules Janin, einem Pariser Kunstkritiker, der über das neue Verfahren der Daguerreotypie schrieb, schon bevor es Mitte 1839 veröffentlicht wurde. Er ist begeistert: "Wenn diese Platte dem hellen Tageslicht ausgesetzt wird, dann bildet sich sofort auf ihr jeder Schatten ab, der sie erreicht, die Erde oder der Himmel, das fließende Wasser, die Kathedrale, die sich in den Wolken verliert, der Stein, das Pflaster, das unsichtbare Sandkorn, das auf der Oberfläche liegt, alle diese Dinge, groß oder klein, die vor der Sonne gleich sind, sie bilden sich in dieser Camera obscura ab, die alle Eindrücke auffängt. Niemals hat die Zeichenkunst der großen Meister eine solche Zeichnung hervorgebracht. Wenn die Verteilung der Massen bewunderungswürdig erscheint, so sind die Details unzählbar. Es ist die Sonne selbst, als allmächtiges Werkzeug einer neuen Kunst, die diese unglaubliche Arbeit vollbringt."
Der jüngste Text stammt von Martha Rosler und beschäftigt sich mit Bildsimulationen und Computermanipulationen. Mit der Arbeit also, die der Mensch sich macht, nachdem die Sonne die ihre getan hat. Die vier Bände wird kaum jemand auf einen Satz lesen, aber es macht großen Spaß darin zu blättern. Natürlich bleibt man hängen bei den Großmeistern der Fototheorie, bei Baudelaire, Stieglitz, Hine, Strand, Teige, Rodtschenko, dessen Plädoyer für den Schnappschuss (mehr) - aus dem Jahre 1928 - daran erinnert, wie alt unsere gegenwärtigen Auseinandersetzungen sind -, Kracauer, Hausmann, Benjamin - der sich in dieser Sammlung viel weniger originell ausmacht als in den seine Texte analysierenden philosophischen Seminaren -, Sternberger, Man Ray, Adams, Bazin, Cartier-Bresson, Barthes, Bourdieu, Sontag - wie wenig Frauen in dieser Sammlung sind! - bis zu Flusser, Schmid, Gerz, Crimp, Baudrillard, Derrida, Virilio, Metz.
Man blättert durch diese Bände und erstmals wird einem klar, was fehlt. Eine Kollektion der Aufsätze aus Indien, China, Afrika, aus Ägypten, Iran, Afghanistan, Indonesien. Die vier Bände sind ein Dokument der fotoästhetischen Reflexion vor der Globalisierung. Fände Lothar Schirmer doch einen zweiten Wolfgang Kemp, der ihm auf noch einmal 1.000 Seiten zusammentrüge, was Hiroshige, Lu Xun, Mahfus vielleicht über Fotografie geschrieben haben. Es wäre ein Buch, das mit der Verblüffung über die Fotografie begänne, und das mit der Virtuosität, mit der heute in Japan, China, Indien nicht nur fotografiert, sondern auch über Fotografie nachgedacht wird, verblüffte. Aber einen zweiten Wolfgang Kemp wird Lothar Schirmer nicht finden. So wird uns die nächsten Jahre nur diese Anthologie bleiben.
 Es sind wunderbare Texte, man möchte viele Sonntagnachmittage darin verbringen. Zum Beispiel Wolfgang Kemps Einleitung in den dritten Band, der Texte aus den Jahren 1945 bis 1980 bringt. Er beginnt mit der Erinnerung daran, dass während der antikommunistischen Hexenjagd in den USA auch die Photo League neben der kommunistischen Partei und dem Ku Klux Klan als subversive Organisation geführt wurde und endet mit der den 68er verratenden Bemerkung des Autors: "Die gesellschaftlich produzierte Entsinnlichung aller Lebensbereiche bedingt den Bildhunger, der vom gleichen System dann (sicher unzureichend) gespeist wird. Der beklagte Konsum ist primär weder als Selbstlauf, noch als Inszenierung zu begreifen, er hat seine Ursache in der Not der Rezipienten, die keine Bewahrpädagogik und keine Aufklärungsarbeit in Sachen Manipulation aufheben wird."
Es sind wunderbare Texte, man möchte viele Sonntagnachmittage darin verbringen. Zum Beispiel Wolfgang Kemps Einleitung in den dritten Band, der Texte aus den Jahren 1945 bis 1980 bringt. Er beginnt mit der Erinnerung daran, dass während der antikommunistischen Hexenjagd in den USA auch die Photo League neben der kommunistischen Partei und dem Ku Klux Klan als subversive Organisation geführt wurde und endet mit der den 68er verratenden Bemerkung des Autors: "Die gesellschaftlich produzierte Entsinnlichung aller Lebensbereiche bedingt den Bildhunger, der vom gleichen System dann (sicher unzureichend) gespeist wird. Der beklagte Konsum ist primär weder als Selbstlauf, noch als Inszenierung zu begreifen, er hat seine Ursache in der Not der Rezipienten, die keine Bewahrpädagogik und keine Aufklärungsarbeit in Sachen Manipulation aufheben wird." Manche der Texte zeigen Patina. Aber wie auch in der Bildenden Kunst kommt es vor, dass die Patina den Reiz eines Textes erhöht. Da man von ihm nicht mehr erwartet, dass er die Wahrheit über einen Sachverhalt sagt, wird der Blick frei dafür zu erkennen, wie viel Wahrheit er über die Zeit sagt, in der und in die hinein er geschrieben wurde.
"Theorie der Fotografie". Band I-IV, 1839-1995, komplett in einem Band. Herausgegeben von Wolfgang Kemp und Hubertus von Amelunxen. Schirmer/Mosel, München 2006. 1292 Seiten, mit einigen wenigen s/w Abbildungen, 58 Euro. ISBN: 3829602391. ()
Wolfgang Kemp: "Foto-Essays zur Geschichte und Theorie der Fotografie". Erweiterte Ausgabe. Schirmer/Mosel, München 2006. 175 Seiten, 54 s/w Abbildungen, 19,80 Euro. ISBN: 3829602405.
Immer protestiert er
 Martin Mosebach hat ein Vorwort geschrieben, das neugierig macht auf den kolumbianischen Denker Nicolas Gomez Davila (1913-1994), diese ganz und gar unangepasste Existenz, die wie ein Ableger des frühen 19. ins späte 20. Jahrhundert wirkte. Seine "Notas" (Anmerkungen) sind jetzt im Verlag Matthes & Seitz in der Übersetzung von Ulrich Kunzmann erschienen. Alle drei sind nicht genug zu loben für ihre Arbeit. Es wird lange dauern bis Gomez Davilas Rang in Deutschland erkannt werden wird. Nicht weil er so schwierig zu erkennen wäre, sondern weil man ihn langsam lesen muss.
Martin Mosebach hat ein Vorwort geschrieben, das neugierig macht auf den kolumbianischen Denker Nicolas Gomez Davila (1913-1994), diese ganz und gar unangepasste Existenz, die wie ein Ableger des frühen 19. ins späte 20. Jahrhundert wirkte. Seine "Notas" (Anmerkungen) sind jetzt im Verlag Matthes & Seitz in der Übersetzung von Ulrich Kunzmann erschienen. Alle drei sind nicht genug zu loben für ihre Arbeit. Es wird lange dauern bis Gomez Davilas Rang in Deutschland erkannt werden wird. Nicht weil er so schwierig zu erkennen wäre, sondern weil man ihn langsam lesen muss. Die "Notas" sind kein Buch, das man liest. Entweder man blättert es durch auf der Suche nach etwas, das einen anfällt, wie der auf dem Klappentext zitierte Satz "Das Leben ist die Guillotine der Wahrheit", oder aber man benützt die Notas wie ein frommer Mann das Brevier. Man liest einen Abschnitt, überdenkt ihn, liest ihn noch einmal, denkt gegen ihn, liest ihn wieder und das immer von neuem. "Die Meditation ist unsere Besitznahme der Welt", schreibt Gomez Davila. Auf diese Weise ist man mit den 400 Seiten umfassenden "Notas" ein Leben lang beschäftigt. Wer Gomez Davila liest, hat sich aus der Gegenwart verabschiedet. Er taucht ein nicht in eine sei es noch so entfernte Vergangenheit, sondern in die Zeitlosigkeit selbst.
Jedenfalls geht es dem Autor mehr noch als um die Inhalte seiner Sätze um dieses Gefühl radikaler Entrückung. Er vermittelt es aber nicht nur. Er braucht es auch. Der aristokratische Gestus, mit dem Gomez Davila jede Verwicklung in das wirkliche Leben mit seinen Täuschungen und Enttäuschungen ablehnt, speist sich aus der Angst, vom Leben verschlungen zu werden. Das gibt den Texten etwas von der Komik jener blasierten 17-jährigen jungen Männer, die behaupten, das Leben zu kennen und darum nur Verachtung für es zu empfinden. So dumm das damals war, so sehr weiß man doch, dass man nie wieder so intelligent war wie in jenen Jahren.
Gomez Davila ist aus dieser Haltung gegenüber der Welt und dem Leben nie wieder hinausgekommen. Er hatte es sich darin sehr gemütlich gemacht. Darum sind diese "Anmerkungen" immer unangepasst und mal einfach nur dummes Zeug und dann wieder geniale Lichtblicke. Gomez Davila wusste das sehr genau. So findet sich zwischen den Sätzen: "Eine Partikel gesunden Menschenverstandes wirkt bei einer Frau wie Genie" und "Die Vernunft einer Frau ist das Arsenal ihrer Leidenschaften" die doch durchaus auch selbstkritisch zu verstehende Einsicht "Jeder Gedanke über Frauen ist eine in Grobheit verpackte Trivialität".
Freilich sollte man den selbstkritischen Anteil hier nicht überschätzen. Der Satz selbst ist doch vor allem eine weitere Grobheit. Er will ja nicht den Verfassern solcher Sätze am Zeug flicken, sondern er behauptet, es läge an der Natur der Sache, an den Frauen, wenn über sie nichts als in Grobheiten verpackte Trivialitäten zu sagen ist. Man wird das zu Recht eine Dummheit nennen. Aber es ist dumm, weil Gomez Davila so tut, als könnte man zum Beispiel über die Männer etwas anderes sagen als in Grobheiten verpackte Trivialitäten. Dass das aber gewissermaßen konstitutiv zum Genre des Aphorismus gehört, dass es also nicht am beschriebenen Objekt und vielleicht nicht einmal am schreibenden Subjekt, sondern wesentlich an der literarischen Form, auf die er so Großes hält, liegen könnte, vor diesem Gedanken fliehen die "Notas". Wer freilich auf der Flucht ist vor dem Anspruch, jeder Gedanke habe sich vor seiner Äußerung auf allgemeine Verträglichkeit hin abchecken zu lassen, der wird voller Freude immer wieder nach Gomez Davilas "Notas" greifen: "Der Verstand äußert sich nicht mit einer einladenden und liebevollen Geste. Der Verstand ist heimtückisch und verräterisch, argwöhnisch und misstrauisch, immer stößt er zunächst zurück und widerlegt, immer lehnt er ab, und immer protestiert er."
Nicolas Gomez Davila: "Notas". Unzeitgemäße Gedanken. Mit einem Essay von Martin Mosebach und einem Nachwort von Franco Volpi. Aus dem Spanischen von Ulrich Kunzmann. Matthes & Seitz, Berlin 2005. 444 Seiten, 34,90 Euro. ISBN: 388221855X. ()
Das eben ist der Weltkrieg
 Harry Graf Kessler (1868-1937) war eine der interessantesten Figuren des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Er ist einer der gar nicht so seltenen Spezies des Autors ohne Werk. Ein Mann, der zu viel zu tun hatte, nein, der zu viel tat, um Bücher schreiben zu können, der allerdings auch nicht wirklich etwas tat, sondern wohl eher so sehr damit beschäftigt war, angeregt und anregend zu leben, dass er zum Tun und zum Schreiben nicht kam. Mit dem Schreiben stimmt es nicht so ganz. Kessler hat Tagebuch geschrieben. Von 1880 bis 1937 und jeder der fast 1000seitigen Bände ist es wert aufmerksamst gelesen zu werden. Nur, wer schafft das? Schon 900 Seiten für sich sind ein fettes Programm, aber wenn es nun gar solche Seiten sind!
Harry Graf Kessler (1868-1937) war eine der interessantesten Figuren des Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Er ist einer der gar nicht so seltenen Spezies des Autors ohne Werk. Ein Mann, der zu viel zu tun hatte, nein, der zu viel tat, um Bücher schreiben zu können, der allerdings auch nicht wirklich etwas tat, sondern wohl eher so sehr damit beschäftigt war, angeregt und anregend zu leben, dass er zum Tun und zum Schreiben nicht kam. Mit dem Schreiben stimmt es nicht so ganz. Kessler hat Tagebuch geschrieben. Von 1880 bis 1937 und jeder der fast 1000seitigen Bände ist es wert aufmerksamst gelesen zu werden. Nur, wer schafft das? Schon 900 Seiten für sich sind ein fettes Programm, aber wenn es nun gar solche Seiten sind! Nehmen wir Sonntag, den 18. November 1917. Fast zweieinhalb eng gedruckte Seiten. Auf denen ist die Rede von Rodin, Grosz, der Elsass-Lothringischen Frage, der neuen Berliner Kunst und der drohenden Revolution. In der Zeitung wird von Rodins Tod berichtet. Kessler: "Er war einer meiner verehrtesten und ältesten Freunde, ich habe ihn noch acht Tage vor dem Kriege aus London nach Paris zurückgebracht. Beim Herausfahren aus Dover lagen wir über die Reling gelehnt, ich fragte ihn, ob er nicht hungrig sei? Er antwortete: 'Non, devant la nature je n'ai pas faim; la nature me nourrit.'"
Nach der Zeitungslektüre bekommt Kessler Besuch von George Grosz und John Heartfield. Sie wollen einen Film machen und er hat sich dafür "10.000 Mark vom Auswärtigen Amt bewilligen lassen." Ich weiß nicht, ob aus diesem Projekt etwas geworden ist, ob es die 10.000 Mark noch rechtzeitig vor der Revolution gab. Obwohl: Kessler stieg nach der Revolution noch ein wenig auf im Auswärtigen Amt. Bei Elsass-Lothringen geht es um die Bewilligung der Einrichtung eines elsässischen Büros in Basel. Ich weiß zu wenig über die genaue Chronologie der Auseinandersetzungen, um ermessen zu können, wie wichtig die Sitzung an jenem Sonntagmittag beim Staatssekretär - er war es übrigens auf ausdrücklichen Wunsch Kaiser Wilhelm II. geworden - Richard von Kühlmann war. Den Erläuterungen entnehme ich jedenfalls, dass der drei Wochen zuvor jede Art von Zugeständnis an Frankreich in dieser Frage abgelehnt hatte.
Nachmittags dann bei Grosz im Atelier. Ein Abschnitt, den man in Gänze zitieren müsste, ein Hymnus auf Berlin: "Überhaupt diese neuberlinische Kunst, Grosz, Becher, Benn, Wieland Herzfelde, höchst merkwürdig; Großstadtkunst, von hochgespannter Dichtigkeit der Eindrücke, die bis zur Simultaneität steigt; brutal realistisch und gleichgültig märchenhaft wie die Großstadt selbst, die Dinge wie von Scheinwerfern roh beleuchtet und entstellt und dann in einem Glanz verschwindend. Eine höchst nervöse, cerebrale, illusionistische Kunst, dadurch innerlichst mit dem Varit verwandt. Auch mit dem Kino, wenigstens mit einem möglichen, noch unentdeckten Kino. Blitzlichtkunst mit einem Parfüm von Laster und Perversität wie jede nächtliche Großstadtstraße. Ringsherum tobt der Weltkrieg; im Zentrum diese nervöse Stadt, in der sich so viel drängt und stößt, so viel Menschen und Straßen und Lichter und Farben und Interessen: Politik und Variete, Geschäft und noch immer Kunst, Feldgraue, Geheimräte, Chansonetten, und rechts und links, oben und unten irgendwo, sehr weit weg, die Schützengräben, stürmende Regimenter, Sterbende, U-Boote, Zeppeline, Flugzeuggeschwader, Kolonnen auf Schlammstraßen....."
Kessler steigert sich und besingt die Friedrichstraße, "die unbezwingbare", die nicht von Kosaken, Gurkhas oder Cowboys eingenommene. Aber dann kommt es: "Wenn hier eine Revolution hereinbräche, eine gewaltsame Umwälzung in dieses Chaos, Barrikaden auf der Friedrichstraße, oder der Einsturz der fernen Brustwehren, welch ein Funkenstieben, wie krachte dann der mächtige, unentwirrbar komplizierte Organismus, wie ähnlich dem Weltgericht. Und doch gerade das haben wir in Lüttich, Brüssel, Warschau, Bukarest erlebt, angerichtet, fast sogar in Paris. Das eben ist der Weltkrieg."
Man wird lange suchen können bis man eine vergleichbar hellsichtige Beobachtung - man beachte das "angerichtet" - findet. Nein, man muss nur weiter lesen bei Kessler, da gibt es alle zwanzig, dreißig Seiten Passagen wie diese, da die Nebel weg geschoben werden und man mit einem Mal ganz klar alles zu erkennen glaubt. Man muss Kessler hellwach lesen. Einzelne Abschnitte zwei, drei Mal und es werden einem immer wieder neue Nuancen aufgehen. Kessler beobachtet und macht sich seine Gedanken. Er macht sie sich, weil es ihm Spaß macht, ihnen zu folgen, sich von ihnen auf neue Wege locken zu lassen. Mehr noch aber interessiert ihn, was er sieht. Es ist die "Dichtigkeit der Eindrücke", die seine Tagebücher zu einer so anregenden, aber auch so anstrengenden Lektüre machen. Es gibt Ruhepausen darin.
Wer sich freilich für nichts interessiert, ist natürlich auch hier fein raus. Es gibt in Deutschland keinen mit Kessler vergleichbaren Autor, keinen der so viel und so viel Unterschiedliches wahrgenommen, beschrieben und kommentiert hat. Kessler war ein Wanderer zwischen Hof und Avantgarde, nein, nein, er war kein Wanderer. Er war auch kein Flaneur. Er war unterwegs. Er ging nicht gelangweilt spazieren in der Welt. Er wollte immer etwas. Selten haben, meistens erfahren. Seine Neugierde, sein Hunger nach Stoff, der die kleinen grauen Zellen in Bewegung hielt, war unermesslich. Ein Hochbegabter in den nicht sehr begehrten Fächern Zuschauen, Zuhören.
Sonntag, 17. November 1918, ein Jahr und 450 Seiten später: "Erster Sonntag nach der Revolution. Am späten Nachmittage bewegten sich große Massen von Spaziergängern über die Linden und bis zum Marstall, um die Spuren der Gefechte an den Gebäuden zu sehen. Alles sehr friedlich in spießbürgerlicher Neugier; namentlich die sehr auffallenden Einschläge am Marstall wurden begafft. Das Einzige gegen frühere Sonntage im Straßenbilde Veränderte ist das Fehlen der Schutzleute und die nicht sehr zahlreichen bewaffneten Matrosen, Wachen und Patrouillen." So sah das reale Weltgericht aus. Mit der expressionistischen Fantasie konnte die Berliner Revolution nicht mithalten. Sie war von rührender Unschuld. Jedenfalls an diesem Sonntagvormittag. Kessler hat sie ebenso klar festgehalten wie die Ekstase ihrer Vorahnung.
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch". Sechster Band, 1916-1918. Herausgegeben von Günter Riederer unter Mitarbeit von Christoph Hilse. Cotta Verlag, Stuttgart 2006. 962 Seiten, 58 Euro. (Subskriptionspreis: 49 Euro) ISBN: 3768198162.
Benjaminsche Unschärferelation
 Walter Benjamin, so erklärt uns Burkhardt Lindner im ersten Satz der Vorbemerkung zu dem von ihm herausgegebenen Benjamin-Handbuch, sei "von allen deutschen Intellektuellen der Weimarer Republik und ihres vom Hitlerreich aufgezwungenen Exils der philosophisch Gewichtigste und der wirkungsgeschichtlich Lebendigste". Wer sich von so viel superlativ-seligem PR-Trompetenklang abgestoßen fühlt und darum das Buch beiseite legt, zeigt zwar gute Reflexe, begeht aber dennoch einen Fehler. Benjamin gehört schließlich ganz sicher zu den schwierigeren Autoren, zu denen also, bei deren Lektüre der Leser immer wieder versucht ist, nachzuschlagen, um sich klar zu werden, worauf eine Anspielung zielt, welche Fenster zu welchen Himmeln oder Höllen ein sperriger, sich in die Argumentation kaum einfügender Begriff aufstößt. Benjamin ist also ein Autor, bei dessen Lektüre Einführungen nützlich sein können.
Walter Benjamin, so erklärt uns Burkhardt Lindner im ersten Satz der Vorbemerkung zu dem von ihm herausgegebenen Benjamin-Handbuch, sei "von allen deutschen Intellektuellen der Weimarer Republik und ihres vom Hitlerreich aufgezwungenen Exils der philosophisch Gewichtigste und der wirkungsgeschichtlich Lebendigste". Wer sich von so viel superlativ-seligem PR-Trompetenklang abgestoßen fühlt und darum das Buch beiseite legt, zeigt zwar gute Reflexe, begeht aber dennoch einen Fehler. Benjamin gehört schließlich ganz sicher zu den schwierigeren Autoren, zu denen also, bei deren Lektüre der Leser immer wieder versucht ist, nachzuschlagen, um sich klar zu werden, worauf eine Anspielung zielt, welche Fenster zu welchen Himmeln oder Höllen ein sperriger, sich in die Argumentation kaum einfügender Begriff aufstößt. Benjamin ist also ein Autor, bei dessen Lektüre Einführungen nützlich sein können. Die Beiträge im Handbuch sind von sehr unterschiedlicher Qualität. Das versteht sich bei - wenn ich richtig gezählt habe - 48 Autoren von selbst. Man mag zum Beispiel Axel Honneths Ausführungen zur "Kritik der Gewalt" noch so sehr schätzen, aber dass auf den 33 Spalten an keiner Stelle der Zusammenhang der ursprünglichen Veröffentlichung vorgestellt wird, ist für einen "Handbuch"-Beitrag unentschuldbar. Man vergleiche, wie Uwe Steiner dem Leser Benjamins in etwa gleichzeitig entstandenen Text "Kapitalismus und Religion" erschließt. Klar gegliedert führt Steiner von "Entstehung und Überlieferung" über "Werkkontext", "Forschung" und "Inhaltliche Hauptlinien und Einflüsse" bis zu "Die Grenzen des Kapitalismus".
Man tut gut daran, Steiners Erläuterungen, die sich natürlich auch mit der Bedeutung Sorels und der "Kritik der Gewalt" beschäftigen, auch als Koreferat zu Honneths Beitrag zu lesen. Der Leser, der nur schnell nachblättern möchte, der gar, der glaubt, die Artikel dieses Handbuchs würden ihm die Benjamin-Lektüre ersparen, wird enttäuscht sein. Das Handbuch ist zwar auch ein Führer durch das Labyrinth der Benjaminschen Gedankenwelt, mehr noch aber zieht es einen hinein. Nur Dumme und vor allem die, die es bleiben wollen, werden darin ein Argument gegen das Handbuch sehen. Natürlich widersprechen die Artikel auch einander. Das lässt sich bei einem knappen halben Hundert Mitarbeiter nicht vermeiden. Es ist aber auch kein Schaden. Der Leser erkennt so bald das Benjaminsche Oszillieren zwischen Politik, Religion und Kunst - ein heute wieder tödlich aktuelles Thema - als Versuch etwas gleichzeitig festzuhalten, das gleichzeitig so wenig messbar ist wie der Impuls und der Ort eines Teilchens. Die Benjaminsche Unschärfe ist das Ergebnis seiner Bemühung um Präzision.
"Benjamin Handbuch". Leben - Werk - Wirkung. Herausgegeben von Burckhardt Lindner. J. B. Metzler Verlag, Stuttgart 2006. 720 zweispaltige Seiten, 64,95 Euro. ISBN: 3476019853.








