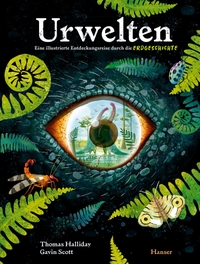Außer Atem: Das Berlinale Blog
Berlinale 1. Tag
Von Ekkehard Knörer, Christoph Mayerl
09.02.2007. Maria Speths "Madonnen" müssen sehr genau und duldsam beobachtet werden. Für Steven Soderberghs Wettbewerbsfilm "The Good German" gab es Pfiffe. Cao Hamburgers Wettbewerbsfilm "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren" erschafft eine Idylle zur Zeit der brasilianischen Militärdiktatur. Bruce McDonalds Film "The Tracey Fragments" lässt keine Gehirnzelle frei. Olivier Dahans Eröffnungsfilm "La vie en rose" zeigt Edith Piaf zwischen Champagner und Morphium, Hofschranzen und Pflegern, Misere und Göttlichkeit. Rückt mit nichts freiwillig heraus: Maria Speths "Madonnen" (Forum)
Eine Frau (Sandra Hüller) in einer Telefonzelle. Die Kamera ist draußen, es regnet. Die Frau schreit die Person am anderen Ende der Leitung an, sie solle ihr den Namen sagen. Offenbar sagt sie ihn nicht, denn die Frau in der Zelle knallt den Hörer mehrmals gegen das Gerät, bevor sie auflegt. Man hört dann das Weinen eines Kindes, das nicht im Bild war. Das ist die erste Szene des Films und sie macht uns mit der Person, die in seinem Zentrum steht, bekannt.
 Ihr Name ist Rita. Sie ist in Belgien auf der Suche nach ihrem Vater, den sie nicht kennt. Er lebte in Deutschland vor langer Zeit, eine Frau in einem Cafe hilft Rita weiter, dann steht sie vor der Tür des Hauses, in dem ihr Vater lebt mit einer neuen Familie. Der Sohn macht die Tür erst wieder zu, dann lässt er Rita rein, er ist ein Teenager und spielt etwas auf der Gitarre, die er nicht beherrscht. Die beiden sprechen auf Englisch, Belangloses. Später eine Szene am Abendessenstisch, alle sind peinlich berührt, dann lacht Rita hysterisch und draußen auf der Terrasse erzählt der Vater seiner Tochter auf Englisch, dass er einen Teich anlegen will. Sie erzählt ihm, dass ihre Mutter ums Leben gekommen ist, bei einem Autounfall. Rita bleibt erstmal. Dann ist es wieder Tag, sie sitzt neben ihrem Halbbruder auf der Couch und gibt dem Baby die Brust. Das Baby heißt J.T. - für Jermaine Tyrell - und sein Vater ist offenkundig schwarz. Ihr Halbbruder guckt auf Ritas Brust, dann fragt er, ob er auch einmal saugen darf. Sie lässt es zu, er saugt eine ganze Weile, es scheint ihm zu schmecken, dann geht die Tür auf und seine Mutter kommt rein.
Ihr Name ist Rita. Sie ist in Belgien auf der Suche nach ihrem Vater, den sie nicht kennt. Er lebte in Deutschland vor langer Zeit, eine Frau in einem Cafe hilft Rita weiter, dann steht sie vor der Tür des Hauses, in dem ihr Vater lebt mit einer neuen Familie. Der Sohn macht die Tür erst wieder zu, dann lässt er Rita rein, er ist ein Teenager und spielt etwas auf der Gitarre, die er nicht beherrscht. Die beiden sprechen auf Englisch, Belangloses. Später eine Szene am Abendessenstisch, alle sind peinlich berührt, dann lacht Rita hysterisch und draußen auf der Terrasse erzählt der Vater seiner Tochter auf Englisch, dass er einen Teich anlegen will. Sie erzählt ihm, dass ihre Mutter ums Leben gekommen ist, bei einem Autounfall. Rita bleibt erstmal. Dann ist es wieder Tag, sie sitzt neben ihrem Halbbruder auf der Couch und gibt dem Baby die Brust. Das Baby heißt J.T. - für Jermaine Tyrell - und sein Vater ist offenkundig schwarz. Ihr Halbbruder guckt auf Ritas Brust, dann fragt er, ob er auch einmal saugen darf. Sie lässt es zu, er saugt eine ganze Weile, es scheint ihm zu schmecken, dann geht die Tür auf und seine Mutter kommt rein.
Ihr Vater, der, wie sich dann zeigt, Polizist ist, wird Rita bald darauf der Polizei übergeben. Sie wird in Deutschland gesucht, das hat sie selbst zugegeben, und sie kommt in den offenen Vollzug. Paul, das Baby, ist dabei. Sie trifft eine Frau, von der dann klar wird, es ist ihre Mutter (Susanne Lothar) und damit die Person, die sie in der ersten Szene in der Telefonzelle angeschrien hat. Und auch die Person, von der sie ihrem Vater gegenüber behauptet hat, sie sei tot. Bei ihrer Mutter leben vier Kinder, von denen klar wird: Es sind Ritas Kinder.
 Man muss das so ausführlich erzählen, denn der Film erzählt, oder vielmehr: zeigt es genauso ausführlich. Man muss sich das alles, Stück für Stück und nach und nach, selber zusammenreimen. "Madonnen" ist kein Film, der freiwillig Informationen rausrückt und das hat er mit seiner Heldin gemein. Sandra Hüller, berühmt geworden mit Hans-Christian Schmids "Requiem", hat "Madonnen" noch davor gedreht. Und wenngleich ihre Leistung hier weniger spektakulär ist, ist sie mindestens genauso gut. Es ist nicht einfach, ihren Charakter zu beschreiben. Mal ist sie schrecklich aggressiv, dann scheint wieder ein Schmunzeln, auch über sich selbst, auf ihren Lippen zu liegen. Mal ist sie verstockt, störrisch, bockig, dann sieht man, wie sie in der Disco den GIs, deren Umgang sie sucht, sehr verführerisch und offensiv entgegentritt. Rita bekommt Geld vom Sozialamt und von Vater von dreien ihrer Kinder; sie mietet eine Wohnung, sie nimmt ihre Kinder wieder zu sich. Ein schwarzer GI, Marc, ist plötzlich in ihrem Leben, in ihrer Wohnung.
Man muss das so ausführlich erzählen, denn der Film erzählt, oder vielmehr: zeigt es genauso ausführlich. Man muss sich das alles, Stück für Stück und nach und nach, selber zusammenreimen. "Madonnen" ist kein Film, der freiwillig Informationen rausrückt und das hat er mit seiner Heldin gemein. Sandra Hüller, berühmt geworden mit Hans-Christian Schmids "Requiem", hat "Madonnen" noch davor gedreht. Und wenngleich ihre Leistung hier weniger spektakulär ist, ist sie mindestens genauso gut. Es ist nicht einfach, ihren Charakter zu beschreiben. Mal ist sie schrecklich aggressiv, dann scheint wieder ein Schmunzeln, auch über sich selbst, auf ihren Lippen zu liegen. Mal ist sie verstockt, störrisch, bockig, dann sieht man, wie sie in der Disco den GIs, deren Umgang sie sucht, sehr verführerisch und offensiv entgegentritt. Rita bekommt Geld vom Sozialamt und von Vater von dreien ihrer Kinder; sie mietet eine Wohnung, sie nimmt ihre Kinder wieder zu sich. Ein schwarzer GI, Marc, ist plötzlich in ihrem Leben, in ihrer Wohnung.
Sie nimmt es hin. Wir nehmen es hin. Man muss dem Film gegenüber diese beobachtende, duldende Haltung einnehmen, es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man nicht wahnsinnig werden will. Rita ist, wie sie ist, und das Drehbuch, auch um dramaturgische Rundungen und Schließungen ganz ausdrücklich nicht bemüht, bringt sie nicht auf einen Nenner. Mit einer weniger unberechenbaren, einer weniger undurchsichtigen Darstellerin als Sandra Hüller ginge das alles nicht gut. Rita ist keine Sympathieträgerin und oft genug hält man es kaum aus mit ihr. Trotzdem hört man nicht auf, sich für sie zu interessieren und an ihr und den Dingen Anteil zu nehmen, die meist sie selbst sich zufügt; sie ist seltsam selbstbestimmt, noch, wenn nicht gerade dann, wenn sie nicht weiß, was sie tut.
Ästhetisch setzt "Madonnen" - anders als noch Maria Speths ganz präzise, Tableau für Tableau, durchkomponierter Erstling "In den Tag hinein" - auf ungeschönten Realismus. Es ist nicht der Handkamera-Realismus der Dardenne-Brüder, die hier koproduziert haben, eher ein unruhiges Seinlassen der Bilder, der Versuch, die Ausschnitthaftigkeit des Geschichte und die Unzugänglichkeit der Charaktere in Einstellungen aufzulösen. Oft blicken wir durch Scheiben und Glas hindurch. Nichts wird hier transparent. Aber die Figur, das Milieu, sind von Anfang bis Ende und Szene für Szene einfach präsent.
Ekkehard Knörer
"Madonnen". Regie: Maria Speth. Mit Sandra Hüller, Oliver Gourmet, Susanne Lothar, Luisa Sappelt und anderen. Deutschland 2006, 120 Minuten (Forum)
Fad wie Muckefuck: Steven Soderberghs "The Good German" (Wettbewerb)
 Pfiffe im Saal, das ist selten. Selten so berechtigt. Ein guter Deutscher vielleicht, aber beileibe kein guter Film. Ein romantischer Thriller soll es sein, platziert im Nachkriegsberlin 1945 und gedreht mit der Kameratechnik von damals. Was Soderbergh daraus gemacht hat, ist ein schlechter "Casablanca"-Klon (es gibt eine Verabschiedung am Flughafen Tempelhof!), gedreht mit der sehr heutigen Überzeugung, dass Nazis und Krieg und Berlin immer gut ankommen. Tun sie nicht. Diese Geschichte um den Kriegskorrespondenten Jake, der in Berlin seine deutsche Vorkriegsliebe Lena Brandt wieder trifft, die aber von allen Geheimdiensten gejagt wird, ist so fad wie Muckefuck. Auf der Strecke bleiben in diesem Rennen Lenas Mann und der junge amerikanische Geliebte. Es gibt natürlich noch ein paar Geheimnisse, die im Laufe der fast zwei Stunden enthüllt werden, aber für die interessieren sich nur Russen und Amerikaner, der Zuschauer schnell nicht mehr.
Pfiffe im Saal, das ist selten. Selten so berechtigt. Ein guter Deutscher vielleicht, aber beileibe kein guter Film. Ein romantischer Thriller soll es sein, platziert im Nachkriegsberlin 1945 und gedreht mit der Kameratechnik von damals. Was Soderbergh daraus gemacht hat, ist ein schlechter "Casablanca"-Klon (es gibt eine Verabschiedung am Flughafen Tempelhof!), gedreht mit der sehr heutigen Überzeugung, dass Nazis und Krieg und Berlin immer gut ankommen. Tun sie nicht. Diese Geschichte um den Kriegskorrespondenten Jake, der in Berlin seine deutsche Vorkriegsliebe Lena Brandt wieder trifft, die aber von allen Geheimdiensten gejagt wird, ist so fad wie Muckefuck. Auf der Strecke bleiben in diesem Rennen Lenas Mann und der junge amerikanische Geliebte. Es gibt natürlich noch ein paar Geheimnisse, die im Laufe der fast zwei Stunden enthüllt werden, aber für die interessieren sich nur Russen und Amerikaner, der Zuschauer schnell nicht mehr.
 Dass Schwarzmarkt, Agenten und Raketenwissenschaftler ihre Reize haben, will niemand bestreiten. Aber was bitte schön bringt dieser uninspirierte Blick in die Vergangenheit, diese Geschichte von der Schwierigkeit, das Richtige im Falschen zu tun, die so schon viel besser erzählt wurde, lange vor Soderbergh, ja sogar vor den Nazis? Der Film ist ganz Pastiche, George Clooney und Tobey Maguire wirken allerdings wie frisch aus dem Ei gepellt, als wären sie gerade aus ihrem Learjet gestiegen, der nonstop vom L.A. International Airport des Jahres 2007 ins Berlin von 1945 geflogen ist. Die einzige Vertreterin des Hauptpersonals, die stimmig aussieht, ist Cate Blanchett, und das deshalb, weil sie offenbar einen Marlene-Dietrich-Lookalike Workshop besucht hat. Ein dumpfes Zitat, all das, da hilft auch die kritikerbesänftigende Maßnahme nicht, den Helden zum Journalisten zu machen.
Dass Schwarzmarkt, Agenten und Raketenwissenschaftler ihre Reize haben, will niemand bestreiten. Aber was bitte schön bringt dieser uninspirierte Blick in die Vergangenheit, diese Geschichte von der Schwierigkeit, das Richtige im Falschen zu tun, die so schon viel besser erzählt wurde, lange vor Soderbergh, ja sogar vor den Nazis? Der Film ist ganz Pastiche, George Clooney und Tobey Maguire wirken allerdings wie frisch aus dem Ei gepellt, als wären sie gerade aus ihrem Learjet gestiegen, der nonstop vom L.A. International Airport des Jahres 2007 ins Berlin von 1945 geflogen ist. Die einzige Vertreterin des Hauptpersonals, die stimmig aussieht, ist Cate Blanchett, und das deshalb, weil sie offenbar einen Marlene-Dietrich-Lookalike Workshop besucht hat. Ein dumpfes Zitat, all das, da hilft auch die kritikerbesänftigende Maßnahme nicht, den Helden zum Journalisten zu machen.
Christoph Mayerl
"The Good German": Regie: Steven Soderbergh. Mit George Clooney, Cate Blanchett, Tobey Maguire und anderen. USA 2006, 108 Minuten
Zum Wohlfühlen: Cao Hamburgers "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren" (Wettbewerb)
Es ist das Jahr 1970. Sommerferienzeit. Im blauen Käfer brechen der 12-jährige Mauro (Michel Joelsas) und seine Eltern auf aus dem Kaff Minas Gerais nach Sao Paolo, aber der überstürzte Aufbruch macht unübersehbar deutlich: Um Urlaub geht es hier nicht. Ein schneller Abschied, dann sitzt Mauro vor der Wohnungstür seines Großvaters, der aber kommt nicht. Stattdessen ein alter Mann, der erst mal nur Jiddisch spricht und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, als er erfährt, um wen es sich handelt. Am Tag nämlich der geplanten Übergabe ist der Großvater in seinem Friseursalon gestorben. Denkbar schlechtes Timing.
 Die Eltern weg, der Großvater tot, Mauro allein in der Großstadt, mitten in einer lebendigen jüdischen Gemeinschaft, die den Jungen in die Hände des sehr widerstrebenden Schlomo (Germano Haiut) gibt, der ihn fand. Eines Morgens ist Schlomo zu lang im Bad und muss, als er raus kommt, nicht nur sehen, dass Mauro pinkelnd die Zimmerpflanze begießt, schlimmer noch: der Junge ist gar nicht beschnitten. Den Spitznamen Moischele, kleiner Moses, hat Mauro, das Findelkind, trotzdem sofort weg.
Die Eltern weg, der Großvater tot, Mauro allein in der Großstadt, mitten in einer lebendigen jüdischen Gemeinschaft, die den Jungen in die Hände des sehr widerstrebenden Schlomo (Germano Haiut) gibt, der ihn fand. Eines Morgens ist Schlomo zu lang im Bad und muss, als er raus kommt, nicht nur sehen, dass Mauro pinkelnd die Zimmerpflanze begießt, schlimmer noch: der Junge ist gar nicht beschnitten. Den Spitznamen Moischele, kleiner Moses, hat Mauro, das Findelkind, trotzdem sofort weg.
Bis dahin ist "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren", ein sehr geduldig, sehr sorgfältig gearbeiteter Film; die ersten Minuten bestehen aus subtilen Schärfeverlagerungen, rasch, aber gleitend fast geschnittenen Ellipsen. Man spürt die Irritation des Alltags, aber zunächst buchstabieren Regie und Buch nichts aus. Erzählt wird strikt aus Mauros Perspektive, man durchschaut, was er durchschaut und ahnt nur und begreift langsam erst, was er nicht versteht. Und das ist in erster Linie der politische Hintergrund. Brasilien ist eine Militärdiktatur, die Linke ist unterdrückt und Dissidenten müssen um ihr Leben fürchten. So ahnt man bald, dass Mauros Eltern als Kommunisten fliehen mussten, ins Ausland oder in den Untergrund. Sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt wird das Großereignis des Jahres, die Fußball-WM in Mexiko, zu der das brasilianische Dream-Team um Pele als Favorit antritt.
 Leider gerät der Film bei seinem Versuch, diese Mischung aus Fußball-Zeitkolorit, angedeuteter Politik, jüdischem Milieu und der Geschichte einer wunderbaren Freundschaft Mauros mit der gleichaltrigen Hanna ins Verhältnis zu setzen, bald aus der Balance, die ihm zu Beginn noch gelingt. Die Unschuld der Kinderperspektive wirkt umso eher in manipulativer Absicht erborgt, je klarer wird, dass politische Ereignisse hier eher Garnierung einer Geschichte vom Erwachsenwerden sind, als der Hintergrund, der alles durchdringt. Zusehends gerät der Film zur Feier eines unproblematischen patriotischen Multikulturalismus; der Verzicht auf genauere Beschreibung und kritische Analyse ist erschlichen durch den einmal gewählten Fokus. Auch die subtilen Mittel des Beginns werden im Fortgang vergröbert. Immer aufdringlicher wird die Musik, immer deutlicher werden die Unterstreichungen und die Sequenzen kaum getrübter Fröhlichkeit. Über weite Strecken ist "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren" dann ein Wohlfühlfilm über einige fast schon idyllische Wochen zur Hochzeit der brasilianischen Militärdiktatur.
Leider gerät der Film bei seinem Versuch, diese Mischung aus Fußball-Zeitkolorit, angedeuteter Politik, jüdischem Milieu und der Geschichte einer wunderbaren Freundschaft Mauros mit der gleichaltrigen Hanna ins Verhältnis zu setzen, bald aus der Balance, die ihm zu Beginn noch gelingt. Die Unschuld der Kinderperspektive wirkt umso eher in manipulativer Absicht erborgt, je klarer wird, dass politische Ereignisse hier eher Garnierung einer Geschichte vom Erwachsenwerden sind, als der Hintergrund, der alles durchdringt. Zusehends gerät der Film zur Feier eines unproblematischen patriotischen Multikulturalismus; der Verzicht auf genauere Beschreibung und kritische Analyse ist erschlichen durch den einmal gewählten Fokus. Auch die subtilen Mittel des Beginns werden im Fortgang vergröbert. Immer aufdringlicher wird die Musik, immer deutlicher werden die Unterstreichungen und die Sequenzen kaum getrübter Fröhlichkeit. Über weite Strecken ist "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren" dann ein Wohlfühlfilm über einige fast schon idyllische Wochen zur Hochzeit der brasilianischen Militärdiktatur.
Ekkehard Knörer
"Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren". Regie: Cao Hamburger. Mit Michel Joelsas, Germano Haiut, Daniele Piepszyk, Caio Blat und anderen. Brasilien 2006, 104 Minuten (Wettbewerb)
Wie bei Ikea: Bruce McDonalds "The Tracey Fragments" (Panorama)
 Es ist ein ungleiches Match, diese Rezension. Wer über Film schreibt, muss schon immer mit der linearen Beschränkung des Gedruckten gegenüber der Gleichzeitigkeit von Bild und Ton auskommen. Aber was, wenn die Bilder sich wie in "The Tracey Fragments", dem Eröffnungsfilm der Panorama-Reihe vermehren wie die Karnickel, und schließlich ein knappes Dutzend Bildstränge sich gleichzeitig über die Leinwand winden? Aber der Reihe nach. Schön linear. Tracey ist fünfzehn und sehr tief drin in ihrer Pubertät. Ihre Umgebung gibt wenig Halt, der Vater nennt seine Kinder "Unfälle", die Mutter raucht drei Schachteln Zigaretten am Tag und sitzt ansonsten so festgegossen vor dem Fernseher, dass das Aufstehen "einer chirurgischen Operation nahe kommt", wie Tracey kommentiert. Tracey macht sich auf die Suche nach ihrem kleinen Bruder, den sie hypnotisiert hat, damit er bellt wie ein Hund. Das ist die schon recht fantastische Klammer, die ein paar recht aufreibende Tage zusammengefasst, in denen Tracey von zu Hause ausreißt, von ihrem Freund Billy Zero träumt, einem Vorstadtgangster mit einer leeren Dose Fleisch und Bohnen den Hals aufschlitzt, fast vergewaltigt wird und tatsächlich defloriert. Das ist nicht gerade wenig, und Bruce McDonald hat sein Übriges getan, um die Verwirrung, die sich auch zu einem großen Teil in Traceys Kopf abspielt, am Schneidetisch zu multiplizieren und multipliziert zurückzuwerfen.
Es ist ein ungleiches Match, diese Rezension. Wer über Film schreibt, muss schon immer mit der linearen Beschränkung des Gedruckten gegenüber der Gleichzeitigkeit von Bild und Ton auskommen. Aber was, wenn die Bilder sich wie in "The Tracey Fragments", dem Eröffnungsfilm der Panorama-Reihe vermehren wie die Karnickel, und schließlich ein knappes Dutzend Bildstränge sich gleichzeitig über die Leinwand winden? Aber der Reihe nach. Schön linear. Tracey ist fünfzehn und sehr tief drin in ihrer Pubertät. Ihre Umgebung gibt wenig Halt, der Vater nennt seine Kinder "Unfälle", die Mutter raucht drei Schachteln Zigaretten am Tag und sitzt ansonsten so festgegossen vor dem Fernseher, dass das Aufstehen "einer chirurgischen Operation nahe kommt", wie Tracey kommentiert. Tracey macht sich auf die Suche nach ihrem kleinen Bruder, den sie hypnotisiert hat, damit er bellt wie ein Hund. Das ist die schon recht fantastische Klammer, die ein paar recht aufreibende Tage zusammengefasst, in denen Tracey von zu Hause ausreißt, von ihrem Freund Billy Zero träumt, einem Vorstadtgangster mit einer leeren Dose Fleisch und Bohnen den Hals aufschlitzt, fast vergewaltigt wird und tatsächlich defloriert. Das ist nicht gerade wenig, und Bruce McDonald hat sein Übriges getan, um die Verwirrung, die sich auch zu einem großen Teil in Traceys Kopf abspielt, am Schneidetisch zu multiplizieren und multipliziert zurückzuwerfen.
McDonald hat seine Technik der Split-Screen hier zum Äußersten getrieben, so dass der Zuschauer sich tatsächlich bis zu zehn unterschiedlichen Szenen auf einmal gegenüber sieht. Man muss sich das als Comicseite vorstellen, nur animiert: also im Extremfall zehn mal 24 Bilder pro Sekunde. Das Ganze wird noch angereichert durch die Palette an Formaten, durch die sich McDonald arbeitet: von der fingierten Nachrichtensendung über das Homevideo bis hin zu Big-Brother-ähnlichen Infrarotaufnahmen vom imaginierten Liebesspiel mit Billy. Alles, was das Kino hergibt - auf einmal.
 Das ist durchaus eine adäquate Form, um in den Kopf einer wilden 15-Jährigen hineinzulinsen. Auch der massenhafte Konsum von Musikvideos verändert das Bewusstsein, wie hier eindrucksvoll bewiesen wird. Und die Zeit ist natürlich relativ. Das sieht dann ungefähr so aus. Als Tracey von zu Hause ausbricht, sieht man sie in einem schmalen Band am linken Rand noch leise die Tür zumachen, während sie im mittleren Teil schon am Zaun entlang rennt. Rechts sind mehrere kleine Quadrate zu sehen, in denen man im Sekundenabstand neue Stills ihres Profils in monochromem Blau sieht. Dazu erklingt eine neue Einspielung von Patti Smith' wilden "Horses", und tatsächlich ist das untere Drittel der Leinwand für ein weißes Pferd reserviert, dass in vollem Galopp auf den Betrachter zustürmt. Ach ja, das Pferd wird jeweils für einige Sekundenbruchteile im Takt des Songs an die Stelle der laufenden Tracey in der Mittelsektion geschnitten.
Das ist durchaus eine adäquate Form, um in den Kopf einer wilden 15-Jährigen hineinzulinsen. Auch der massenhafte Konsum von Musikvideos verändert das Bewusstsein, wie hier eindrucksvoll bewiesen wird. Und die Zeit ist natürlich relativ. Das sieht dann ungefähr so aus. Als Tracey von zu Hause ausbricht, sieht man sie in einem schmalen Band am linken Rand noch leise die Tür zumachen, während sie im mittleren Teil schon am Zaun entlang rennt. Rechts sind mehrere kleine Quadrate zu sehen, in denen man im Sekundenabstand neue Stills ihres Profils in monochromem Blau sieht. Dazu erklingt eine neue Einspielung von Patti Smith' wilden "Horses", und tatsächlich ist das untere Drittel der Leinwand für ein weißes Pferd reserviert, dass in vollem Galopp auf den Betrachter zustürmt. Ach ja, das Pferd wird jeweils für einige Sekundenbruchteile im Takt des Songs an die Stelle der laufenden Tracey in der Mittelsektion geschnitten.
Das hört sich recht fragmentarisch an. Ist es auch. Aber in guten Momenten findet Bruce McDonald zu einer Einheit, in der die einzelnen Fenster eine Symbiose eingehen und tatsächlich eine sehr intensive Seherfahrung zulassen. Das liegt auch an der Präsenz von Ellen Page, die als Gravitationsfeld diese Filmzentrifuge vor dem Zerreißen bewahrt. In diesen gelungenen Passagen schwillt der Film über Normalmaß an, und tatsächlich hat man nach diesen reichhaltigen 80 Minuten das Gefühl, schon mindestens zwei Stunden Seharbeit geleistet zu haben. Denn arbeiten muss hier tatsächlich der Zuschauer. Es hat etwas von Ikea, diese Verlagerung eines Teils der Wertschöpfung auf den Kunden. Der Zuschauer setzt seinen Film selbst zusammen. Mehr Freiheit bedeutet das aber nicht, die Führung wirkt sogar enger als in konservativen Ein-Fenster-Filmen. Die Erschöpfung weicht nach den Credits, die zum Glück unfragmentiert daher kommen, einem gewissen Gefühl der Nötigung, und das ist der Hauptvorwurf an McDonald. Indem man damit beschäftigt ist, die einzelnen Fragmente gleichzeitig in sich aufzunehmen, bleibt keine einzige Gehirnzelle frei, das Gesehene mit der eigenen Imagination zu verknüpfen. Eine Tour de force im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wirkt der die Teamarbeit betonende, mit Cowboyhut sehr väterlich wirkende McDonald doch plötzlich wie ein Autokrat. Trotz allem: Hier treibt einer die Bildsprache voran. Ob zum Wohle des Zuschauers, davon sollte der sich unbedingt selbst ein Bild machen. Oder zehn.
Christoph Mayerl
"The Tracey Fragments": Regie: Bruce McDonald. Mit Ellen Page, Max McCabe-Lokos, Ari Cohen, Slim Twig und anderen. Kanada 2007, 80 Minuten (Panorama).
Kein Laubfrosch: Olivier Dahans "La vie en rose" (Wettbewerb)
 Eröffnungsfilme sind keine Laubfrösche, und sagen deshalb wenig darüber aus, was die Aussichten für das Festival sind. In diesem Fall hätte es allerdings nicht viel ausgemacht, denn so würden uns in den nächsten Tagen angenehme Respektlosigkeit vor großen Namen, ernsthafte Schauspielerei und ein Schuss Selbstironie erwarten. Edith Piaf ist ein Nationalheiligtum Frankreichs, und Olivier Dahan ist es anzurechnen, dass er es erhält, indem er mit einem großen Hammer die Stuck- und Zierratschichten abklopft, die sich abgelagert haben. Edith Piaf war immer, wie wir erfahren, das verschorfte Kind von der Straße, auch als schwerkranke Diva, die wie ein unglückliches und hilfloses Gör seine Umgebung tyrannisert. Um diese beiden Pole kreist der Film, für ein Leben dazwischen, fürs Erwachsenwerden ist keine Zeit im Film. Dahan schildert die Piaf als Straßensängerin, die vor ihrer abwesenden Mutter und dem ständig besoffenen Vater davon läuft. Es sind Vaterfiguren, die sich ihrer annehmen und einen Star aus ihr machen. Edith Piaf muss angeleitet werden, muss umsorgt werden, am Schluss von einem ganzen Hofstaat an Pflegern-Assistenten-Managern. Sie scheint sich nie wohlzufühlen in der Welt des Glamours, in die sie sich langsam hineinsingt, und so richtig glücklich sieht man sie nur, wenn sie in einer Brasserie spätabends für die Trinker auftritt und wenn sie sich in Marcel Cerdan verliebt, den Boxer, der Sandwichs mit rohem Fleisch dem französischen Braten in Edelrestaurants vorzieht.
Eröffnungsfilme sind keine Laubfrösche, und sagen deshalb wenig darüber aus, was die Aussichten für das Festival sind. In diesem Fall hätte es allerdings nicht viel ausgemacht, denn so würden uns in den nächsten Tagen angenehme Respektlosigkeit vor großen Namen, ernsthafte Schauspielerei und ein Schuss Selbstironie erwarten. Edith Piaf ist ein Nationalheiligtum Frankreichs, und Olivier Dahan ist es anzurechnen, dass er es erhält, indem er mit einem großen Hammer die Stuck- und Zierratschichten abklopft, die sich abgelagert haben. Edith Piaf war immer, wie wir erfahren, das verschorfte Kind von der Straße, auch als schwerkranke Diva, die wie ein unglückliches und hilfloses Gör seine Umgebung tyrannisert. Um diese beiden Pole kreist der Film, für ein Leben dazwischen, fürs Erwachsenwerden ist keine Zeit im Film. Dahan schildert die Piaf als Straßensängerin, die vor ihrer abwesenden Mutter und dem ständig besoffenen Vater davon läuft. Es sind Vaterfiguren, die sich ihrer annehmen und einen Star aus ihr machen. Edith Piaf muss angeleitet werden, muss umsorgt werden, am Schluss von einem ganzen Hofstaat an Pflegern-Assistenten-Managern. Sie scheint sich nie wohlzufühlen in der Welt des Glamours, in die sie sich langsam hineinsingt, und so richtig glücklich sieht man sie nur, wenn sie in einer Brasserie spätabends für die Trinker auftritt und wenn sie sich in Marcel Cerdan verliebt, den Boxer, der Sandwichs mit rohem Fleisch dem französischen Braten in Edelrestaurants vorzieht.
 Dahan musste etwas mit den berückenden Liedern der Piaf und vor allem ihrer Stimme anfangen, er musste Bilder finden für etwas, das man am liebsten mit geschlossenen Augen genießen will. Er musste dem allgemeinen Konsens entgehen, dass die Piaf ja doch sehr schön singt. Dahans Ausweg ist die Konfrontation. Wir sehen Krankheit, Leid, körperliche Schmerzen, Armut, wir sehen verschmiertes Makeup, zitternde Hände, verschütteten Champagner, blutige Morphium-Spritzen. Die Piaf ist nicht schön, sie kränkelt von Anfang an, selbst ihre Stimme klingt im Alltag nur aufdringlich und nicht aufreizend. Und dann sind da die Lieder, etwa dreißig sollen es sein, die mal nebenebei eingestreut, mal als großer Auftritt inszeniert werden. Von dieser Spannung zwischen Bild und Ton lebt der Film, und er lebt natürlich von Marion Cotillard, die mehr Piaf zu sein scheint als diese es selbst je war. Cotillard erschafft ihre Piaf als Schelm, die immer fremd ist in ihrer Umgebung und sich lustig macht über die Hofschranzen und Fans und deren Bewunderung sie doch so dringend braucht wie die tägliche Spritze. Sie zerstört jeden Anflug von Feierlichkeit mit einem tragischen Witz, unterbricht die steife Stimmung der Upper Class mit einem unerhört dreckigen Lachen und legt sich quer, wo sie kann. Sie kann es nicht oft. Sie muss singen, und sie muss auftreten. Das Gesicht der Cotillard sagt das alles ohne Worte: Mit entspannten Zügen ist es das einer klassischen Schönheit. Bewegt sie sich, ist man zurück in der Brasserie in Paris, bei den Verlierern, aus der sie ihr Mentor zerrt, um sie für die große Karriere zu trainieren. Immer, wenn sie sich bewegt, macht die Piaf einen Fehler und eckt an. Sie hört nie auf, es trotzdem zu versuchen, aber ihre Versuche werden seltener. Sie mag das Leben nicht, das sie hat, und weiß doch nicht, was sie anderes tun soll als singen.
Dahan musste etwas mit den berückenden Liedern der Piaf und vor allem ihrer Stimme anfangen, er musste Bilder finden für etwas, das man am liebsten mit geschlossenen Augen genießen will. Er musste dem allgemeinen Konsens entgehen, dass die Piaf ja doch sehr schön singt. Dahans Ausweg ist die Konfrontation. Wir sehen Krankheit, Leid, körperliche Schmerzen, Armut, wir sehen verschmiertes Makeup, zitternde Hände, verschütteten Champagner, blutige Morphium-Spritzen. Die Piaf ist nicht schön, sie kränkelt von Anfang an, selbst ihre Stimme klingt im Alltag nur aufdringlich und nicht aufreizend. Und dann sind da die Lieder, etwa dreißig sollen es sein, die mal nebenebei eingestreut, mal als großer Auftritt inszeniert werden. Von dieser Spannung zwischen Bild und Ton lebt der Film, und er lebt natürlich von Marion Cotillard, die mehr Piaf zu sein scheint als diese es selbst je war. Cotillard erschafft ihre Piaf als Schelm, die immer fremd ist in ihrer Umgebung und sich lustig macht über die Hofschranzen und Fans und deren Bewunderung sie doch so dringend braucht wie die tägliche Spritze. Sie zerstört jeden Anflug von Feierlichkeit mit einem tragischen Witz, unterbricht die steife Stimmung der Upper Class mit einem unerhört dreckigen Lachen und legt sich quer, wo sie kann. Sie kann es nicht oft. Sie muss singen, und sie muss auftreten. Das Gesicht der Cotillard sagt das alles ohne Worte: Mit entspannten Zügen ist es das einer klassischen Schönheit. Bewegt sie sich, ist man zurück in der Brasserie in Paris, bei den Verlierern, aus der sie ihr Mentor zerrt, um sie für die große Karriere zu trainieren. Immer, wenn sie sich bewegt, macht die Piaf einen Fehler und eckt an. Sie hört nie auf, es trotzdem zu versuchen, aber ihre Versuche werden seltener. Sie mag das Leben nicht, das sie hat, und weiß doch nicht, was sie anderes tun soll als singen.
 Mitleid hat man durchaus mit ihr, aber es trieft nicht. Und zwar deshalb nicht, weil die Edith zur Piaf immer einen gehörigen Abstand einzuhalten versucht. Natürlich kann sie bald nicht mehr entkommen, und nachts auf ihrem Sterbebett, wo ihre blauen Augen nur noch schwarze Pfützen sind, mischt sich endlich alles, was vorher getrennt war. Bild und Ton, Edith und Piaf, Misere und Göttlichkeit. Ein berührender und nicht überzuckerter Film, den man unbedingt auf großer Leinwand, in Dolby Surround, und wenn es geht, mit einem Glas sehr trockenem Rotwein genießen sollte.
Mitleid hat man durchaus mit ihr, aber es trieft nicht. Und zwar deshalb nicht, weil die Edith zur Piaf immer einen gehörigen Abstand einzuhalten versucht. Natürlich kann sie bald nicht mehr entkommen, und nachts auf ihrem Sterbebett, wo ihre blauen Augen nur noch schwarze Pfützen sind, mischt sich endlich alles, was vorher getrennt war. Bild und Ton, Edith und Piaf, Misere und Göttlichkeit. Ein berührender und nicht überzuckerter Film, den man unbedingt auf großer Leinwand, in Dolby Surround, und wenn es geht, mit einem Glas sehr trockenem Rotwein genießen sollte.
Christoph Mayerl
"La vie en rose": Regie: Olivier Dahan. Mit Marion Cotillard, Sylvie Testud, Gerard Depardieu und anderen. Frankreich, Großbritannien, Tschechische Republik, 2006, 140 min (Wettbewerb)
Eine Frau (Sandra Hüller) in einer Telefonzelle. Die Kamera ist draußen, es regnet. Die Frau schreit die Person am anderen Ende der Leitung an, sie solle ihr den Namen sagen. Offenbar sagt sie ihn nicht, denn die Frau in der Zelle knallt den Hörer mehrmals gegen das Gerät, bevor sie auflegt. Man hört dann das Weinen eines Kindes, das nicht im Bild war. Das ist die erste Szene des Films und sie macht uns mit der Person, die in seinem Zentrum steht, bekannt.
 Ihr Name ist Rita. Sie ist in Belgien auf der Suche nach ihrem Vater, den sie nicht kennt. Er lebte in Deutschland vor langer Zeit, eine Frau in einem Cafe hilft Rita weiter, dann steht sie vor der Tür des Hauses, in dem ihr Vater lebt mit einer neuen Familie. Der Sohn macht die Tür erst wieder zu, dann lässt er Rita rein, er ist ein Teenager und spielt etwas auf der Gitarre, die er nicht beherrscht. Die beiden sprechen auf Englisch, Belangloses. Später eine Szene am Abendessenstisch, alle sind peinlich berührt, dann lacht Rita hysterisch und draußen auf der Terrasse erzählt der Vater seiner Tochter auf Englisch, dass er einen Teich anlegen will. Sie erzählt ihm, dass ihre Mutter ums Leben gekommen ist, bei einem Autounfall. Rita bleibt erstmal. Dann ist es wieder Tag, sie sitzt neben ihrem Halbbruder auf der Couch und gibt dem Baby die Brust. Das Baby heißt J.T. - für Jermaine Tyrell - und sein Vater ist offenkundig schwarz. Ihr Halbbruder guckt auf Ritas Brust, dann fragt er, ob er auch einmal saugen darf. Sie lässt es zu, er saugt eine ganze Weile, es scheint ihm zu schmecken, dann geht die Tür auf und seine Mutter kommt rein.
Ihr Name ist Rita. Sie ist in Belgien auf der Suche nach ihrem Vater, den sie nicht kennt. Er lebte in Deutschland vor langer Zeit, eine Frau in einem Cafe hilft Rita weiter, dann steht sie vor der Tür des Hauses, in dem ihr Vater lebt mit einer neuen Familie. Der Sohn macht die Tür erst wieder zu, dann lässt er Rita rein, er ist ein Teenager und spielt etwas auf der Gitarre, die er nicht beherrscht. Die beiden sprechen auf Englisch, Belangloses. Später eine Szene am Abendessenstisch, alle sind peinlich berührt, dann lacht Rita hysterisch und draußen auf der Terrasse erzählt der Vater seiner Tochter auf Englisch, dass er einen Teich anlegen will. Sie erzählt ihm, dass ihre Mutter ums Leben gekommen ist, bei einem Autounfall. Rita bleibt erstmal. Dann ist es wieder Tag, sie sitzt neben ihrem Halbbruder auf der Couch und gibt dem Baby die Brust. Das Baby heißt J.T. - für Jermaine Tyrell - und sein Vater ist offenkundig schwarz. Ihr Halbbruder guckt auf Ritas Brust, dann fragt er, ob er auch einmal saugen darf. Sie lässt es zu, er saugt eine ganze Weile, es scheint ihm zu schmecken, dann geht die Tür auf und seine Mutter kommt rein. Ihr Vater, der, wie sich dann zeigt, Polizist ist, wird Rita bald darauf der Polizei übergeben. Sie wird in Deutschland gesucht, das hat sie selbst zugegeben, und sie kommt in den offenen Vollzug. Paul, das Baby, ist dabei. Sie trifft eine Frau, von der dann klar wird, es ist ihre Mutter (Susanne Lothar) und damit die Person, die sie in der ersten Szene in der Telefonzelle angeschrien hat. Und auch die Person, von der sie ihrem Vater gegenüber behauptet hat, sie sei tot. Bei ihrer Mutter leben vier Kinder, von denen klar wird: Es sind Ritas Kinder.
 Man muss das so ausführlich erzählen, denn der Film erzählt, oder vielmehr: zeigt es genauso ausführlich. Man muss sich das alles, Stück für Stück und nach und nach, selber zusammenreimen. "Madonnen" ist kein Film, der freiwillig Informationen rausrückt und das hat er mit seiner Heldin gemein. Sandra Hüller, berühmt geworden mit Hans-Christian Schmids "Requiem", hat "Madonnen" noch davor gedreht. Und wenngleich ihre Leistung hier weniger spektakulär ist, ist sie mindestens genauso gut. Es ist nicht einfach, ihren Charakter zu beschreiben. Mal ist sie schrecklich aggressiv, dann scheint wieder ein Schmunzeln, auch über sich selbst, auf ihren Lippen zu liegen. Mal ist sie verstockt, störrisch, bockig, dann sieht man, wie sie in der Disco den GIs, deren Umgang sie sucht, sehr verführerisch und offensiv entgegentritt. Rita bekommt Geld vom Sozialamt und von Vater von dreien ihrer Kinder; sie mietet eine Wohnung, sie nimmt ihre Kinder wieder zu sich. Ein schwarzer GI, Marc, ist plötzlich in ihrem Leben, in ihrer Wohnung.
Man muss das so ausführlich erzählen, denn der Film erzählt, oder vielmehr: zeigt es genauso ausführlich. Man muss sich das alles, Stück für Stück und nach und nach, selber zusammenreimen. "Madonnen" ist kein Film, der freiwillig Informationen rausrückt und das hat er mit seiner Heldin gemein. Sandra Hüller, berühmt geworden mit Hans-Christian Schmids "Requiem", hat "Madonnen" noch davor gedreht. Und wenngleich ihre Leistung hier weniger spektakulär ist, ist sie mindestens genauso gut. Es ist nicht einfach, ihren Charakter zu beschreiben. Mal ist sie schrecklich aggressiv, dann scheint wieder ein Schmunzeln, auch über sich selbst, auf ihren Lippen zu liegen. Mal ist sie verstockt, störrisch, bockig, dann sieht man, wie sie in der Disco den GIs, deren Umgang sie sucht, sehr verführerisch und offensiv entgegentritt. Rita bekommt Geld vom Sozialamt und von Vater von dreien ihrer Kinder; sie mietet eine Wohnung, sie nimmt ihre Kinder wieder zu sich. Ein schwarzer GI, Marc, ist plötzlich in ihrem Leben, in ihrer Wohnung. Sie nimmt es hin. Wir nehmen es hin. Man muss dem Film gegenüber diese beobachtende, duldende Haltung einnehmen, es bleibt einem nichts anderes übrig, wenn man nicht wahnsinnig werden will. Rita ist, wie sie ist, und das Drehbuch, auch um dramaturgische Rundungen und Schließungen ganz ausdrücklich nicht bemüht, bringt sie nicht auf einen Nenner. Mit einer weniger unberechenbaren, einer weniger undurchsichtigen Darstellerin als Sandra Hüller ginge das alles nicht gut. Rita ist keine Sympathieträgerin und oft genug hält man es kaum aus mit ihr. Trotzdem hört man nicht auf, sich für sie zu interessieren und an ihr und den Dingen Anteil zu nehmen, die meist sie selbst sich zufügt; sie ist seltsam selbstbestimmt, noch, wenn nicht gerade dann, wenn sie nicht weiß, was sie tut.
Ästhetisch setzt "Madonnen" - anders als noch Maria Speths ganz präzise, Tableau für Tableau, durchkomponierter Erstling "In den Tag hinein" - auf ungeschönten Realismus. Es ist nicht der Handkamera-Realismus der Dardenne-Brüder, die hier koproduziert haben, eher ein unruhiges Seinlassen der Bilder, der Versuch, die Ausschnitthaftigkeit des Geschichte und die Unzugänglichkeit der Charaktere in Einstellungen aufzulösen. Oft blicken wir durch Scheiben und Glas hindurch. Nichts wird hier transparent. Aber die Figur, das Milieu, sind von Anfang bis Ende und Szene für Szene einfach präsent.
Ekkehard Knörer
"Madonnen". Regie: Maria Speth. Mit Sandra Hüller, Oliver Gourmet, Susanne Lothar, Luisa Sappelt und anderen. Deutschland 2006, 120 Minuten (Forum)
Fad wie Muckefuck: Steven Soderberghs "The Good German" (Wettbewerb)
 Pfiffe im Saal, das ist selten. Selten so berechtigt. Ein guter Deutscher vielleicht, aber beileibe kein guter Film. Ein romantischer Thriller soll es sein, platziert im Nachkriegsberlin 1945 und gedreht mit der Kameratechnik von damals. Was Soderbergh daraus gemacht hat, ist ein schlechter "Casablanca"-Klon (es gibt eine Verabschiedung am Flughafen Tempelhof!), gedreht mit der sehr heutigen Überzeugung, dass Nazis und Krieg und Berlin immer gut ankommen. Tun sie nicht. Diese Geschichte um den Kriegskorrespondenten Jake, der in Berlin seine deutsche Vorkriegsliebe Lena Brandt wieder trifft, die aber von allen Geheimdiensten gejagt wird, ist so fad wie Muckefuck. Auf der Strecke bleiben in diesem Rennen Lenas Mann und der junge amerikanische Geliebte. Es gibt natürlich noch ein paar Geheimnisse, die im Laufe der fast zwei Stunden enthüllt werden, aber für die interessieren sich nur Russen und Amerikaner, der Zuschauer schnell nicht mehr.
Pfiffe im Saal, das ist selten. Selten so berechtigt. Ein guter Deutscher vielleicht, aber beileibe kein guter Film. Ein romantischer Thriller soll es sein, platziert im Nachkriegsberlin 1945 und gedreht mit der Kameratechnik von damals. Was Soderbergh daraus gemacht hat, ist ein schlechter "Casablanca"-Klon (es gibt eine Verabschiedung am Flughafen Tempelhof!), gedreht mit der sehr heutigen Überzeugung, dass Nazis und Krieg und Berlin immer gut ankommen. Tun sie nicht. Diese Geschichte um den Kriegskorrespondenten Jake, der in Berlin seine deutsche Vorkriegsliebe Lena Brandt wieder trifft, die aber von allen Geheimdiensten gejagt wird, ist so fad wie Muckefuck. Auf der Strecke bleiben in diesem Rennen Lenas Mann und der junge amerikanische Geliebte. Es gibt natürlich noch ein paar Geheimnisse, die im Laufe der fast zwei Stunden enthüllt werden, aber für die interessieren sich nur Russen und Amerikaner, der Zuschauer schnell nicht mehr. Dass Schwarzmarkt, Agenten und Raketenwissenschaftler ihre Reize haben, will niemand bestreiten. Aber was bitte schön bringt dieser uninspirierte Blick in die Vergangenheit, diese Geschichte von der Schwierigkeit, das Richtige im Falschen zu tun, die so schon viel besser erzählt wurde, lange vor Soderbergh, ja sogar vor den Nazis? Der Film ist ganz Pastiche, George Clooney und Tobey Maguire wirken allerdings wie frisch aus dem Ei gepellt, als wären sie gerade aus ihrem Learjet gestiegen, der nonstop vom L.A. International Airport des Jahres 2007 ins Berlin von 1945 geflogen ist. Die einzige Vertreterin des Hauptpersonals, die stimmig aussieht, ist Cate Blanchett, und das deshalb, weil sie offenbar einen Marlene-Dietrich-Lookalike Workshop besucht hat. Ein dumpfes Zitat, all das, da hilft auch die kritikerbesänftigende Maßnahme nicht, den Helden zum Journalisten zu machen.
Dass Schwarzmarkt, Agenten und Raketenwissenschaftler ihre Reize haben, will niemand bestreiten. Aber was bitte schön bringt dieser uninspirierte Blick in die Vergangenheit, diese Geschichte von der Schwierigkeit, das Richtige im Falschen zu tun, die so schon viel besser erzählt wurde, lange vor Soderbergh, ja sogar vor den Nazis? Der Film ist ganz Pastiche, George Clooney und Tobey Maguire wirken allerdings wie frisch aus dem Ei gepellt, als wären sie gerade aus ihrem Learjet gestiegen, der nonstop vom L.A. International Airport des Jahres 2007 ins Berlin von 1945 geflogen ist. Die einzige Vertreterin des Hauptpersonals, die stimmig aussieht, ist Cate Blanchett, und das deshalb, weil sie offenbar einen Marlene-Dietrich-Lookalike Workshop besucht hat. Ein dumpfes Zitat, all das, da hilft auch die kritikerbesänftigende Maßnahme nicht, den Helden zum Journalisten zu machen.Christoph Mayerl
"The Good German": Regie: Steven Soderbergh. Mit George Clooney, Cate Blanchett, Tobey Maguire und anderen. USA 2006, 108 Minuten
Zum Wohlfühlen: Cao Hamburgers "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren" (Wettbewerb)
Es ist das Jahr 1970. Sommerferienzeit. Im blauen Käfer brechen der 12-jährige Mauro (Michel Joelsas) und seine Eltern auf aus dem Kaff Minas Gerais nach Sao Paolo, aber der überstürzte Aufbruch macht unübersehbar deutlich: Um Urlaub geht es hier nicht. Ein schneller Abschied, dann sitzt Mauro vor der Wohnungstür seines Großvaters, der aber kommt nicht. Stattdessen ein alter Mann, der erst mal nur Jiddisch spricht und die Hände über dem Kopf zusammenschlägt, als er erfährt, um wen es sich handelt. Am Tag nämlich der geplanten Übergabe ist der Großvater in seinem Friseursalon gestorben. Denkbar schlechtes Timing.
 Die Eltern weg, der Großvater tot, Mauro allein in der Großstadt, mitten in einer lebendigen jüdischen Gemeinschaft, die den Jungen in die Hände des sehr widerstrebenden Schlomo (Germano Haiut) gibt, der ihn fand. Eines Morgens ist Schlomo zu lang im Bad und muss, als er raus kommt, nicht nur sehen, dass Mauro pinkelnd die Zimmerpflanze begießt, schlimmer noch: der Junge ist gar nicht beschnitten. Den Spitznamen Moischele, kleiner Moses, hat Mauro, das Findelkind, trotzdem sofort weg.
Die Eltern weg, der Großvater tot, Mauro allein in der Großstadt, mitten in einer lebendigen jüdischen Gemeinschaft, die den Jungen in die Hände des sehr widerstrebenden Schlomo (Germano Haiut) gibt, der ihn fand. Eines Morgens ist Schlomo zu lang im Bad und muss, als er raus kommt, nicht nur sehen, dass Mauro pinkelnd die Zimmerpflanze begießt, schlimmer noch: der Junge ist gar nicht beschnitten. Den Spitznamen Moischele, kleiner Moses, hat Mauro, das Findelkind, trotzdem sofort weg.Bis dahin ist "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren", ein sehr geduldig, sehr sorgfältig gearbeiteter Film; die ersten Minuten bestehen aus subtilen Schärfeverlagerungen, rasch, aber gleitend fast geschnittenen Ellipsen. Man spürt die Irritation des Alltags, aber zunächst buchstabieren Regie und Buch nichts aus. Erzählt wird strikt aus Mauros Perspektive, man durchschaut, was er durchschaut und ahnt nur und begreift langsam erst, was er nicht versteht. Und das ist in erster Linie der politische Hintergrund. Brasilien ist eine Militärdiktatur, die Linke ist unterdrückt und Dissidenten müssen um ihr Leben fürchten. So ahnt man bald, dass Mauros Eltern als Kommunisten fliehen mussten, ins Ausland oder in den Untergrund. Sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt wird das Großereignis des Jahres, die Fußball-WM in Mexiko, zu der das brasilianische Dream-Team um Pele als Favorit antritt.
 Leider gerät der Film bei seinem Versuch, diese Mischung aus Fußball-Zeitkolorit, angedeuteter Politik, jüdischem Milieu und der Geschichte einer wunderbaren Freundschaft Mauros mit der gleichaltrigen Hanna ins Verhältnis zu setzen, bald aus der Balance, die ihm zu Beginn noch gelingt. Die Unschuld der Kinderperspektive wirkt umso eher in manipulativer Absicht erborgt, je klarer wird, dass politische Ereignisse hier eher Garnierung einer Geschichte vom Erwachsenwerden sind, als der Hintergrund, der alles durchdringt. Zusehends gerät der Film zur Feier eines unproblematischen patriotischen Multikulturalismus; der Verzicht auf genauere Beschreibung und kritische Analyse ist erschlichen durch den einmal gewählten Fokus. Auch die subtilen Mittel des Beginns werden im Fortgang vergröbert. Immer aufdringlicher wird die Musik, immer deutlicher werden die Unterstreichungen und die Sequenzen kaum getrübter Fröhlichkeit. Über weite Strecken ist "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren" dann ein Wohlfühlfilm über einige fast schon idyllische Wochen zur Hochzeit der brasilianischen Militärdiktatur.
Leider gerät der Film bei seinem Versuch, diese Mischung aus Fußball-Zeitkolorit, angedeuteter Politik, jüdischem Milieu und der Geschichte einer wunderbaren Freundschaft Mauros mit der gleichaltrigen Hanna ins Verhältnis zu setzen, bald aus der Balance, die ihm zu Beginn noch gelingt. Die Unschuld der Kinderperspektive wirkt umso eher in manipulativer Absicht erborgt, je klarer wird, dass politische Ereignisse hier eher Garnierung einer Geschichte vom Erwachsenwerden sind, als der Hintergrund, der alles durchdringt. Zusehends gerät der Film zur Feier eines unproblematischen patriotischen Multikulturalismus; der Verzicht auf genauere Beschreibung und kritische Analyse ist erschlichen durch den einmal gewählten Fokus. Auch die subtilen Mittel des Beginns werden im Fortgang vergröbert. Immer aufdringlicher wird die Musik, immer deutlicher werden die Unterstreichungen und die Sequenzen kaum getrübter Fröhlichkeit. Über weite Strecken ist "Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren" dann ein Wohlfühlfilm über einige fast schon idyllische Wochen zur Hochzeit der brasilianischen Militärdiktatur.Ekkehard Knörer
"Das Jahr, in dem meine Eltern im Urlaub waren". Regie: Cao Hamburger. Mit Michel Joelsas, Germano Haiut, Daniele Piepszyk, Caio Blat und anderen. Brasilien 2006, 104 Minuten (Wettbewerb)
Wie bei Ikea: Bruce McDonalds "The Tracey Fragments" (Panorama)
 Es ist ein ungleiches Match, diese Rezension. Wer über Film schreibt, muss schon immer mit der linearen Beschränkung des Gedruckten gegenüber der Gleichzeitigkeit von Bild und Ton auskommen. Aber was, wenn die Bilder sich wie in "The Tracey Fragments", dem Eröffnungsfilm der Panorama-Reihe vermehren wie die Karnickel, und schließlich ein knappes Dutzend Bildstränge sich gleichzeitig über die Leinwand winden? Aber der Reihe nach. Schön linear. Tracey ist fünfzehn und sehr tief drin in ihrer Pubertät. Ihre Umgebung gibt wenig Halt, der Vater nennt seine Kinder "Unfälle", die Mutter raucht drei Schachteln Zigaretten am Tag und sitzt ansonsten so festgegossen vor dem Fernseher, dass das Aufstehen "einer chirurgischen Operation nahe kommt", wie Tracey kommentiert. Tracey macht sich auf die Suche nach ihrem kleinen Bruder, den sie hypnotisiert hat, damit er bellt wie ein Hund. Das ist die schon recht fantastische Klammer, die ein paar recht aufreibende Tage zusammengefasst, in denen Tracey von zu Hause ausreißt, von ihrem Freund Billy Zero träumt, einem Vorstadtgangster mit einer leeren Dose Fleisch und Bohnen den Hals aufschlitzt, fast vergewaltigt wird und tatsächlich defloriert. Das ist nicht gerade wenig, und Bruce McDonald hat sein Übriges getan, um die Verwirrung, die sich auch zu einem großen Teil in Traceys Kopf abspielt, am Schneidetisch zu multiplizieren und multipliziert zurückzuwerfen.
Es ist ein ungleiches Match, diese Rezension. Wer über Film schreibt, muss schon immer mit der linearen Beschränkung des Gedruckten gegenüber der Gleichzeitigkeit von Bild und Ton auskommen. Aber was, wenn die Bilder sich wie in "The Tracey Fragments", dem Eröffnungsfilm der Panorama-Reihe vermehren wie die Karnickel, und schließlich ein knappes Dutzend Bildstränge sich gleichzeitig über die Leinwand winden? Aber der Reihe nach. Schön linear. Tracey ist fünfzehn und sehr tief drin in ihrer Pubertät. Ihre Umgebung gibt wenig Halt, der Vater nennt seine Kinder "Unfälle", die Mutter raucht drei Schachteln Zigaretten am Tag und sitzt ansonsten so festgegossen vor dem Fernseher, dass das Aufstehen "einer chirurgischen Operation nahe kommt", wie Tracey kommentiert. Tracey macht sich auf die Suche nach ihrem kleinen Bruder, den sie hypnotisiert hat, damit er bellt wie ein Hund. Das ist die schon recht fantastische Klammer, die ein paar recht aufreibende Tage zusammengefasst, in denen Tracey von zu Hause ausreißt, von ihrem Freund Billy Zero träumt, einem Vorstadtgangster mit einer leeren Dose Fleisch und Bohnen den Hals aufschlitzt, fast vergewaltigt wird und tatsächlich defloriert. Das ist nicht gerade wenig, und Bruce McDonald hat sein Übriges getan, um die Verwirrung, die sich auch zu einem großen Teil in Traceys Kopf abspielt, am Schneidetisch zu multiplizieren und multipliziert zurückzuwerfen. McDonald hat seine Technik der Split-Screen hier zum Äußersten getrieben, so dass der Zuschauer sich tatsächlich bis zu zehn unterschiedlichen Szenen auf einmal gegenüber sieht. Man muss sich das als Comicseite vorstellen, nur animiert: also im Extremfall zehn mal 24 Bilder pro Sekunde. Das Ganze wird noch angereichert durch die Palette an Formaten, durch die sich McDonald arbeitet: von der fingierten Nachrichtensendung über das Homevideo bis hin zu Big-Brother-ähnlichen Infrarotaufnahmen vom imaginierten Liebesspiel mit Billy. Alles, was das Kino hergibt - auf einmal.
 Das ist durchaus eine adäquate Form, um in den Kopf einer wilden 15-Jährigen hineinzulinsen. Auch der massenhafte Konsum von Musikvideos verändert das Bewusstsein, wie hier eindrucksvoll bewiesen wird. Und die Zeit ist natürlich relativ. Das sieht dann ungefähr so aus. Als Tracey von zu Hause ausbricht, sieht man sie in einem schmalen Band am linken Rand noch leise die Tür zumachen, während sie im mittleren Teil schon am Zaun entlang rennt. Rechts sind mehrere kleine Quadrate zu sehen, in denen man im Sekundenabstand neue Stills ihres Profils in monochromem Blau sieht. Dazu erklingt eine neue Einspielung von Patti Smith' wilden "Horses", und tatsächlich ist das untere Drittel der Leinwand für ein weißes Pferd reserviert, dass in vollem Galopp auf den Betrachter zustürmt. Ach ja, das Pferd wird jeweils für einige Sekundenbruchteile im Takt des Songs an die Stelle der laufenden Tracey in der Mittelsektion geschnitten.
Das ist durchaus eine adäquate Form, um in den Kopf einer wilden 15-Jährigen hineinzulinsen. Auch der massenhafte Konsum von Musikvideos verändert das Bewusstsein, wie hier eindrucksvoll bewiesen wird. Und die Zeit ist natürlich relativ. Das sieht dann ungefähr so aus. Als Tracey von zu Hause ausbricht, sieht man sie in einem schmalen Band am linken Rand noch leise die Tür zumachen, während sie im mittleren Teil schon am Zaun entlang rennt. Rechts sind mehrere kleine Quadrate zu sehen, in denen man im Sekundenabstand neue Stills ihres Profils in monochromem Blau sieht. Dazu erklingt eine neue Einspielung von Patti Smith' wilden "Horses", und tatsächlich ist das untere Drittel der Leinwand für ein weißes Pferd reserviert, dass in vollem Galopp auf den Betrachter zustürmt. Ach ja, das Pferd wird jeweils für einige Sekundenbruchteile im Takt des Songs an die Stelle der laufenden Tracey in der Mittelsektion geschnitten.Das hört sich recht fragmentarisch an. Ist es auch. Aber in guten Momenten findet Bruce McDonald zu einer Einheit, in der die einzelnen Fenster eine Symbiose eingehen und tatsächlich eine sehr intensive Seherfahrung zulassen. Das liegt auch an der Präsenz von Ellen Page, die als Gravitationsfeld diese Filmzentrifuge vor dem Zerreißen bewahrt. In diesen gelungenen Passagen schwillt der Film über Normalmaß an, und tatsächlich hat man nach diesen reichhaltigen 80 Minuten das Gefühl, schon mindestens zwei Stunden Seharbeit geleistet zu haben. Denn arbeiten muss hier tatsächlich der Zuschauer. Es hat etwas von Ikea, diese Verlagerung eines Teils der Wertschöpfung auf den Kunden. Der Zuschauer setzt seinen Film selbst zusammen. Mehr Freiheit bedeutet das aber nicht, die Führung wirkt sogar enger als in konservativen Ein-Fenster-Filmen. Die Erschöpfung weicht nach den Credits, die zum Glück unfragmentiert daher kommen, einem gewissen Gefühl der Nötigung, und das ist der Hauptvorwurf an McDonald. Indem man damit beschäftigt ist, die einzelnen Fragmente gleichzeitig in sich aufzunehmen, bleibt keine einzige Gehirnzelle frei, das Gesehene mit der eigenen Imagination zu verknüpfen. Eine Tour de force im wahrsten Sinne des Wortes. Und dann wirkt der die Teamarbeit betonende, mit Cowboyhut sehr väterlich wirkende McDonald doch plötzlich wie ein Autokrat. Trotz allem: Hier treibt einer die Bildsprache voran. Ob zum Wohle des Zuschauers, davon sollte der sich unbedingt selbst ein Bild machen. Oder zehn.
Christoph Mayerl
"The Tracey Fragments": Regie: Bruce McDonald. Mit Ellen Page, Max McCabe-Lokos, Ari Cohen, Slim Twig und anderen. Kanada 2007, 80 Minuten (Panorama).
Kein Laubfrosch: Olivier Dahans "La vie en rose" (Wettbewerb)
 Eröffnungsfilme sind keine Laubfrösche, und sagen deshalb wenig darüber aus, was die Aussichten für das Festival sind. In diesem Fall hätte es allerdings nicht viel ausgemacht, denn so würden uns in den nächsten Tagen angenehme Respektlosigkeit vor großen Namen, ernsthafte Schauspielerei und ein Schuss Selbstironie erwarten. Edith Piaf ist ein Nationalheiligtum Frankreichs, und Olivier Dahan ist es anzurechnen, dass er es erhält, indem er mit einem großen Hammer die Stuck- und Zierratschichten abklopft, die sich abgelagert haben. Edith Piaf war immer, wie wir erfahren, das verschorfte Kind von der Straße, auch als schwerkranke Diva, die wie ein unglückliches und hilfloses Gör seine Umgebung tyrannisert. Um diese beiden Pole kreist der Film, für ein Leben dazwischen, fürs Erwachsenwerden ist keine Zeit im Film. Dahan schildert die Piaf als Straßensängerin, die vor ihrer abwesenden Mutter und dem ständig besoffenen Vater davon läuft. Es sind Vaterfiguren, die sich ihrer annehmen und einen Star aus ihr machen. Edith Piaf muss angeleitet werden, muss umsorgt werden, am Schluss von einem ganzen Hofstaat an Pflegern-Assistenten-Managern. Sie scheint sich nie wohlzufühlen in der Welt des Glamours, in die sie sich langsam hineinsingt, und so richtig glücklich sieht man sie nur, wenn sie in einer Brasserie spätabends für die Trinker auftritt und wenn sie sich in Marcel Cerdan verliebt, den Boxer, der Sandwichs mit rohem Fleisch dem französischen Braten in Edelrestaurants vorzieht.
Eröffnungsfilme sind keine Laubfrösche, und sagen deshalb wenig darüber aus, was die Aussichten für das Festival sind. In diesem Fall hätte es allerdings nicht viel ausgemacht, denn so würden uns in den nächsten Tagen angenehme Respektlosigkeit vor großen Namen, ernsthafte Schauspielerei und ein Schuss Selbstironie erwarten. Edith Piaf ist ein Nationalheiligtum Frankreichs, und Olivier Dahan ist es anzurechnen, dass er es erhält, indem er mit einem großen Hammer die Stuck- und Zierratschichten abklopft, die sich abgelagert haben. Edith Piaf war immer, wie wir erfahren, das verschorfte Kind von der Straße, auch als schwerkranke Diva, die wie ein unglückliches und hilfloses Gör seine Umgebung tyrannisert. Um diese beiden Pole kreist der Film, für ein Leben dazwischen, fürs Erwachsenwerden ist keine Zeit im Film. Dahan schildert die Piaf als Straßensängerin, die vor ihrer abwesenden Mutter und dem ständig besoffenen Vater davon läuft. Es sind Vaterfiguren, die sich ihrer annehmen und einen Star aus ihr machen. Edith Piaf muss angeleitet werden, muss umsorgt werden, am Schluss von einem ganzen Hofstaat an Pflegern-Assistenten-Managern. Sie scheint sich nie wohlzufühlen in der Welt des Glamours, in die sie sich langsam hineinsingt, und so richtig glücklich sieht man sie nur, wenn sie in einer Brasserie spätabends für die Trinker auftritt und wenn sie sich in Marcel Cerdan verliebt, den Boxer, der Sandwichs mit rohem Fleisch dem französischen Braten in Edelrestaurants vorzieht. Dahan musste etwas mit den berückenden Liedern der Piaf und vor allem ihrer Stimme anfangen, er musste Bilder finden für etwas, das man am liebsten mit geschlossenen Augen genießen will. Er musste dem allgemeinen Konsens entgehen, dass die Piaf ja doch sehr schön singt. Dahans Ausweg ist die Konfrontation. Wir sehen Krankheit, Leid, körperliche Schmerzen, Armut, wir sehen verschmiertes Makeup, zitternde Hände, verschütteten Champagner, blutige Morphium-Spritzen. Die Piaf ist nicht schön, sie kränkelt von Anfang an, selbst ihre Stimme klingt im Alltag nur aufdringlich und nicht aufreizend. Und dann sind da die Lieder, etwa dreißig sollen es sein, die mal nebenebei eingestreut, mal als großer Auftritt inszeniert werden. Von dieser Spannung zwischen Bild und Ton lebt der Film, und er lebt natürlich von Marion Cotillard, die mehr Piaf zu sein scheint als diese es selbst je war. Cotillard erschafft ihre Piaf als Schelm, die immer fremd ist in ihrer Umgebung und sich lustig macht über die Hofschranzen und Fans und deren Bewunderung sie doch so dringend braucht wie die tägliche Spritze. Sie zerstört jeden Anflug von Feierlichkeit mit einem tragischen Witz, unterbricht die steife Stimmung der Upper Class mit einem unerhört dreckigen Lachen und legt sich quer, wo sie kann. Sie kann es nicht oft. Sie muss singen, und sie muss auftreten. Das Gesicht der Cotillard sagt das alles ohne Worte: Mit entspannten Zügen ist es das einer klassischen Schönheit. Bewegt sie sich, ist man zurück in der Brasserie in Paris, bei den Verlierern, aus der sie ihr Mentor zerrt, um sie für die große Karriere zu trainieren. Immer, wenn sie sich bewegt, macht die Piaf einen Fehler und eckt an. Sie hört nie auf, es trotzdem zu versuchen, aber ihre Versuche werden seltener. Sie mag das Leben nicht, das sie hat, und weiß doch nicht, was sie anderes tun soll als singen.
Dahan musste etwas mit den berückenden Liedern der Piaf und vor allem ihrer Stimme anfangen, er musste Bilder finden für etwas, das man am liebsten mit geschlossenen Augen genießen will. Er musste dem allgemeinen Konsens entgehen, dass die Piaf ja doch sehr schön singt. Dahans Ausweg ist die Konfrontation. Wir sehen Krankheit, Leid, körperliche Schmerzen, Armut, wir sehen verschmiertes Makeup, zitternde Hände, verschütteten Champagner, blutige Morphium-Spritzen. Die Piaf ist nicht schön, sie kränkelt von Anfang an, selbst ihre Stimme klingt im Alltag nur aufdringlich und nicht aufreizend. Und dann sind da die Lieder, etwa dreißig sollen es sein, die mal nebenebei eingestreut, mal als großer Auftritt inszeniert werden. Von dieser Spannung zwischen Bild und Ton lebt der Film, und er lebt natürlich von Marion Cotillard, die mehr Piaf zu sein scheint als diese es selbst je war. Cotillard erschafft ihre Piaf als Schelm, die immer fremd ist in ihrer Umgebung und sich lustig macht über die Hofschranzen und Fans und deren Bewunderung sie doch so dringend braucht wie die tägliche Spritze. Sie zerstört jeden Anflug von Feierlichkeit mit einem tragischen Witz, unterbricht die steife Stimmung der Upper Class mit einem unerhört dreckigen Lachen und legt sich quer, wo sie kann. Sie kann es nicht oft. Sie muss singen, und sie muss auftreten. Das Gesicht der Cotillard sagt das alles ohne Worte: Mit entspannten Zügen ist es das einer klassischen Schönheit. Bewegt sie sich, ist man zurück in der Brasserie in Paris, bei den Verlierern, aus der sie ihr Mentor zerrt, um sie für die große Karriere zu trainieren. Immer, wenn sie sich bewegt, macht die Piaf einen Fehler und eckt an. Sie hört nie auf, es trotzdem zu versuchen, aber ihre Versuche werden seltener. Sie mag das Leben nicht, das sie hat, und weiß doch nicht, was sie anderes tun soll als singen. Mitleid hat man durchaus mit ihr, aber es trieft nicht. Und zwar deshalb nicht, weil die Edith zur Piaf immer einen gehörigen Abstand einzuhalten versucht. Natürlich kann sie bald nicht mehr entkommen, und nachts auf ihrem Sterbebett, wo ihre blauen Augen nur noch schwarze Pfützen sind, mischt sich endlich alles, was vorher getrennt war. Bild und Ton, Edith und Piaf, Misere und Göttlichkeit. Ein berührender und nicht überzuckerter Film, den man unbedingt auf großer Leinwand, in Dolby Surround, und wenn es geht, mit einem Glas sehr trockenem Rotwein genießen sollte.
Mitleid hat man durchaus mit ihr, aber es trieft nicht. Und zwar deshalb nicht, weil die Edith zur Piaf immer einen gehörigen Abstand einzuhalten versucht. Natürlich kann sie bald nicht mehr entkommen, und nachts auf ihrem Sterbebett, wo ihre blauen Augen nur noch schwarze Pfützen sind, mischt sich endlich alles, was vorher getrennt war. Bild und Ton, Edith und Piaf, Misere und Göttlichkeit. Ein berührender und nicht überzuckerter Film, den man unbedingt auf großer Leinwand, in Dolby Surround, und wenn es geht, mit einem Glas sehr trockenem Rotwein genießen sollte.Christoph Mayerl
"La vie en rose": Regie: Olivier Dahan. Mit Marion Cotillard, Sylvie Testud, Gerard Depardieu und anderen. Frankreich, Großbritannien, Tschechische Republik, 2006, 140 min (Wettbewerb)