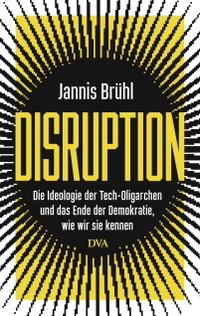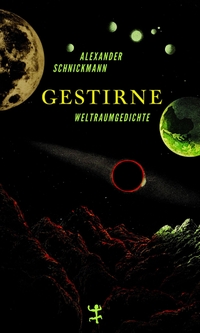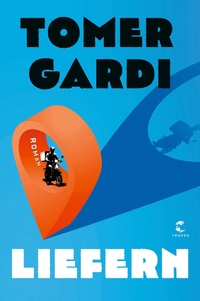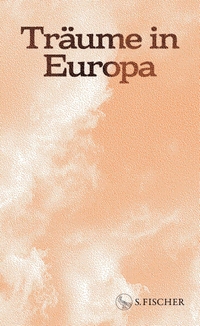9punkt - Die Debattenrundschau
Schlachtreif wie ein fettes Lamm
Kommentierter Rundblick durch die Feuilletondebatten. Wochentags um 9 Uhr, sonnabends um 10 Uhr.
22.05.2024. Auf Zeit online versucht sich der Philosoph Ingo Elbe den "Erlösungsantizionismus" vieler Linker zu erklären. Nur wenn die Diktaturen nicht überleben, hat die Menschheit eine Zukunft, ruft Wolfgang Bauer ebenfalls auf Zeit online. Ebendort blickt Timothy Garton Ash zurück auf 75 Jahre Deutsche Bundesrepublik und fragt: "Großes Deutschland - was nun?" In der SZ nimmt der Historiker Volker Weiß die "neue Rechte" unter die Lupe und stellt wenig überraschend fest, dass sie sich kaum von der alten unterscheidet. Im Tagesspiegel verteidigt der Nahost-Experte Rashid Khalidi die antiisraelischen Studentenproteste an der Columbia-University. Und Aleida Assmann verteidigt in der FAZ Claudia Roths Konzept für eine erweiterte Erinnerungskultur.
Efeu - Die Kulturrundschau
vom
22.05.2024
finden Sie hier
Europa
Im Zeit online-Interview mit Peter Neumann denkt der Philosoph Ingo Elbe über den Ursprung der antiisraelischen Haltung an Universitäten nach. Er stellt im linken Milieu eine "radikale Verzerrung der Wirklichkeit" fest, die auf die postkoloniale Theorie zurück geht - am Ende bleibt "ein bösartiges Israel" zurück. Die Verblendung, so Elbe, reicht in ihrer radikalen Form bis zu einem "Erlösungsantizionismus", der auch bei den "prominentesten Vertretern der postkolonialen Theorie" vorhanden sei: "Ramón Grosfoguel von der Berkeley University schrieb in einem seiner letzten Texte, dass die Zukunft der Menschheit gerade in Palästina entschieden werde. Die Kräfte des Lebens, die er mit der Hamas und den Huthis identifiziert, gegen die Kräfte des Todes - das ist die Ideologie. Und wenn Israel siege, dann werde das Leben auf diesem Planeten untergehen. Das sind wahnhafte Ideen, die an apokalyptische Vorstellungen erinnern. Dieser Erlösungsantizionismus, den man bisher von Islamisten wie dem iranischen Ex-Präsidenten Mahmud Ahmadineschād kannte, ist jetzt in die Universitäten eingedrungen. Was macht man da als Student in Berkeley, wenn ein Professor sagt, in Gaza wird der Endkampf der Menschheit entschieden?"
Gesellschaft
Im Tagesspiegel-Interview mit Tessa Szyszkowitz äußert sich der Nahost-Experte Rashid Khalidi zu den Studentenprotesten an der Columbia-University. Er sieht durch die Einsätze der Polizei die Redefreiheit bedroht, den Protest sieht er als legitim an - ein Problem mit Antisemitismus kann er nicht erkennen: "Die Studierenden haben sich der Gewaltlosigkeit verschrieben, sie sind rücksichtsvoll. Sie bestehen nur auf ihr verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung, um gegen das Einspruch zu erheben, was sie als Völkermord in Gaza ansehen. Wir hatten auch Studenten, die israelische Flaggen schwenkten. Es gab Leute, die die Demonstranten Hamas-Terroristen nannten. Das ist ihr Recht, so etwas zu behaupten. Aber den Studierenden das Recht abzusprechen, protestieren zu dürfen, halte ich für falsch."
Pascal Bruckner erinnert derweil in der NZZ an die erschreckenden Szenen, die sich kürzlich vor der Universität abspielten: Anhänger der radikalen "Students for Justice in Palestine" sangen vor dem Tor der Columbia-University Hymnen auf die Kassam-Brigaden. Die Palästinenser, schreibt Bruckner, sind für Teile der Linken "zu den neuen Verdammten der Erde geworden" und zwar "weil sie nichts anderes als eine Idee sind, eine Abstraktion, auf die man sein Ideal der Gerechtigkeit projizieren kann. Und das unabhängig vom historischen oder geografischen Kontext." In dieser "neuen Mythologie", so Bruckner, "ist der Palästinenser der letzte gute Wilde, der selbst dann unschuldig ist, wenn er seinen Opfern die Kehle durchschneidet. Sein Terrorismus wird mit seiner angeblichen Verzweiflung entschuldigt. Er ist die große christliche Ikone, die von der extremen Linken getragen wird. Die Seligsprechung dauert seit siebzig Jahren an. Man erweist jedoch der Sache der Palästinenser einen schlechten Dienst, wenn man ihren Kampf um Selbstbestimmung zum Jihadismus erklärt, der für die Mehrheit der westlichen und arabischen Welt ein Schreckgespenst darstellt."
Pascal Bruckner erinnert derweil in der NZZ an die erschreckenden Szenen, die sich kürzlich vor der Universität abspielten: Anhänger der radikalen "Students for Justice in Palestine" sangen vor dem Tor der Columbia-University Hymnen auf die Kassam-Brigaden. Die Palästinenser, schreibt Bruckner, sind für Teile der Linken "zu den neuen Verdammten der Erde geworden" und zwar "weil sie nichts anderes als eine Idee sind, eine Abstraktion, auf die man sein Ideal der Gerechtigkeit projizieren kann. Und das unabhängig vom historischen oder geografischen Kontext." In dieser "neuen Mythologie", so Bruckner, "ist der Palästinenser der letzte gute Wilde, der selbst dann unschuldig ist, wenn er seinen Opfern die Kehle durchschneidet. Sein Terrorismus wird mit seiner angeblichen Verzweiflung entschuldigt. Er ist die große christliche Ikone, die von der extremen Linken getragen wird. Die Seligsprechung dauert seit siebzig Jahren an. Man erweist jedoch der Sache der Palästinenser einen schlechten Dienst, wenn man ihren Kampf um Selbstbestimmung zum Jihadismus erklärt, der für die Mehrheit der westlichen und arabischen Welt ein Schreckgespenst darstellt."
Politik
"Der Schlächter von Teheran verlässt uns als Steak Tartare." Auch Charlie Hebdo trauert um den iranischen Präsidenten.
"Eine Ungeheuerlichkeit" und "völlig inakzeptabel" nennt Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, in der Jüdischen Allgemeinen den Antrag auf Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant: "Es ist ein politischer Akt zur Isolierung Israels und kein juristisch begründbares Vorgehen. ... In Artikel 17 des Römischen Statutes des Internationalen Strafgerichtshof ist die Strafverfolgung gesperrt, wenn die nationalen Gerichte funktional sind. Der Nachweis, dass die israelische Justiz nicht willens oder nicht in der Lage ist, die Ermittlungen oder die Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen, kann nicht erbracht werden. In der Vergangenheit hat die israelische Justiz sowohl Militärs als auch hochrangige Politiker verurteilt. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass dies bei möglichen Rechtsverletzungen im aktuellen Gaza-Krieg anders sein könnte." Ähnlich sieht es Nikolas Busse in der FAZ.
Zur "Befriedung des Nahostkonflikts" haben die Anträge auf Haftbefehle des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs auf jeden Fall nicht beigetragen, das ist für Stefan Kornelius in der SZ klar. Erstens "zeugt es von realpolitischer Blindheit, ausgerechnet in diesem Augenblick den Krieg und die Hauptakteure mithilfe einer Anklage in die Schranken weisen zu wollen." Völlig unverständlich ist für den Kritiker "warum Khan die gewählten Vertreter eines Rechtsstaates mit seinem Haftbefehl auf dieselbe Stufe stellt wie die Anführer einer islamistisch-terroristischen Organisation. Die Verfolgungsbehörde hat sich rechtspositivistische Scheuklappen angelegt, wenn sie allein völkerrechtliche Tatbestände nebeneinanderlegt. Dabei blendet sie die gewaltige politische Folgewirkung dieser Gleichsetzung aus, die es schier unmöglich machen wird, eine befriedende Idee für diesen Konflikt zu entwickeln."
Der Historiker Timothy Garton Ash blickt in einem großen Essay auf Zeit online zurück auf 75 Jahre Deutsche Bundesrepublik und fragt: ""Großes Deutschland - was nun?" In welche Richtung soll Deutschland gehen - angesichts der Bedrohung durch Russland, dem Krieg in Gaza, der Abhängigkeit von China und der Schwächung der europäischen Demokratien durch rechte Populisten. Sicher ist für Ash: Deutschland ist "die Zentralmacht Europas" und muss dieser Aufgabe auch gerecht werden: "Solange noch kein bündiger Begriff geprägt ist, würde ich die Strategie, die Europa von Deutschland verlangt, als eine Gesamteuropapolitik beschreiben - eine Politik, die zusammenführt, was in der Vergangenheit die im Wesentlichen separate Europapolitik, also EU-Politik, und die Ostpolitik gewesen sind. Kann Deutschland die Gewichte in der Europäischen Union zugunsten eines echten strategischen Engagements für die Ukraine, Moldawien, den westlichen Balkan und Georgien verschieben? Kann es zu dem mutigen, innovativen Denken beitragen, das zur Reform der EU notwendig ist, um sie für eine neue große Erweiterung und zur Auseinandersetzung mit einer gefährlichen Welt vorzubereiten?"
In der SZ nimmt der Historiker Volker Weiß die "neue Rechte" unter die Lupe und stellt wenig überrascht fest: die "neue" unterscheidet sich nicht besonders von der "alten Rechten", vor allem, was ihre Vorstellung von "Männlichkeit" angeht. Er berichtet von einem Schlüsselerlebnis des Verlegers Götz Kubitschek, der eine Zufallsbekanntschaft in eine Moschee begleitete und das Erlebnis auf seinem Blog schilderte: "Es gebe, schreibt er, 'junge Männer, die vor allem unter Männern sein wollen, in starken Gruppen, im Einsatz. Wenn dagegen kein Kraut wächst, verlieren wir sie'. In diesem Erfahrungsprotokoll legt Kubitschek die Beweggründe für seine Arbeit offener dar als in vielen programmatischen Texten. Es ist die Angst, vor einem Gegner, dessen Männlichkeit nicht nur die Kultur, sondern den ethnischen Kern der Deutschen bedrohe. 'Nur Barbaren können sich verteidigen', heißt ein Titel seines Verlags. Das ist eine Aufforderung, sich dem Gegner anzugleichen. Im Islam, das hat er nun gesehen, kann der Mann unter Männern bleiben. Dort kennt man noch Ordnung, Befehl und zur Not auch Aufopferung."
Nur wenn die Diktaturen nicht überleben, hat die Menschheit eine Zukunft , ruft auf Zeit online der Kriegsberichterstatter Wolfgang Bauer. Wir müssten uns darüber klar werden: die Demokratien sind schwach, denn die mächtigen Diktaturen der Welt, vor allem China und Russland "haben die besseren Erfolgsaussichten. Sie haben einen langfristigen Plan. Sie bringen den Wahnsinn auf, während die Demokratien nicht den Willen haben", warnt Bauer - Europa "ist schlachtreif wie ein fettes Lamm". Dabei haben nur demokratische Systeme, die Möglichkeit, Krisen wie den Klimawandel zu bewältigen: "Die Autokratie ist dieser Aufgabe nicht gewachsen. Das liegt nicht daran, dass an ihrer Spitze bedingungslos böse Menschen sitzen. Das Modell Putin & Xi versagt bei der Steuerung von komplexen Technologien. Zu klein ist in diesen Systemen die Zahl derer, die Entscheidungen treffen. Die Autokratie schaltet die Selbstregulierungskraft unserer Gesellschaft aus, die dafür angstfreie Diskurse braucht, den Wettbewerb der Ideen, das kollektive Abwägen von Gewinnen und Verlusten. In der Autokratie werden schlechte Nachrichten nur schwerfällig nach oben durchgegeben."
Auch Perlentaucher-Kolumnist Richard Herzinger warnt: "China agiert dabei vorerst noch im Hintergrund. Schon bald aber könnte es mit seiner zunehmend fadenscheinigen Camouflage als friedliebender "Vermittler" endgültig vorbei sein."
Par #Udine
- Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 21, 2024
4/5 pic.twitter.com/9daHe3Ua78
"Eine Ungeheuerlichkeit" und "völlig inakzeptabel" nennt Volker Beck, Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, in der Jüdischen Allgemeinen den Antrag auf Haftbefehl gegen Benjamin Netanjahu und Yoav Gallant: "Es ist ein politischer Akt zur Isolierung Israels und kein juristisch begründbares Vorgehen. ... In Artikel 17 des Römischen Statutes des Internationalen Strafgerichtshof ist die Strafverfolgung gesperrt, wenn die nationalen Gerichte funktional sind. Der Nachweis, dass die israelische Justiz nicht willens oder nicht in der Lage ist, die Ermittlungen oder die Strafverfolgung ernsthaft durchzuführen, kann nicht erbracht werden. In der Vergangenheit hat die israelische Justiz sowohl Militärs als auch hochrangige Politiker verurteilt. Es gibt keinen Anhaltspunkt, dass dies bei möglichen Rechtsverletzungen im aktuellen Gaza-Krieg anders sein könnte." Ähnlich sieht es Nikolas Busse in der FAZ.
Zur "Befriedung des Nahostkonflikts" haben die Anträge auf Haftbefehle des Chefanklägers des Internationalen Strafgerichtshofs auf jeden Fall nicht beigetragen, das ist für Stefan Kornelius in der SZ klar. Erstens "zeugt es von realpolitischer Blindheit, ausgerechnet in diesem Augenblick den Krieg und die Hauptakteure mithilfe einer Anklage in die Schranken weisen zu wollen." Völlig unverständlich ist für den Kritiker "warum Khan die gewählten Vertreter eines Rechtsstaates mit seinem Haftbefehl auf dieselbe Stufe stellt wie die Anführer einer islamistisch-terroristischen Organisation. Die Verfolgungsbehörde hat sich rechtspositivistische Scheuklappen angelegt, wenn sie allein völkerrechtliche Tatbestände nebeneinanderlegt. Dabei blendet sie die gewaltige politische Folgewirkung dieser Gleichsetzung aus, die es schier unmöglich machen wird, eine befriedende Idee für diesen Konflikt zu entwickeln."
Der Historiker Timothy Garton Ash blickt in einem großen Essay auf Zeit online zurück auf 75 Jahre Deutsche Bundesrepublik und fragt: ""Großes Deutschland - was nun?" In welche Richtung soll Deutschland gehen - angesichts der Bedrohung durch Russland, dem Krieg in Gaza, der Abhängigkeit von China und der Schwächung der europäischen Demokratien durch rechte Populisten. Sicher ist für Ash: Deutschland ist "die Zentralmacht Europas" und muss dieser Aufgabe auch gerecht werden: "Solange noch kein bündiger Begriff geprägt ist, würde ich die Strategie, die Europa von Deutschland verlangt, als eine Gesamteuropapolitik beschreiben - eine Politik, die zusammenführt, was in der Vergangenheit die im Wesentlichen separate Europapolitik, also EU-Politik, und die Ostpolitik gewesen sind. Kann Deutschland die Gewichte in der Europäischen Union zugunsten eines echten strategischen Engagements für die Ukraine, Moldawien, den westlichen Balkan und Georgien verschieben? Kann es zu dem mutigen, innovativen Denken beitragen, das zur Reform der EU notwendig ist, um sie für eine neue große Erweiterung und zur Auseinandersetzung mit einer gefährlichen Welt vorzubereiten?"
In der SZ nimmt der Historiker Volker Weiß die "neue Rechte" unter die Lupe und stellt wenig überrascht fest: die "neue" unterscheidet sich nicht besonders von der "alten Rechten", vor allem, was ihre Vorstellung von "Männlichkeit" angeht. Er berichtet von einem Schlüsselerlebnis des Verlegers Götz Kubitschek, der eine Zufallsbekanntschaft in eine Moschee begleitete und das Erlebnis auf seinem Blog schilderte: "Es gebe, schreibt er, 'junge Männer, die vor allem unter Männern sein wollen, in starken Gruppen, im Einsatz. Wenn dagegen kein Kraut wächst, verlieren wir sie'. In diesem Erfahrungsprotokoll legt Kubitschek die Beweggründe für seine Arbeit offener dar als in vielen programmatischen Texten. Es ist die Angst, vor einem Gegner, dessen Männlichkeit nicht nur die Kultur, sondern den ethnischen Kern der Deutschen bedrohe. 'Nur Barbaren können sich verteidigen', heißt ein Titel seines Verlags. Das ist eine Aufforderung, sich dem Gegner anzugleichen. Im Islam, das hat er nun gesehen, kann der Mann unter Männern bleiben. Dort kennt man noch Ordnung, Befehl und zur Not auch Aufopferung."
Nur wenn die Diktaturen nicht überleben, hat die Menschheit eine Zukunft , ruft auf Zeit online der Kriegsberichterstatter Wolfgang Bauer. Wir müssten uns darüber klar werden: die Demokratien sind schwach, denn die mächtigen Diktaturen der Welt, vor allem China und Russland "haben die besseren Erfolgsaussichten. Sie haben einen langfristigen Plan. Sie bringen den Wahnsinn auf, während die Demokratien nicht den Willen haben", warnt Bauer - Europa "ist schlachtreif wie ein fettes Lamm". Dabei haben nur demokratische Systeme, die Möglichkeit, Krisen wie den Klimawandel zu bewältigen: "Die Autokratie ist dieser Aufgabe nicht gewachsen. Das liegt nicht daran, dass an ihrer Spitze bedingungslos böse Menschen sitzen. Das Modell Putin & Xi versagt bei der Steuerung von komplexen Technologien. Zu klein ist in diesen Systemen die Zahl derer, die Entscheidungen treffen. Die Autokratie schaltet die Selbstregulierungskraft unserer Gesellschaft aus, die dafür angstfreie Diskurse braucht, den Wettbewerb der Ideen, das kollektive Abwägen von Gewinnen und Verlusten. In der Autokratie werden schlechte Nachrichten nur schwerfällig nach oben durchgegeben."
Auch Perlentaucher-Kolumnist Richard Herzinger warnt: "China agiert dabei vorerst noch im Hintergrund. Schon bald aber könnte es mit seiner zunehmend fadenscheinigen Camouflage als friedliebender "Vermittler" endgültig vorbei sein."
Wissenschaft
In der FAZ zeigt Claus Leggewie wenig Sympathie für den BDS, dessen Forderungen ihn stark an das "Kauft nicht bei Juden"-Schild der Nazis erinnern. Besonders entsetzt ihn aber die Forderung, auch israelische Universitäten und Wissenschaftler zu boykottieren: Das sei "entweder eine Riesendummheit oder ein kühl kalkulierter Angriff auf die Wissenschaftsfreiheit. Und der beginnt in vielen westlichen Universitäten schon bei einem Bachelor-Kurs, an dem jüdische Studenten und deren Unterstützer (oder Beschützer) teilzunehmen physisch gehindert oder abgeschreckt werden. Dass dergleichen von palästinensischen Aktivisten kommt, die nicht allein Israels Wissenschaftskommunikation unterbinden wollen, sondern das Existenzrecht des Staates bestreiten, ist so bedauerlich wie erwartbar. Dass es von westlichen Wissenschaftlern in einer völlig falsch verstandenen Solidarität mit dem ominösen Global South gefordert wird, ist ein Skandal, der scharfen Widerspruch verdient."
Antisemitismus kommt vor allem von rechts, beharren in der FAZ Stefanie Schüler-Springorum und Uffa Jensen, die das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin leiten und "stolz darauf" sind dazu beizutragen, die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus zu verbreiten, die Israelkritik nur unter sehr engen Annahmen als antisemitisch verstanden wissen will. Wie genau diese Annahmen zu definieren sind, bleibt allerdings auch in diesem Text vage: "Es ist evident, dass sich Israelfeindschaft leicht mit antisemitischen Bestandteilen und Motiven aufladen lässt - wie es allenthalben auch geschieht. Dieses Mischungsverhältnis in konkreten Fällen abzuwägen ist eine gegenwärtige Aufgabe der Antisemitismusforschung, wie sie auch von der JDA gefordert wird: Wer hat eine Äußerung mit welchen Motiven und Stereotypen getätigt? Was ist mit ihr intendiert? Was ist ihr Kontext?"
Antisemitismus kommt vor allem von rechts, beharren in der FAZ Stefanie Schüler-Springorum und Uffa Jensen, die das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin leiten und "stolz darauf" sind dazu beizutragen, die Jerusalemer Erklärung zum Antisemitismus zu verbreiten, die Israelkritik nur unter sehr engen Annahmen als antisemitisch verstanden wissen will. Wie genau diese Annahmen zu definieren sind, bleibt allerdings auch in diesem Text vage: "Es ist evident, dass sich Israelfeindschaft leicht mit antisemitischen Bestandteilen und Motiven aufladen lässt - wie es allenthalben auch geschieht. Dieses Mischungsverhältnis in konkreten Fällen abzuwägen ist eine gegenwärtige Aufgabe der Antisemitismusforschung, wie sie auch von der JDA gefordert wird: Wer hat eine Äußerung mit welchen Motiven und Stereotypen getätigt? Was ist mit ihr intendiert? Was ist ihr Kontext?"
Kulturpolitik
In der FAZ kann Aleida Assmann nicht verstehen, warum das neue Konzept zur deutschen Erinnerungskultur, das Claudia Roth kürzlich vorlegte, von Andreas Kilb in der FAZ so heftig kritisiert wurde (unser Resümee). Fürchtet hier jemand eine Opferkonkurrenz, fragt sie sich. Überhaupt scheine "kaum jemand an einer entsprechenden Entschärfung des Dilemmas interessiert zu sein. Im Gegenteil macht sich bei diesem Thema der Veränderungswiderstand am energischsten bemerkbar. Da die Faulenbach-Formel scheinbar ausgedient hat, kommt nun eine andere Prämisse zum Zuge: Der Holocaust ist historisch einzigartig, deshalb sind Vergleiche mit ihm unzulässig. Jeder Vergleich, wird suggeriert, beinhalte eine Gleichsetzung und negiere damit die Einzigartigkeit des Holocausts. In dieser Diskussion steht daher jeder Vergleich unter Gleichsetzungsverdacht."
Ideen
Anders als in den USA ist in Deutschland die Verfassung nicht umstritten. Dafür gibt es einen Grund, so die These des Staatsrechtlers Florian Meinel in der FAZ: seine "Irrelevanz für die Praxis der Verfassungsauslegung und Verfassungsanwendung, jedenfalls für deren öffentlich sichtbare Form". Ausschlaggebend dafür war das Bundesverfassungsgericht, so Meinel: "Die vom Bundesverfassungsgericht gegen große Widerstände durchgesetzte Auslegung des Grundgesetzes nahm ... sehr früh vorweg, was international erst in den Siebzigerjahren, im Zeitalter des Rechtsphilosophen John Rawls und des Abtreibungsurteils des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten im Fall Roe v. Wade, Fahrt aufnahm: die Umkodierung politischer Konflikte in Konflikte um 'Rechte'. Dabei wurde das deutsche Modell der Verhältnismäßigkeit vielfach zum Vorbild anderer Verfassungsgerichte, Grundrechtshermeneutik zu einer Soft Power der Bundesrepublik."
Digitalisierung
Die EU hat jetzt Regeln für künstliche Intelligenz beschlossen. Was genau das für die Verbraucher bedeutet, erklärt im taz-Interview der Experte Miika Blinn: "Die ersten Vorschriften treten schon in einem halben Jahr in Kraft. Damit werden KI-Systeme mit nicht tolerierbarem Risiko verboten, zum Beispiel das Anlegen von Gesichtsdatenbanken mit Bildern aus dem Internet. Richtig etwas merken wird man spätestens in zwei Jahren. Dann müssen zum Beispiel mit KI erzeugte Bilder, Videos oder Texte gekennzeichnet werden. Und: Firmen müssen dann auch kennzeichnen, wenn sie zum Beispiel in einem Service-Chat oder bei einer Telefon-Hotline KI einsetzen. Das kann zum Beispiel mit einem Siegel geschehen, mit einem Button, einem Wasserzeichen oder, bei der Hotline, einer kurzen Erklärung am Anfang des Anrufs." In Haftungsfragen gibt es eine Lücke, gibt Blinn zu, aber insgesamt bringe der AI Act "schon deutliche Verbesserungen für Verbraucher. Zum Beispiel ist vorgeschrieben, dass Verbraucher sich beschweren können müssen. Also eine Behörde, an die sich Betroffene wenden können, wenn sie zum Beispiel glauben, dass ein KI-System gegen die Regeln verstößt."
3 Kommentare