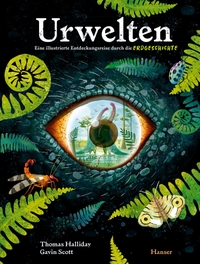Vom Nachttisch geräumt
Die Bücherkolumne. Von Arno Widmann
26.01.2005. Widmann traut sich nach der Lektüre von Elsa Ferrantes "Lästige Liebe" kaum mehr aus dem Haus, feiert die Lust am Deklamieren politisch total unkorrekter Balladen, weint um die Little Rock Nine in Richard Powers "Klang der Zeit" und bewundert die Schönheitslinien der "Lusiaden". Angst
 Sie hat das Buch ihrer Mutter gewidmet. Das Buch, das mit dem Satz beginnt "Meine Mutter ertrank in der Nacht zum 23. Mai im Meer". Das Buch, in dem eine Tochter davon erzählt, wie sie sich auf den Weg macht, dahinter zu kommen, warum und wie ihre Mutter starb. Elena Ferrante, eine der besten Erzählerinnen Italiens, schildert diese Suche in dichten, bedrängenden Szenen. Manche sind schwer zu ertragen. Der Gestank und der Lärm Neapels ist auch im kühlsten und abgelegensten Berliner Winterzimmer zu spüren. Die Geschichte lebt davon, dass alles anders ist, als die Erzählerin es sich zunächst dachte. Alles. Also nicht nur das Große und Ganze, sondern jede Kleinigkeit. Jeder Eindruck trügt. Der schreckliche Mann, der sie aus dem Geschäft wirft, ist ihre Jugendliebe. Ein paar Seiten später wird sie mit ihm ins Bett gehen.
Sie hat das Buch ihrer Mutter gewidmet. Das Buch, das mit dem Satz beginnt "Meine Mutter ertrank in der Nacht zum 23. Mai im Meer". Das Buch, in dem eine Tochter davon erzählt, wie sie sich auf den Weg macht, dahinter zu kommen, warum und wie ihre Mutter starb. Elena Ferrante, eine der besten Erzählerinnen Italiens, schildert diese Suche in dichten, bedrängenden Szenen. Manche sind schwer zu ertragen. Der Gestank und der Lärm Neapels ist auch im kühlsten und abgelegensten Berliner Winterzimmer zu spüren. Die Geschichte lebt davon, dass alles anders ist, als die Erzählerin es sich zunächst dachte. Alles. Also nicht nur das Große und Ganze, sondern jede Kleinigkeit. Jeder Eindruck trügt. Der schreckliche Mann, der sie aus dem Geschäft wirft, ist ihre Jugendliebe. Ein paar Seiten später wird sie mit ihm ins Bett gehen.
Der unbekannte Verbrecher, den sie sucht, ist ein alter Bekannter, und der Mord, den sie aufklären möchte, war keiner. Jedenfalls nicht so, wie sie ihn sich gedacht hatte. Diese Welt ist ein Vexierspiel, in dem alles seine Position verändert, mit jedem neuen Blick, den man darauf wirft. Aber es ist keine kühle Rechenaufgabe, keine am Kamin zu lesende detective-story, sondern Ferrante erzählt eine Mutter-Tochtergeschichte, also eine Geschichte um Liebe und Hass zwischen sich gar zu Ähnlichen. Es ist gut, dass die Mutter schon von Anfang an tot ist, sonst gäbe es noch Hauen und Stechen. So aber kann die Tochter sich üben in dem mühsamen Handwerk der Annäherung.
Der Leser verfolgt diese Anstrengungen gebannt. Der Plot dagegen, die Frage nach dem Wer war es?, lässt ihn kalt. Er mag nicht in die Sherlock Holmes Rolle gedrängt werden. Er weiß vielleicht nicht von Anfang an, aber doch nach einem Drittel der Erzählung, dass das ein Ablenkungsmanöver ist, ein Versuch, ihn für doof zu verkaufen.
Zu genau spürt der Leser, wie sehr sich die Erzählerin zwingt, diese leidige detective-story durchzuziehen, wie sehr ihr Interesse in eine ganz andere Richtung geht. Ihr Interesse aber, so gut ist Elena Ferrante nun mal, wird das des Lesers. Er sammelt alles auf, was kein Krimi ist. Er schärft seine Sinne für jeden Hinweis, der über die vom Plot gestellten Rätsel hinausweist. Und so merkt er bald, dass die Ich-Erzählerin immer wieder droht, ihr Ich zu verlieren an jene, deren Mörder, nein, die sie sucht.
Hat sie ihre Mutter umgebracht? Traut sie sich das nicht einzugestehen und schlüpft darum in deren Rolle? Gregory Peck in Hitchcocks "Spellbound"? Oder gibt es die Mutter schon lange nicht mehr, und wir erleben die letzten Etappen eines lange herangewachsenen Wahns? Ich weiß es nicht. Geübtere Leser werden einen sicheren Blick für die Realität dieses Textes haben. Aber für mich liegt seine Stärke gerade in seiner Unklarheit, in seiner Unsicherheit, in der Art, wie er den Leser verunsichert. Der allwissende Erzähler weiß am Ende nicht einmal, wer er selbst ist. Nach drei, vier Stunden legt man die Erzählung beiseite und fasst lange kein anderes Buch mehr an. Man geht langsamer, man achtet auf jede Stufe des langen Weges aus dem vierten Stock, und man achtet darauf, mit niemandem ins Gespräch zu kommen. So verunsichert ist man, und so sehr fürchtet man, keine weitere Verunsicherung mehr ertragen zu können.
Elena Ferrante: "Lästige Liebe". Roman. Aus dem Italienischen von Stefan Wendt. List Taschenbuch, 2003. ISBN 3548604064. 191 Seiten, 6,95 Euro.
Das Tier
 Beim ersten flüchtigen Blick in Frank T. Zumbachs "Balladenbuch" bin ich enttäuscht. Agnes Miegels "Die Mär vom Ritter Manuel" ist nicht darin. Ich denke: Wie soll man einen Balladensammler ernst nehmen, der dieses traumwandlerisch sichere Gedicht seinen Lesern vorenthält. Es ist ja auch nicht so, dass er die ostpreußische Balladendichterin (1879-1964) ganz weggelassen hätte. Aber sie ist nicht mit ihren berühmten Gedichten vertreten, die ganzen Generationen Schauder über die Rücken jagten, mit den "Nibelungen", den "Frauen von Nidden", sondern mit vier kleineren.
Beim ersten flüchtigen Blick in Frank T. Zumbachs "Balladenbuch" bin ich enttäuscht. Agnes Miegels "Die Mär vom Ritter Manuel" ist nicht darin. Ich denke: Wie soll man einen Balladensammler ernst nehmen, der dieses traumwandlerisch sichere Gedicht seinen Lesern vorenthält. Es ist ja auch nicht so, dass er die ostpreußische Balladendichterin (1879-1964) ganz weggelassen hätte. Aber sie ist nicht mit ihren berühmten Gedichten vertreten, die ganzen Generationen Schauder über die Rücken jagten, mit den "Nibelungen", den "Frauen von Nidden", sondern mit vier kleineren.
Vielleicht will Zumbach den Blick auf weniger bekannte Arbeiten der Dichterin lenken, die als junge Frau von zwanzig Jahren mit einem Schlag die Ballade wieder hineingestellt hatte ins junge 20. Jahrhundert. In den dreißiger und vierziger Jahren war sie dann mit Versen auf Adolf Hitler hervorgetreten:
"Neid hat er und Bruderhaß gestillt.
Unsere Herzen, hart von Not und Krieg,
hat mit seinen glühenden, glaubensvollen Worten er durchpflügt
wie Ackerschollen, bis ein neuer Frühling auf uns stieg".
Dichter - nicht einmal Dichterinnen - sind keine besseren Menschen. Nirgends zeigt sich das so deutlich wie in Balladen. Man kann sie nicht schreiben, man kann sie nicht lesen, ohne eine tüchtige Portion jener "Hau-drauf-Mentalität", die das Gutmenschentum - zu Recht - so fanatisch bekämpft.
Der Spaß an der Vernichtung nährt neun Zehntel des Genres. Man denke nur an Uhlands (1787-1862) "Schwäbische Kunde". Als ich das Gedicht mit zwölf, dreizehn in einer Balladensammlung des ausgehenden 19. Jahrhunderts entdeckte, nahm ich es mit ins Feld und deklamierte so laut ich konnte mit politisch völlig unkorrekter Lust:
"Bis einer, dem die Zeit zu lang,
Auf ihn den krummen Säbel schwang.
Da wallt dem Deutschen auch sein Blut.
Er trifft des Türken Pferd so gut,
Er haut ihm ab mit einem Streich
Die beiden Vorderfüß zugleich.
Als er das Tier zu Fall gebracht,
Da faßt er erst sein Schwert mit Macht,
Er schwingt es auf des Reiters Kopf,
Haut durch bis auf den Sattelknopf,
Haut auch den Sattel noch zu Stücken
Und tief noch in des Pferdes Rücken.
Zur Rechten sah man wie zur Linken
Einen halben Türken heruntersinken."
Vielleicht ist das - gleich nach der im Faust - die bekannteste Türkenzeile der deutschen Dichtung. Aber deutlich wichtiger als die Türkenfrage ist in diesen Versen die geradezu physische Aufforderung zur Gewalt. Das Gedicht mobilisiert die Muskulatur. Es ist fast unmöglich, diese Zeilen zu sprechen, ohne den Arm zu heben und zuzuschlagen. Ist man beim "Rücken" angekommen, so ist man auch drin. Man kann den Arm nicht mehr bewegen. Die zwei folgenden Zeilen sind zwar von nicht zu überbietender Brutalität, aber es ist eine des Kopfes. In den Zeilen vorher war man Täter. Um so distanzierter, ironischer, kälter wirken die folgenden zwei Zeilen. Sie haben jene Slapstick-Brutalität, bei der alles erlaubt ist, weil jeder weiß: Sie finden nur im Kopf statt. Dort allerdings bereiten sie ein Vergnügen, das tiefer reicht als alle Vernunft.
Zumbachs Anthologie enthält viele solcher Geschichten, und Zumbach ist klug genug, uns auch verschiedene Varianten derselben Balladen zu bieten. Gleich zu Beginn lesen wir dreimal fast dieselbe Geschichte. Es sind Volkslieder, die von einem Reiter erzählen, der ein Mädchen durch seinen Gesang becirct, so dass sie auf sein Pferd steigt. Er bringt sie dann in einen Wald auf eine Lichtung und dann heißt es:
"Sie kamen an einen Brunnen,
Der war mit Blut umrunnen.
Er spreit seinen Mantel ins grüne Gras,
Er bat sie, daß sie zu ihm saß.
Er legt sein Haupt in ihren Schoß,
Mit heißen Tränen sie ihn begoß.
'Weinst du um deines Vaters Gut,
Oder bin ich dir nicht gut genug?'
'Ich weine nicht um meines Vater Gut,
Herr Ulrich, ihr seid mir gut genug.
Dort oben in jener Tanne
Seh ich elf Jungfraun hangen.'
'Weinst du um die elf Jungfräulein,
So sollst du bald die zwölfte sein.'"
Wer hier keine Gänsehaut bekommt, der wird das Gruseln niemals lernen. In einer der drei von Zumbach vorgelegten Variationen - "Schondilie" heißt sie - rät das Mädchen dem Mörder, sein Oberkleid auszuziehen - "Jungfrauenblut spritzt weit und breit" erklärt sie - und bei dieser Gelegenheit packt sie das Schwert und haut "dem Ritter ab den Kopf". Es ist die "Frauen-sind-stark-Variante" dieser Vergewaltigertragödie.
Leider liefert Zumbach keine Erläuterungen. Man wüsste gerne, wie alt diese Variante ist. So wie sie hier steht, stammt sie aus dem 19. Jahrhundert. Aber vielleicht geht sie auch auf ältere - gewissermaßen frühfeministische - Vorfahren zurück. Es macht Spaß zu entdecken, dass die Parodie von Anfang an zum Genre gehörte. Man wird Herders Ödipus-Drama "Edward", von dem nicht angemerkt ist, dass es aus den "Stimmen der Völker in Liedern" stammt und Herders Angaben zufolge auf ein schottisches Volkslied zurückgeht, zwar mit unaufhaltsam sich steigernder Erregung lesen, aber eben auch darum, weil die von Strophe zu Strophe immer gemeiner werdende Geschichte in ihrer nicht enden wollenden Übertrumpfungsrhetorik auch etwas umwerfend Komisches hat.
Das widerspricht dem Grauen nicht. Es steigert es. Um die Nähe von Komik und Grauen - mitten in der Idylle - wusste auch Georg Trakl:
"Der Schatten
Da ich heut Morgen im Garten saß -
Die Bäume standen in blauer Blüh,
Voll Drosselruf und Tirili -
Sah ich meinen Schatten im Gras,
Gewaltig verzerrt, ein wunderlich Tier,
Das lag wie ein böser Traum vor mir.
Und ich ging und zitterte sehr,
Indes ein Brunnen ins Blaue sang
Und purpurn eine Knospe sprang
Und das Tier ging nebenher."
Frank T. Zumbach: "Das Balladenbuch". Deutsche Balladen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Artemis & Winkler, Düsseldorf und Zürich 2004. ISBN 3538069867. 824 Seiten. Bis 15.01.2005: 39,90 Euro, danach: 44,90 Euro.
Zauberbuch
 Preisen wir zuerst die Übersetzer Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. Man stelle sich vor, diese Himmelsmusik wäre Leuten in die Hände gefallen, die so schlecht Englisch oder gar so schlecht Deutsch könnten wie ich! Ich wäre der letzte, der gemerkt hätte, was für ein Bravourstück Richard Powers hier vorgelegt hat. Keine Zeile, die ich las, war schließlich von Richard Powers. Jeder Buchstabe war von Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. Sie seien gepriesen.
Preisen wir zuerst die Übersetzer Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. Man stelle sich vor, diese Himmelsmusik wäre Leuten in die Hände gefallen, die so schlecht Englisch oder gar so schlecht Deutsch könnten wie ich! Ich wäre der letzte, der gemerkt hätte, was für ein Bravourstück Richard Powers hier vorgelegt hat. Keine Zeile, die ich las, war schließlich von Richard Powers. Jeder Buchstabe war von Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. Sie seien gepriesen.
"Der Klang der Zeit" ist ihr Titel. Es ist ein guter Titel. Er kommt im Buch vor, und er ist eingängiger als der amerikanische Originaltitel "The Time Of Our Singing". Er klingt besser als jede mögliche Übersetzung des Originals. Aber wie schön ist das, wenn man erst einmal den Roman gelesen und gelernt hat, dass die "Zeit unseres Singens" nicht einmal war oder einmal sein wird, sondern immer ist, wenn wir singen! Wer die deutsche Übersetzung kauft, wird glauben, der Titel erinnere daran, dass jede Zeit ihren Klang habe, aber das ist nicht gemeint. Es geht um den Klang der Zeit selbst. Und mit dieser Ambivalenz sind wir mitten im Buch.
Richard Powers erzählt die Geschichte der USA, die Geschichte der Rassenkriege der USA in den letzten fünfzig Jahren. Er erzählt sie als eine Familiengeschichte. Sie beginnt am Ostersonntag 1939, als die Sängerin Marian Anderson, eine der bedeutendsten Altistinnen des 20. Jahrhunderts, ein Freiluftkonzert vor dem Lincolndenkmal in Washington gibt. Sie musste das tun, weil ihr die Konzertsäle - sie war schwarz - verschlossen blieben. Auf diesem Konzert lernen sich unter fast einer Million Besuchern Delia Daley aus Philadelphia und David Strom kennen. David Strom ist Professor für theoretische Physik an der Columbia-University und dort damit beschäftigt, sich und der Welt darüber Klarheit zu verschaffen, was Zeit ist. Er ist Jude, weil Hitler ihn dazu gemacht hat, und er ist musikbegeistert. Delia Daleys Vater ist Arzt. Sie will Sängerin werden, und sie ist schwarz. Die beiden lernen sich kennen, weil sie neben ihm steht und - ohne es zu merken - laut mitsingt. Als sie bemerkt, dass er sie ansieht, ist es das erste Mal, dass jemand sie ansieht, ohne dass er denkt: eine von denen oder eine von uns. David ist der erste, der nicht ihre Farbe, sondern sie sieht. Sie verliebt sich in ihn.
Von nun an geht es bei aller Vielstimmigkeit des Buches um zwei Themen: Rasse und Musik. Die Stroms erziehen ihre Kinder zu Hause. Es gibt keinen Gegenstand, den sie den zwei Jungen und der Jahre später geborenen Tochter nicht singend und spielend beibringen. Powers liebt es, die Musik zu beschreiben, und die Art, wie sie sie singen und spielen. Powers findet Tränen des Glücks treibende Worte für die Gesangeskünste des älteren Sohnes, der Bach und Monteverdi, Schubert und Orff mit stets sich steigernder Meisterschaft singt. Aber Powers schildert auch die Erniedrigungen, denen die Kinder ausgesetzt sind, die den Weißen zu schwarz und den Schwarzen zu weiß sind. Ich habe die 750 Seiten des Buches in zweieinhalb Tagen gelesen. Im Urlaub an einem Swimmingpool in Afrika. Jeder Hotelgast war weiß. Jeder Schwarze gehörte zum Personal. Ich habe das Buch nicht beiseite legen können. Es war zwei Uhr in der Nacht, und ich las immer noch. Wer 1946 geboren ist, der liest dieses Buch, egal, wo er lebte auf dieser Welt, auch als seine Geschichte. Er erinnert sich an Martin Luther King, an Malcolm X. Er schwärmte vielleicht auch einmal für die Black Panthers, und er hat nicht vergessen, dass damals - als die Beatles "Love, love, love" sangen - in hunderten amerikanischer Städte ein Krieg tobte, in dem jedem Schwarzen der Tod drohte. Er hat nicht vergessen, dass es vor allem die Schwarzen waren, die damals für ihr Land, das nicht ihres war, sondern das, in dem sie erschossen wurden, in Vietnam ihre Leben ließen. Er hat nicht vergessen, habe ich gesagt. Aber er hat nicht mehr gewusst, wie er es damals empfand. Jetzt weiß er es wieder. Er hat geweint unter seinem Moskitonetz, als er wieder von Little Rock las und von Schulkindern, die unter dem Schutz der Nationalgarde in ihre Schulen gebracht wurden. Er hat geweint aus Wut und mit dem Gefühl völliger Vergeblichkeit.
Wenige Seiten später kommt Richard Powers und führt ihm vor, wie wunderbar der einfachste Kanon ist, wenn die in aller Freiheit sich weit von einander entfernenden Stimmen sich wiederfinden, wenn sie wieder auseinandertreten und dann, als hätten sie nie etwas anderes gewollt, wieder bei einander sind: "The Time Of Our Singing". Powers lässt den Leser keine Sekunde in Ruhe. Er schickt ihn auf eine Reise, bei der er jeden Millimeter bestimmt. Es gibt keine Emotion, die Powers nicht eingeplant hätte. Der Erzähler weiß nicht nur alles. Er kann auch alles, und er macht alles. Wer das große Orchester nicht liebt, wer Gefühle lieber in handlichen Häppchen serviert bekommt als hineingejagt werden möchte, der darf Powers' Buch nicht anrühren. Er könnte daran verbrennen.
"Der Klang der Zeit" ist kein Tatsachenroman. Es ist ein Märchen. Eine Versuchsanordnung. Aber nicht in einem leergefegten Labor der europäischen Aufklärung, sondern an einem Ort, in dem alle Kontinente, alle Völker, alles Wissen über die Entstehung und das Verglühen der Galaxien wie über die unersättliche Gier, mit der der Mensch dem Menschen ein Schlächter ist, zusammenkommen, um herauszufinden, wer am Ende siegen wird: Gut oder Böse, Musik oder Rasse. Wenn es nur um die Antwort ginge, wären wir schnell fertig. Wir brauchten das Buch nicht lesen. Es gibt kein Ende. Es gibt immer nur den Versuch, so zu tun als habe die Schönheit der Klangfarben eine Chance gegen die Herrschaft der Farbenlehre des Rassismus, der immer nur zwei Farben kennt: die eigene und die der anderen. Am Ende von Richard Powers' Märchen sind fast alle tot. Aber der Erzähler - der jüngere Sohn des Physikers, der den Holocaust als einziger seiner Familie überlebte und der schwarzen Delia Daley - lebt, und er arbeitet weiter. Er hat sich wie seine Generation und andere Generationen vor und nach ihm immer wieder überlegt, wie er die Musik und die Politik mit einander verbinden kann, ob er nicht das eine für das andere aufgeben müsse. Er ist immer wieder zu anderen Schlussfolgerungen gekommen. Am Ende des Romans ist er kein Pianist, kein Sänger mehr, sondern er unterrichtet in einer Schule schwarze Kinder, so wie seine Eltern ihn unterrichtet hatten. Das Buch hört hier auf. Aber die Geschichte geht weiter. Sie ist älter als die Menschheit, und sie wird weitergehen, wenn die Menschheit längst einer anderen Art Platz gemacht haben wird.
Niemand wird lesen, wenn ich jetzt noch anfange, auf einzelne Schönheiten dieses Zauberbuches hinzuweisen. "Jonah zerrte mich durch die Schalterhalle wie durch einen Film der Nouvelle Vague". Mit einem Schlag sieht man "Pierrot le Fou" vor sich. Da sind Sätze wie diese: "Aber im Grunde sieht keiner den anderen. Das ist unsere Tragödie und irgendwann vielleicht auch unsere Rettung." Sie sind eingestreut, und sie stehen in ihrem Zusammenhang als das Selbstverständlichste. Nur wenn man sie daraus löst, verwandeln sie sich sofort in Marmor. Aber in einem Musikmärchen sind die schönsten Stellen natürlich die, in denen ein Thema aufgenommen und noch einmal durchgespielt und jetzt ganz anders, erst richtig verstanden wird. Am Ende seiner ungeheuren Komposition drängen sich solche Stellen, Knoten, in denen die Stränge der Geschichte zusammengezogen werden. Sie ergeben ein Geflecht, von dem man möchte, dass es niemals aufhört. Die letzten Worte des sterbenden Physikers an seinen jüngsten Sohn sind eine Botschaft für seine abwesende Tochter. Als die Jahre später - die Geschwister hatten keinen Kontakt mit einander - den Satz hört, beschimpft die Malcolm X-Jüngerin ihren toten jüdischen, weißen Vater: "Er hat sich nie, niemals mit mir unterhalten können". Wieder Jahre später fragt ihr astronomisch interessierter Sohn, sie hatte ihn mit einem inzwischen von der Polizei erschossenen Schwarzen gezeugt: "Was meinst Du, auf welcher Wellenlänge sind die auf den anderen Planeten?" Da stellt sich heraus, die Botschaft ihres Vaters war nichts anderes als die Antwort auf die Frage, die ihr Sohn noch nicht gestellt hatte: "An jedem Punkt, auf den man das Teleskop richtet, findet man eine neue Wellenlänge".
"Der Klang der Zeit" ist eines der Bücher, das man allen Freunden, allen Freundinnen schenken möchte. Aber man hat Angst, dass sie nicht so begeistert reagieren wie man selbst und dass man sie hassen wird dafür. Man stünde dann einsamer da als zuvor. Also schickt man nichts ab als diese Flaschenpost. Das Buch mag tausend Mal, hunderttausend Mal ein Bestseller sein, es ist Angst- und Liebestraum in einem.
Richard Powers: "Der Klang der Zeit". Roman. Aus dem Amerikanischen von Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. S. Fischer, Frankfurt/Main 2004. ISBN 310059021X. 765 Seiten mit einer Zeittafel, 22,90 Euro.
Plötzliches Aufscheinen der Erkenntnis
 Luis de Camoes (1524-1580) hat die Lusiaden - Lusitanien wurde Portugal nach Lusus, einem Gefährten des Bacchus benannt -, sein vaterländisches Gedicht, das die Heldentaten der Portugiesen beschreibt, auf seinen Fahrten im chinesischen Meer geschrieben. Das Versepos spielt vor allem in Malindi, einer alten Handelsstadt an der ostafrikanischen Küste, südlich von Mombasa. Dort erzählt der Seefahrer Vasco da Gama dem "König" Malindis die Geschichte Portugals. Vor allem erzählt er von dem unerschrockenen Mut seines kleinen Volkes, das die ganze Welt bereist.
Luis de Camoes (1524-1580) hat die Lusiaden - Lusitanien wurde Portugal nach Lusus, einem Gefährten des Bacchus benannt -, sein vaterländisches Gedicht, das die Heldentaten der Portugiesen beschreibt, auf seinen Fahrten im chinesischen Meer geschrieben. Das Versepos spielt vor allem in Malindi, einer alten Handelsstadt an der ostafrikanischen Küste, südlich von Mombasa. Dort erzählt der Seefahrer Vasco da Gama dem "König" Malindis die Geschichte Portugals. Vor allem erzählt er von dem unerschrockenen Mut seines kleinen Volkes, das die ganze Welt bereist.
Der Leser begreift bald, dass Camoes nicht die Entstehung eines Weltreiches beschreibt, sondern dass es ihm darum geht, durch seine Dichtung das Volk zu schaffen, das dieses Reiches würdig wäre. Die Lusiaden sind keine imperialistische Haudrauf-Poesie. Hier wird kein Hohes Lied des Völkerschlachtens angestimmt. Hier schreibt ein Mann, der Gewalt ausgeübt und erfahren hat, wie er sich den Weltenlauf und die Geschichte denkt. Es ist ein realistisches Buch. Die von Max Weber mit solcher Emphase betonte Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik war Camoes nur zu vertraut. Nach zwei Strophen, in denen er betont, wie wichtig es ist, dass der König redlich ist, dass er sich auf redliche Berater stützt, dass alles mit Anstand und gewissenhaft getan wird, kommen ein paar wesentliche, das vorher Gesagte nicht auslöschende, aber es doch traurigerweise relativierende Einschränkungen:
"Ich meine nicht, er soll sich nur allein
Auf Redlichkeit verlassen, unbefleckt
.....
Ist wer in allem gut, gerecht und rein
Dann hat er wenig in der Welt bewegt,
Mit Weltgeschäften kann nur schlecht umgehen,
Wer sich in Unschuld will mit Gott verstehen."
Gott spielt in den Lusiaden eine interessante Rolle. Er wird ein paar Mal erwähnt, es wird ab und an zu ihm gebetet, aber in Handlung, also in die Geschichte der Entdeckungen Vasco da Gamas und in die von dem erzählte Portugals, greift er nicht ein Mal ein. Da tummeln sich die alten heidnischen Gottheiten. Venus liebt die Lusitanier, nicht nur weil sie solche Helden sind, sondern auch weil ihre Sprache so nah am Latein ist. Bacchus dagegen ist eifersüchtig auf die Entdeckung des Seewegs nach Indien, hat er doch Alexander den Landweg dorthin gewiesen. Er befürchtet, dass die Portugiesen ihm den Ruhm rauben. So kämpfen die Götter an der Seite ihrer Favoriten auch gegen einander. Camoes schildert das mit viel Ironie und großem Spaß an Anspielungen auf die antiken Vorbilder, wie es sich für einen Humanisten gehört. Er ist aufgeklärt genug, und er weiß, sein Publikum ist es auch, dass am Ende seines vergnüglichen Epos die Göttin Thetys, die Gattin des Okeanos, Vasco da Gama und damit uns Lesern zublinzelt und erklärt:
"Denn ich, Saturn und Janus und sodann
Jupiter, Juno, wir sind ja erhoben
Durch menschlichen Erfindungsgeist und Wahn.
Man braucht uns nur, um uns im Vers zu loben..."
"Glaubten die Griechen an ihre Götter?", fragte Paul Veyne in einer klugen Abhandlung, weil ihm der Verdacht gekommen war, die Alten hätten nicht so geglaubt, wie uns das Christentum glauben gelehrt hat. Camoes gehört zu denen, die sich der Götter bedienen, um ihre Geschichten zu schönen, um etwas zu haben, mit dem man den Menschen Beine machen kann, um der einen, einzigen Menschheitsgeschichte einen Spiegel entgegen halten zu können, in dem sie sich erkennt, ohne sich identifizieren zu müssen. Nichts naiver als sich umstürzlerisch vorkommende Götter-Travestien, denn das parodistische Element gehört vom Anfang an zum Mythos dazu. So lässig ist Camoes' Umgang mit dem christlichen Gott nicht. Nichts Blasphemisches kommt ihm da über die Lippen, aber sein Gott hat sich dafür auch weit entfernt von der Welt. Er greift nicht in das Geschehen ein. Er ist nichts anderes als das Schicksal selbst. Man kann versuchen ihn zu ergründen, zu bewegen ist er nicht. So sehr Camoes die Mauren hasst, so sehr er sein Volk schilt, wenn es sie nicht bekriegt - sein Gott hat mehr von jenem Allah, in dessen Willen man sich zu ergeben hat, als von dem, der eines ist mit dem Sohn, den er hat sterben lassen, um die Welt und die Menschen von ihrem Schicksal zu befreien.
Wer die zitierten Verse liest, wird sich an ihren Reimen stören. Wir tun uns schwer damit, Geschichten oder gar Argumente in Versform zu lesen. Der Vers ist allenfalls als Stimmungsmache erlaubt. Aber wir lernen schnell um. Der Übersetzer der Lusiaden Hans Joachim Schaeffer hat den Versen Camoes' wieder jene Geschwindigkeit gegeben, die das Epos auszeichnet. Wir glauben ja, Gedichte seien langsamer als Prosa. Das ist Unsinn. Der Vers - und nun gar der Endreim - entfaltet einen Sog, der uns, haben wir erst einmal die Anfangsschwierigkeiten überwunden, immer weiter zum nächsten zieht. Wer ihn nicht gewöhnt ist, betrachtet den Vers als Verkehrshindernis, in Wahrheit ist er ein begeisterndes Transportmittel. Aber wir stehen vor ihm wie Führerscheinlose vor einem Ferrari. Man sollte sich hineinsetzen, ein wenig hin und her ruckeln und dann losfahren. Vorsichtig. Man versteht nicht gleich bei der ersten Fahrt, was für eine Gewalt einen davonträgt, aber dann Strophe nach Strophe, Gesang nach Gesang, begreift man die Schwierigkeiten nicht mehr, die man am Anfang hatte, und wenn man das Buch zur Seite legt, ist man traurig, dass man nicht Lukrez bei der Hand hat oder die Odyssee oder den Rasenden Roland, um weiterzuleben in diesem Wirbel, der Menschen und Götter, Sterne und Meere, das ganze Universum aufsaugt und uns wiederschenkt als Gesang.
Es gibt noch ein Hindernis, das genommen werden möchte. Die Anspielungen. Keine der achtzeiligen Strophen, in der nicht auf portugiesische Geschichte oder die Antike angespielt würde. Sie werden auf fast fünfzig Seiten alle erläutert, aber wer liest schon gerne ein Gedicht mit einem Anmerkungsapparat? Man versteht ja, dass, wenn es um portugiesische Geschichte geht, Camoes ohne die nicht auskommt, man weiß auch, wie wichtig der Vergleich mit der Antike war, wie sehr der eigene Wert davon abhing, dass man die antiken Vorbilder erreichte - Camoes ist fest davon überzeugt, dass die Portugiesen Griechen und Römer übertrumpft haben -, aber warum bringt, fragt sich der moderne Leser, Camoes es nicht fertig, einen Satz wie "Die Sonne ging unter" aufzuschreiben? Warum kommt das Wort Sonne fast gar nicht vor? Warum muss er schreiben:
"Der Liebhaber Larissas, voller Glut,
Lenkt schon hinab sein strahlendes Gespann
Zum fernen Westen, wo die große Flut
Ringsum bespült die Stadt Temistitan."
Wer die Anmerkungen konsultiert, erfährt, dass Koronis, die Geliebte Apollons, die ihm untreu war und dafür von ihm getötet wurde, aus Larissa stammte, dass das strahlende Gespann die vier Pferde sind, die Apollons Wagen, die Sonne, ziehen und dass mit Temistitan Tenochtitlan gemeint ist, die Hauptstadt Mexikos im entferntesten Westen also. Liest man jetzt noch einmal die Verse, versteht man zwar, dass es um eine Zeitangabe geht, aber geht es nicht einfacher, fragt man sich? Natürlich geht es. Aber da sind einmal die homerischen Epen, die viel geliebten und hoch geachteten Vorbilder, in denen die Uhrzeit genau so bekannt gemacht wird. Der zeitgenössische Leser Camoes' kostet hier also die Verbindung von Antike und gerade erst entdeckter Neuer Welt aus. Es kommt aber noch etwas hinzu. Die Lusiaden sind ganz wesentlich ein Buch über die Zeit. Die Datierung aller Handlungen spielt eine zentrale Rolle in diesem Buch, das das Geschichtsbuch Portugals wurde. Aber ebenso wichtig ist die Datierung der einzelnen Abschnitte der Reise des Vasco da Gama, die die Rahmenhandlung der Lusiaden ist. Die zitierten Verse leiten den zehnten, den letzten Gesang des Epos ein. Wie in der Diele des bürgerlichen Haushalts des 19. Jahrhunderts eine große Standuhr den Besucher begrüßte und verabschiedete, so steht hier Apollos goldener Wagen und sagt uns, dass wir dem Ende zugehen. Hier schlägt ein gewaltiger Gong und sagt uns die Stunde. Das alles kommt uns umständlich vor. Aber auch wir beginnen wieder zu begreifen, nachdem wir viel Geld dafür ausgegeben hatten, allen vorhandenen Stuck in unseren Wohnungen abzuschlagen, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nicht die Schönste ist. Die Schönheitslinie, dass wussten alle vormodernen Ästhetiker, ist keine Strecke, sondern eine Kurve. Der Umweg führt uns zu den schönsten Aussichten, und es gibt eine Freude am kurzen Stocken und nicht Weiterwissen und am folgenden und ohne es unerfahrbaren plötzlichen Aufscheinen der Erkenntnis.
Luis de Camoes: "Os Lusiades - die Lusiaden". Zweisprachig. Aus dem Portugiesischen von Hans Joachim Schaeffer, bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Rafael Arnold. Elfenbein Verlag, Berlin 2004 (3. Auflage). ISBN 3932245288. 655 Seiten, 65 Euro.
 Sie hat das Buch ihrer Mutter gewidmet. Das Buch, das mit dem Satz beginnt "Meine Mutter ertrank in der Nacht zum 23. Mai im Meer". Das Buch, in dem eine Tochter davon erzählt, wie sie sich auf den Weg macht, dahinter zu kommen, warum und wie ihre Mutter starb. Elena Ferrante, eine der besten Erzählerinnen Italiens, schildert diese Suche in dichten, bedrängenden Szenen. Manche sind schwer zu ertragen. Der Gestank und der Lärm Neapels ist auch im kühlsten und abgelegensten Berliner Winterzimmer zu spüren. Die Geschichte lebt davon, dass alles anders ist, als die Erzählerin es sich zunächst dachte. Alles. Also nicht nur das Große und Ganze, sondern jede Kleinigkeit. Jeder Eindruck trügt. Der schreckliche Mann, der sie aus dem Geschäft wirft, ist ihre Jugendliebe. Ein paar Seiten später wird sie mit ihm ins Bett gehen.
Sie hat das Buch ihrer Mutter gewidmet. Das Buch, das mit dem Satz beginnt "Meine Mutter ertrank in der Nacht zum 23. Mai im Meer". Das Buch, in dem eine Tochter davon erzählt, wie sie sich auf den Weg macht, dahinter zu kommen, warum und wie ihre Mutter starb. Elena Ferrante, eine der besten Erzählerinnen Italiens, schildert diese Suche in dichten, bedrängenden Szenen. Manche sind schwer zu ertragen. Der Gestank und der Lärm Neapels ist auch im kühlsten und abgelegensten Berliner Winterzimmer zu spüren. Die Geschichte lebt davon, dass alles anders ist, als die Erzählerin es sich zunächst dachte. Alles. Also nicht nur das Große und Ganze, sondern jede Kleinigkeit. Jeder Eindruck trügt. Der schreckliche Mann, der sie aus dem Geschäft wirft, ist ihre Jugendliebe. Ein paar Seiten später wird sie mit ihm ins Bett gehen.Der unbekannte Verbrecher, den sie sucht, ist ein alter Bekannter, und der Mord, den sie aufklären möchte, war keiner. Jedenfalls nicht so, wie sie ihn sich gedacht hatte. Diese Welt ist ein Vexierspiel, in dem alles seine Position verändert, mit jedem neuen Blick, den man darauf wirft. Aber es ist keine kühle Rechenaufgabe, keine am Kamin zu lesende detective-story, sondern Ferrante erzählt eine Mutter-Tochtergeschichte, also eine Geschichte um Liebe und Hass zwischen sich gar zu Ähnlichen. Es ist gut, dass die Mutter schon von Anfang an tot ist, sonst gäbe es noch Hauen und Stechen. So aber kann die Tochter sich üben in dem mühsamen Handwerk der Annäherung.
Der Leser verfolgt diese Anstrengungen gebannt. Der Plot dagegen, die Frage nach dem Wer war es?, lässt ihn kalt. Er mag nicht in die Sherlock Holmes Rolle gedrängt werden. Er weiß vielleicht nicht von Anfang an, aber doch nach einem Drittel der Erzählung, dass das ein Ablenkungsmanöver ist, ein Versuch, ihn für doof zu verkaufen.
Zu genau spürt der Leser, wie sehr sich die Erzählerin zwingt, diese leidige detective-story durchzuziehen, wie sehr ihr Interesse in eine ganz andere Richtung geht. Ihr Interesse aber, so gut ist Elena Ferrante nun mal, wird das des Lesers. Er sammelt alles auf, was kein Krimi ist. Er schärft seine Sinne für jeden Hinweis, der über die vom Plot gestellten Rätsel hinausweist. Und so merkt er bald, dass die Ich-Erzählerin immer wieder droht, ihr Ich zu verlieren an jene, deren Mörder, nein, die sie sucht.
Hat sie ihre Mutter umgebracht? Traut sie sich das nicht einzugestehen und schlüpft darum in deren Rolle? Gregory Peck in Hitchcocks "Spellbound"? Oder gibt es die Mutter schon lange nicht mehr, und wir erleben die letzten Etappen eines lange herangewachsenen Wahns? Ich weiß es nicht. Geübtere Leser werden einen sicheren Blick für die Realität dieses Textes haben. Aber für mich liegt seine Stärke gerade in seiner Unklarheit, in seiner Unsicherheit, in der Art, wie er den Leser verunsichert. Der allwissende Erzähler weiß am Ende nicht einmal, wer er selbst ist. Nach drei, vier Stunden legt man die Erzählung beiseite und fasst lange kein anderes Buch mehr an. Man geht langsamer, man achtet auf jede Stufe des langen Weges aus dem vierten Stock, und man achtet darauf, mit niemandem ins Gespräch zu kommen. So verunsichert ist man, und so sehr fürchtet man, keine weitere Verunsicherung mehr ertragen zu können.
Elena Ferrante: "Lästige Liebe". Roman. Aus dem Italienischen von Stefan Wendt. List Taschenbuch, 2003. ISBN 3548604064. 191 Seiten, 6,95 Euro.
Das Tier
 Beim ersten flüchtigen Blick in Frank T. Zumbachs "Balladenbuch" bin ich enttäuscht. Agnes Miegels "Die Mär vom Ritter Manuel" ist nicht darin. Ich denke: Wie soll man einen Balladensammler ernst nehmen, der dieses traumwandlerisch sichere Gedicht seinen Lesern vorenthält. Es ist ja auch nicht so, dass er die ostpreußische Balladendichterin (1879-1964) ganz weggelassen hätte. Aber sie ist nicht mit ihren berühmten Gedichten vertreten, die ganzen Generationen Schauder über die Rücken jagten, mit den "Nibelungen", den "Frauen von Nidden", sondern mit vier kleineren.
Beim ersten flüchtigen Blick in Frank T. Zumbachs "Balladenbuch" bin ich enttäuscht. Agnes Miegels "Die Mär vom Ritter Manuel" ist nicht darin. Ich denke: Wie soll man einen Balladensammler ernst nehmen, der dieses traumwandlerisch sichere Gedicht seinen Lesern vorenthält. Es ist ja auch nicht so, dass er die ostpreußische Balladendichterin (1879-1964) ganz weggelassen hätte. Aber sie ist nicht mit ihren berühmten Gedichten vertreten, die ganzen Generationen Schauder über die Rücken jagten, mit den "Nibelungen", den "Frauen von Nidden", sondern mit vier kleineren.Vielleicht will Zumbach den Blick auf weniger bekannte Arbeiten der Dichterin lenken, die als junge Frau von zwanzig Jahren mit einem Schlag die Ballade wieder hineingestellt hatte ins junge 20. Jahrhundert. In den dreißiger und vierziger Jahren war sie dann mit Versen auf Adolf Hitler hervorgetreten:
"Neid hat er und Bruderhaß gestillt.
Unsere Herzen, hart von Not und Krieg,
hat mit seinen glühenden, glaubensvollen Worten er durchpflügt
wie Ackerschollen, bis ein neuer Frühling auf uns stieg".
Dichter - nicht einmal Dichterinnen - sind keine besseren Menschen. Nirgends zeigt sich das so deutlich wie in Balladen. Man kann sie nicht schreiben, man kann sie nicht lesen, ohne eine tüchtige Portion jener "Hau-drauf-Mentalität", die das Gutmenschentum - zu Recht - so fanatisch bekämpft.
Der Spaß an der Vernichtung nährt neun Zehntel des Genres. Man denke nur an Uhlands (1787-1862) "Schwäbische Kunde". Als ich das Gedicht mit zwölf, dreizehn in einer Balladensammlung des ausgehenden 19. Jahrhunderts entdeckte, nahm ich es mit ins Feld und deklamierte so laut ich konnte mit politisch völlig unkorrekter Lust:
"Bis einer, dem die Zeit zu lang,
Auf ihn den krummen Säbel schwang.
Da wallt dem Deutschen auch sein Blut.
Er trifft des Türken Pferd so gut,
Er haut ihm ab mit einem Streich
Die beiden Vorderfüß zugleich.
Als er das Tier zu Fall gebracht,
Da faßt er erst sein Schwert mit Macht,
Er schwingt es auf des Reiters Kopf,
Haut durch bis auf den Sattelknopf,
Haut auch den Sattel noch zu Stücken
Und tief noch in des Pferdes Rücken.
Zur Rechten sah man wie zur Linken
Einen halben Türken heruntersinken."
Vielleicht ist das - gleich nach der im Faust - die bekannteste Türkenzeile der deutschen Dichtung. Aber deutlich wichtiger als die Türkenfrage ist in diesen Versen die geradezu physische Aufforderung zur Gewalt. Das Gedicht mobilisiert die Muskulatur. Es ist fast unmöglich, diese Zeilen zu sprechen, ohne den Arm zu heben und zuzuschlagen. Ist man beim "Rücken" angekommen, so ist man auch drin. Man kann den Arm nicht mehr bewegen. Die zwei folgenden Zeilen sind zwar von nicht zu überbietender Brutalität, aber es ist eine des Kopfes. In den Zeilen vorher war man Täter. Um so distanzierter, ironischer, kälter wirken die folgenden zwei Zeilen. Sie haben jene Slapstick-Brutalität, bei der alles erlaubt ist, weil jeder weiß: Sie finden nur im Kopf statt. Dort allerdings bereiten sie ein Vergnügen, das tiefer reicht als alle Vernunft.
Zumbachs Anthologie enthält viele solcher Geschichten, und Zumbach ist klug genug, uns auch verschiedene Varianten derselben Balladen zu bieten. Gleich zu Beginn lesen wir dreimal fast dieselbe Geschichte. Es sind Volkslieder, die von einem Reiter erzählen, der ein Mädchen durch seinen Gesang becirct, so dass sie auf sein Pferd steigt. Er bringt sie dann in einen Wald auf eine Lichtung und dann heißt es:
"Sie kamen an einen Brunnen,
Der war mit Blut umrunnen.
Er spreit seinen Mantel ins grüne Gras,
Er bat sie, daß sie zu ihm saß.
Er legt sein Haupt in ihren Schoß,
Mit heißen Tränen sie ihn begoß.
'Weinst du um deines Vaters Gut,
Oder bin ich dir nicht gut genug?'
'Ich weine nicht um meines Vater Gut,
Herr Ulrich, ihr seid mir gut genug.
Dort oben in jener Tanne
Seh ich elf Jungfraun hangen.'
'Weinst du um die elf Jungfräulein,
So sollst du bald die zwölfte sein.'"
Wer hier keine Gänsehaut bekommt, der wird das Gruseln niemals lernen. In einer der drei von Zumbach vorgelegten Variationen - "Schondilie" heißt sie - rät das Mädchen dem Mörder, sein Oberkleid auszuziehen - "Jungfrauenblut spritzt weit und breit" erklärt sie - und bei dieser Gelegenheit packt sie das Schwert und haut "dem Ritter ab den Kopf". Es ist die "Frauen-sind-stark-Variante" dieser Vergewaltigertragödie.
Leider liefert Zumbach keine Erläuterungen. Man wüsste gerne, wie alt diese Variante ist. So wie sie hier steht, stammt sie aus dem 19. Jahrhundert. Aber vielleicht geht sie auch auf ältere - gewissermaßen frühfeministische - Vorfahren zurück. Es macht Spaß zu entdecken, dass die Parodie von Anfang an zum Genre gehörte. Man wird Herders Ödipus-Drama "Edward", von dem nicht angemerkt ist, dass es aus den "Stimmen der Völker in Liedern" stammt und Herders Angaben zufolge auf ein schottisches Volkslied zurückgeht, zwar mit unaufhaltsam sich steigernder Erregung lesen, aber eben auch darum, weil die von Strophe zu Strophe immer gemeiner werdende Geschichte in ihrer nicht enden wollenden Übertrumpfungsrhetorik auch etwas umwerfend Komisches hat.
Das widerspricht dem Grauen nicht. Es steigert es. Um die Nähe von Komik und Grauen - mitten in der Idylle - wusste auch Georg Trakl:
"Der Schatten
Da ich heut Morgen im Garten saß -
Die Bäume standen in blauer Blüh,
Voll Drosselruf und Tirili -
Sah ich meinen Schatten im Gras,
Gewaltig verzerrt, ein wunderlich Tier,
Das lag wie ein böser Traum vor mir.
Und ich ging und zitterte sehr,
Indes ein Brunnen ins Blaue sang
Und purpurn eine Knospe sprang
Und das Tier ging nebenher."
Frank T. Zumbach: "Das Balladenbuch". Deutsche Balladen von den Anfängen bis zur Gegenwart. Artemis & Winkler, Düsseldorf und Zürich 2004. ISBN 3538069867. 824 Seiten. Bis 15.01.2005: 39,90 Euro, danach: 44,90 Euro.
Zauberbuch
 Preisen wir zuerst die Übersetzer Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. Man stelle sich vor, diese Himmelsmusik wäre Leuten in die Hände gefallen, die so schlecht Englisch oder gar so schlecht Deutsch könnten wie ich! Ich wäre der letzte, der gemerkt hätte, was für ein Bravourstück Richard Powers hier vorgelegt hat. Keine Zeile, die ich las, war schließlich von Richard Powers. Jeder Buchstabe war von Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. Sie seien gepriesen.
Preisen wir zuerst die Übersetzer Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. Man stelle sich vor, diese Himmelsmusik wäre Leuten in die Hände gefallen, die so schlecht Englisch oder gar so schlecht Deutsch könnten wie ich! Ich wäre der letzte, der gemerkt hätte, was für ein Bravourstück Richard Powers hier vorgelegt hat. Keine Zeile, die ich las, war schließlich von Richard Powers. Jeder Buchstabe war von Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. Sie seien gepriesen."Der Klang der Zeit" ist ihr Titel. Es ist ein guter Titel. Er kommt im Buch vor, und er ist eingängiger als der amerikanische Originaltitel "The Time Of Our Singing". Er klingt besser als jede mögliche Übersetzung des Originals. Aber wie schön ist das, wenn man erst einmal den Roman gelesen und gelernt hat, dass die "Zeit unseres Singens" nicht einmal war oder einmal sein wird, sondern immer ist, wenn wir singen! Wer die deutsche Übersetzung kauft, wird glauben, der Titel erinnere daran, dass jede Zeit ihren Klang habe, aber das ist nicht gemeint. Es geht um den Klang der Zeit selbst. Und mit dieser Ambivalenz sind wir mitten im Buch.
Richard Powers erzählt die Geschichte der USA, die Geschichte der Rassenkriege der USA in den letzten fünfzig Jahren. Er erzählt sie als eine Familiengeschichte. Sie beginnt am Ostersonntag 1939, als die Sängerin Marian Anderson, eine der bedeutendsten Altistinnen des 20. Jahrhunderts, ein Freiluftkonzert vor dem Lincolndenkmal in Washington gibt. Sie musste das tun, weil ihr die Konzertsäle - sie war schwarz - verschlossen blieben. Auf diesem Konzert lernen sich unter fast einer Million Besuchern Delia Daley aus Philadelphia und David Strom kennen. David Strom ist Professor für theoretische Physik an der Columbia-University und dort damit beschäftigt, sich und der Welt darüber Klarheit zu verschaffen, was Zeit ist. Er ist Jude, weil Hitler ihn dazu gemacht hat, und er ist musikbegeistert. Delia Daleys Vater ist Arzt. Sie will Sängerin werden, und sie ist schwarz. Die beiden lernen sich kennen, weil sie neben ihm steht und - ohne es zu merken - laut mitsingt. Als sie bemerkt, dass er sie ansieht, ist es das erste Mal, dass jemand sie ansieht, ohne dass er denkt: eine von denen oder eine von uns. David ist der erste, der nicht ihre Farbe, sondern sie sieht. Sie verliebt sich in ihn.
Von nun an geht es bei aller Vielstimmigkeit des Buches um zwei Themen: Rasse und Musik. Die Stroms erziehen ihre Kinder zu Hause. Es gibt keinen Gegenstand, den sie den zwei Jungen und der Jahre später geborenen Tochter nicht singend und spielend beibringen. Powers liebt es, die Musik zu beschreiben, und die Art, wie sie sie singen und spielen. Powers findet Tränen des Glücks treibende Worte für die Gesangeskünste des älteren Sohnes, der Bach und Monteverdi, Schubert und Orff mit stets sich steigernder Meisterschaft singt. Aber Powers schildert auch die Erniedrigungen, denen die Kinder ausgesetzt sind, die den Weißen zu schwarz und den Schwarzen zu weiß sind. Ich habe die 750 Seiten des Buches in zweieinhalb Tagen gelesen. Im Urlaub an einem Swimmingpool in Afrika. Jeder Hotelgast war weiß. Jeder Schwarze gehörte zum Personal. Ich habe das Buch nicht beiseite legen können. Es war zwei Uhr in der Nacht, und ich las immer noch. Wer 1946 geboren ist, der liest dieses Buch, egal, wo er lebte auf dieser Welt, auch als seine Geschichte. Er erinnert sich an Martin Luther King, an Malcolm X. Er schwärmte vielleicht auch einmal für die Black Panthers, und er hat nicht vergessen, dass damals - als die Beatles "Love, love, love" sangen - in hunderten amerikanischer Städte ein Krieg tobte, in dem jedem Schwarzen der Tod drohte. Er hat nicht vergessen, dass es vor allem die Schwarzen waren, die damals für ihr Land, das nicht ihres war, sondern das, in dem sie erschossen wurden, in Vietnam ihre Leben ließen. Er hat nicht vergessen, habe ich gesagt. Aber er hat nicht mehr gewusst, wie er es damals empfand. Jetzt weiß er es wieder. Er hat geweint unter seinem Moskitonetz, als er wieder von Little Rock las und von Schulkindern, die unter dem Schutz der Nationalgarde in ihre Schulen gebracht wurden. Er hat geweint aus Wut und mit dem Gefühl völliger Vergeblichkeit.
Wenige Seiten später kommt Richard Powers und führt ihm vor, wie wunderbar der einfachste Kanon ist, wenn die in aller Freiheit sich weit von einander entfernenden Stimmen sich wiederfinden, wenn sie wieder auseinandertreten und dann, als hätten sie nie etwas anderes gewollt, wieder bei einander sind: "The Time Of Our Singing". Powers lässt den Leser keine Sekunde in Ruhe. Er schickt ihn auf eine Reise, bei der er jeden Millimeter bestimmt. Es gibt keine Emotion, die Powers nicht eingeplant hätte. Der Erzähler weiß nicht nur alles. Er kann auch alles, und er macht alles. Wer das große Orchester nicht liebt, wer Gefühle lieber in handlichen Häppchen serviert bekommt als hineingejagt werden möchte, der darf Powers' Buch nicht anrühren. Er könnte daran verbrennen.
"Der Klang der Zeit" ist kein Tatsachenroman. Es ist ein Märchen. Eine Versuchsanordnung. Aber nicht in einem leergefegten Labor der europäischen Aufklärung, sondern an einem Ort, in dem alle Kontinente, alle Völker, alles Wissen über die Entstehung und das Verglühen der Galaxien wie über die unersättliche Gier, mit der der Mensch dem Menschen ein Schlächter ist, zusammenkommen, um herauszufinden, wer am Ende siegen wird: Gut oder Böse, Musik oder Rasse. Wenn es nur um die Antwort ginge, wären wir schnell fertig. Wir brauchten das Buch nicht lesen. Es gibt kein Ende. Es gibt immer nur den Versuch, so zu tun als habe die Schönheit der Klangfarben eine Chance gegen die Herrschaft der Farbenlehre des Rassismus, der immer nur zwei Farben kennt: die eigene und die der anderen. Am Ende von Richard Powers' Märchen sind fast alle tot. Aber der Erzähler - der jüngere Sohn des Physikers, der den Holocaust als einziger seiner Familie überlebte und der schwarzen Delia Daley - lebt, und er arbeitet weiter. Er hat sich wie seine Generation und andere Generationen vor und nach ihm immer wieder überlegt, wie er die Musik und die Politik mit einander verbinden kann, ob er nicht das eine für das andere aufgeben müsse. Er ist immer wieder zu anderen Schlussfolgerungen gekommen. Am Ende des Romans ist er kein Pianist, kein Sänger mehr, sondern er unterrichtet in einer Schule schwarze Kinder, so wie seine Eltern ihn unterrichtet hatten. Das Buch hört hier auf. Aber die Geschichte geht weiter. Sie ist älter als die Menschheit, und sie wird weitergehen, wenn die Menschheit längst einer anderen Art Platz gemacht haben wird.
Niemand wird lesen, wenn ich jetzt noch anfange, auf einzelne Schönheiten dieses Zauberbuches hinzuweisen. "Jonah zerrte mich durch die Schalterhalle wie durch einen Film der Nouvelle Vague". Mit einem Schlag sieht man "Pierrot le Fou" vor sich. Da sind Sätze wie diese: "Aber im Grunde sieht keiner den anderen. Das ist unsere Tragödie und irgendwann vielleicht auch unsere Rettung." Sie sind eingestreut, und sie stehen in ihrem Zusammenhang als das Selbstverständlichste. Nur wenn man sie daraus löst, verwandeln sie sich sofort in Marmor. Aber in einem Musikmärchen sind die schönsten Stellen natürlich die, in denen ein Thema aufgenommen und noch einmal durchgespielt und jetzt ganz anders, erst richtig verstanden wird. Am Ende seiner ungeheuren Komposition drängen sich solche Stellen, Knoten, in denen die Stränge der Geschichte zusammengezogen werden. Sie ergeben ein Geflecht, von dem man möchte, dass es niemals aufhört. Die letzten Worte des sterbenden Physikers an seinen jüngsten Sohn sind eine Botschaft für seine abwesende Tochter. Als die Jahre später - die Geschwister hatten keinen Kontakt mit einander - den Satz hört, beschimpft die Malcolm X-Jüngerin ihren toten jüdischen, weißen Vater: "Er hat sich nie, niemals mit mir unterhalten können". Wieder Jahre später fragt ihr astronomisch interessierter Sohn, sie hatte ihn mit einem inzwischen von der Polizei erschossenen Schwarzen gezeugt: "Was meinst Du, auf welcher Wellenlänge sind die auf den anderen Planeten?" Da stellt sich heraus, die Botschaft ihres Vaters war nichts anderes als die Antwort auf die Frage, die ihr Sohn noch nicht gestellt hatte: "An jedem Punkt, auf den man das Teleskop richtet, findet man eine neue Wellenlänge".
"Der Klang der Zeit" ist eines der Bücher, das man allen Freunden, allen Freundinnen schenken möchte. Aber man hat Angst, dass sie nicht so begeistert reagieren wie man selbst und dass man sie hassen wird dafür. Man stünde dann einsamer da als zuvor. Also schickt man nichts ab als diese Flaschenpost. Das Buch mag tausend Mal, hunderttausend Mal ein Bestseller sein, es ist Angst- und Liebestraum in einem.
Richard Powers: "Der Klang der Zeit". Roman. Aus dem Amerikanischen von Manfred Allie und Gabriele Kempf-Allie. S. Fischer, Frankfurt/Main 2004. ISBN 310059021X. 765 Seiten mit einer Zeittafel, 22,90 Euro.
Plötzliches Aufscheinen der Erkenntnis
 Luis de Camoes (1524-1580) hat die Lusiaden - Lusitanien wurde Portugal nach Lusus, einem Gefährten des Bacchus benannt -, sein vaterländisches Gedicht, das die Heldentaten der Portugiesen beschreibt, auf seinen Fahrten im chinesischen Meer geschrieben. Das Versepos spielt vor allem in Malindi, einer alten Handelsstadt an der ostafrikanischen Küste, südlich von Mombasa. Dort erzählt der Seefahrer Vasco da Gama dem "König" Malindis die Geschichte Portugals. Vor allem erzählt er von dem unerschrockenen Mut seines kleinen Volkes, das die ganze Welt bereist.
Luis de Camoes (1524-1580) hat die Lusiaden - Lusitanien wurde Portugal nach Lusus, einem Gefährten des Bacchus benannt -, sein vaterländisches Gedicht, das die Heldentaten der Portugiesen beschreibt, auf seinen Fahrten im chinesischen Meer geschrieben. Das Versepos spielt vor allem in Malindi, einer alten Handelsstadt an der ostafrikanischen Küste, südlich von Mombasa. Dort erzählt der Seefahrer Vasco da Gama dem "König" Malindis die Geschichte Portugals. Vor allem erzählt er von dem unerschrockenen Mut seines kleinen Volkes, das die ganze Welt bereist.Der Leser begreift bald, dass Camoes nicht die Entstehung eines Weltreiches beschreibt, sondern dass es ihm darum geht, durch seine Dichtung das Volk zu schaffen, das dieses Reiches würdig wäre. Die Lusiaden sind keine imperialistische Haudrauf-Poesie. Hier wird kein Hohes Lied des Völkerschlachtens angestimmt. Hier schreibt ein Mann, der Gewalt ausgeübt und erfahren hat, wie er sich den Weltenlauf und die Geschichte denkt. Es ist ein realistisches Buch. Die von Max Weber mit solcher Emphase betonte Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik war Camoes nur zu vertraut. Nach zwei Strophen, in denen er betont, wie wichtig es ist, dass der König redlich ist, dass er sich auf redliche Berater stützt, dass alles mit Anstand und gewissenhaft getan wird, kommen ein paar wesentliche, das vorher Gesagte nicht auslöschende, aber es doch traurigerweise relativierende Einschränkungen:
"Ich meine nicht, er soll sich nur allein
Auf Redlichkeit verlassen, unbefleckt
.....
Ist wer in allem gut, gerecht und rein
Dann hat er wenig in der Welt bewegt,
Mit Weltgeschäften kann nur schlecht umgehen,
Wer sich in Unschuld will mit Gott verstehen."
Gott spielt in den Lusiaden eine interessante Rolle. Er wird ein paar Mal erwähnt, es wird ab und an zu ihm gebetet, aber in Handlung, also in die Geschichte der Entdeckungen Vasco da Gamas und in die von dem erzählte Portugals, greift er nicht ein Mal ein. Da tummeln sich die alten heidnischen Gottheiten. Venus liebt die Lusitanier, nicht nur weil sie solche Helden sind, sondern auch weil ihre Sprache so nah am Latein ist. Bacchus dagegen ist eifersüchtig auf die Entdeckung des Seewegs nach Indien, hat er doch Alexander den Landweg dorthin gewiesen. Er befürchtet, dass die Portugiesen ihm den Ruhm rauben. So kämpfen die Götter an der Seite ihrer Favoriten auch gegen einander. Camoes schildert das mit viel Ironie und großem Spaß an Anspielungen auf die antiken Vorbilder, wie es sich für einen Humanisten gehört. Er ist aufgeklärt genug, und er weiß, sein Publikum ist es auch, dass am Ende seines vergnüglichen Epos die Göttin Thetys, die Gattin des Okeanos, Vasco da Gama und damit uns Lesern zublinzelt und erklärt:
"Denn ich, Saturn und Janus und sodann
Jupiter, Juno, wir sind ja erhoben
Durch menschlichen Erfindungsgeist und Wahn.
Man braucht uns nur, um uns im Vers zu loben..."
"Glaubten die Griechen an ihre Götter?", fragte Paul Veyne in einer klugen Abhandlung, weil ihm der Verdacht gekommen war, die Alten hätten nicht so geglaubt, wie uns das Christentum glauben gelehrt hat. Camoes gehört zu denen, die sich der Götter bedienen, um ihre Geschichten zu schönen, um etwas zu haben, mit dem man den Menschen Beine machen kann, um der einen, einzigen Menschheitsgeschichte einen Spiegel entgegen halten zu können, in dem sie sich erkennt, ohne sich identifizieren zu müssen. Nichts naiver als sich umstürzlerisch vorkommende Götter-Travestien, denn das parodistische Element gehört vom Anfang an zum Mythos dazu. So lässig ist Camoes' Umgang mit dem christlichen Gott nicht. Nichts Blasphemisches kommt ihm da über die Lippen, aber sein Gott hat sich dafür auch weit entfernt von der Welt. Er greift nicht in das Geschehen ein. Er ist nichts anderes als das Schicksal selbst. Man kann versuchen ihn zu ergründen, zu bewegen ist er nicht. So sehr Camoes die Mauren hasst, so sehr er sein Volk schilt, wenn es sie nicht bekriegt - sein Gott hat mehr von jenem Allah, in dessen Willen man sich zu ergeben hat, als von dem, der eines ist mit dem Sohn, den er hat sterben lassen, um die Welt und die Menschen von ihrem Schicksal zu befreien.
Wer die zitierten Verse liest, wird sich an ihren Reimen stören. Wir tun uns schwer damit, Geschichten oder gar Argumente in Versform zu lesen. Der Vers ist allenfalls als Stimmungsmache erlaubt. Aber wir lernen schnell um. Der Übersetzer der Lusiaden Hans Joachim Schaeffer hat den Versen Camoes' wieder jene Geschwindigkeit gegeben, die das Epos auszeichnet. Wir glauben ja, Gedichte seien langsamer als Prosa. Das ist Unsinn. Der Vers - und nun gar der Endreim - entfaltet einen Sog, der uns, haben wir erst einmal die Anfangsschwierigkeiten überwunden, immer weiter zum nächsten zieht. Wer ihn nicht gewöhnt ist, betrachtet den Vers als Verkehrshindernis, in Wahrheit ist er ein begeisterndes Transportmittel. Aber wir stehen vor ihm wie Führerscheinlose vor einem Ferrari. Man sollte sich hineinsetzen, ein wenig hin und her ruckeln und dann losfahren. Vorsichtig. Man versteht nicht gleich bei der ersten Fahrt, was für eine Gewalt einen davonträgt, aber dann Strophe nach Strophe, Gesang nach Gesang, begreift man die Schwierigkeiten nicht mehr, die man am Anfang hatte, und wenn man das Buch zur Seite legt, ist man traurig, dass man nicht Lukrez bei der Hand hat oder die Odyssee oder den Rasenden Roland, um weiterzuleben in diesem Wirbel, der Menschen und Götter, Sterne und Meere, das ganze Universum aufsaugt und uns wiederschenkt als Gesang.
Es gibt noch ein Hindernis, das genommen werden möchte. Die Anspielungen. Keine der achtzeiligen Strophen, in der nicht auf portugiesische Geschichte oder die Antike angespielt würde. Sie werden auf fast fünfzig Seiten alle erläutert, aber wer liest schon gerne ein Gedicht mit einem Anmerkungsapparat? Man versteht ja, dass, wenn es um portugiesische Geschichte geht, Camoes ohne die nicht auskommt, man weiß auch, wie wichtig der Vergleich mit der Antike war, wie sehr der eigene Wert davon abhing, dass man die antiken Vorbilder erreichte - Camoes ist fest davon überzeugt, dass die Portugiesen Griechen und Römer übertrumpft haben -, aber warum bringt, fragt sich der moderne Leser, Camoes es nicht fertig, einen Satz wie "Die Sonne ging unter" aufzuschreiben? Warum kommt das Wort Sonne fast gar nicht vor? Warum muss er schreiben:
"Der Liebhaber Larissas, voller Glut,
Lenkt schon hinab sein strahlendes Gespann
Zum fernen Westen, wo die große Flut
Ringsum bespült die Stadt Temistitan."
Wer die Anmerkungen konsultiert, erfährt, dass Koronis, die Geliebte Apollons, die ihm untreu war und dafür von ihm getötet wurde, aus Larissa stammte, dass das strahlende Gespann die vier Pferde sind, die Apollons Wagen, die Sonne, ziehen und dass mit Temistitan Tenochtitlan gemeint ist, die Hauptstadt Mexikos im entferntesten Westen also. Liest man jetzt noch einmal die Verse, versteht man zwar, dass es um eine Zeitangabe geht, aber geht es nicht einfacher, fragt man sich? Natürlich geht es. Aber da sind einmal die homerischen Epen, die viel geliebten und hoch geachteten Vorbilder, in denen die Uhrzeit genau so bekannt gemacht wird. Der zeitgenössische Leser Camoes' kostet hier also die Verbindung von Antike und gerade erst entdeckter Neuer Welt aus. Es kommt aber noch etwas hinzu. Die Lusiaden sind ganz wesentlich ein Buch über die Zeit. Die Datierung aller Handlungen spielt eine zentrale Rolle in diesem Buch, das das Geschichtsbuch Portugals wurde. Aber ebenso wichtig ist die Datierung der einzelnen Abschnitte der Reise des Vasco da Gama, die die Rahmenhandlung der Lusiaden ist. Die zitierten Verse leiten den zehnten, den letzten Gesang des Epos ein. Wie in der Diele des bürgerlichen Haushalts des 19. Jahrhunderts eine große Standuhr den Besucher begrüßte und verabschiedete, so steht hier Apollos goldener Wagen und sagt uns, dass wir dem Ende zugehen. Hier schlägt ein gewaltiger Gong und sagt uns die Stunde. Das alles kommt uns umständlich vor. Aber auch wir beginnen wieder zu begreifen, nachdem wir viel Geld dafür ausgegeben hatten, allen vorhandenen Stuck in unseren Wohnungen abzuschlagen, dass die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten nicht die Schönste ist. Die Schönheitslinie, dass wussten alle vormodernen Ästhetiker, ist keine Strecke, sondern eine Kurve. Der Umweg führt uns zu den schönsten Aussichten, und es gibt eine Freude am kurzen Stocken und nicht Weiterwissen und am folgenden und ohne es unerfahrbaren plötzlichen Aufscheinen der Erkenntnis.
Luis de Camoes: "Os Lusiades - die Lusiaden". Zweisprachig. Aus dem Portugiesischen von Hans Joachim Schaeffer, bearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Rafael Arnold. Elfenbein Verlag, Berlin 2004 (3. Auflage). ISBN 3932245288. 655 Seiten, 65 Euro.