Magazinrundschau
Der edle Akt heißt merodok
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag ab 10 Uhr.
03.05.2011. Abajournal erklärt, warum wir vielleicht nie die Schätze der Savory Jazz Collection hören werden. Das New York Magazine legt ein neues Parfüm auf: Den Dreck der Kindheit. In Ägypten bereiten die Muslimbrüder unverhohlen die islamische Herrschaft vor, berichtet Al Ahram. The New Republic porträtiert den populären ägyptischen Israelhasser Amr Moussa. Harper's Magazine geht mit muslimischen Touristen in thailändische Bordelle. Open Democracy erklärt, was orthodoxer jüdischer Feminismus ist. In Prospect übernimmt Niall Ferguson die Weltherrschaft.
New York Magazine (USA), 24.04.2011
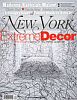 Geoffrey Gray schreibt ein schönes Porträt des New Yorker Avantgarde-Duftmeisters Christopher Brosius, der eine neue Tendenz zu Independent-Parfumeuren verkörpert. Seine Inspirationen sind manchmal recht drastisch und gehen bis zu (sauberen) Männerärschen. Sein letzter Duft soll "unsichtbar" sein. Ganz aus dem Häuschen gerät Gray aber bei "Soaked Earth", für das sich Brosius vom Dreck inspirieren ließ, in dem er als Kind spielte: "Als ich daran schnupperte, roch es nicht nach gewöhnlichem Dreck, Es war magischer Dreck. Sofort vertraut. Erinnerungen stiegen in mir hoch - starke emotionale Ströme. Ich sah die klapprige Tankstelle meiner Kindheit oben im Staat New York vor mir. Ich sah mich auf dem Beifahrersitz im Pickup truck meines Großvaters, der mit Hundehaaren übersät war." Gray empfiehlt Michelyn Camens Blog Cafleurebon, in dem es mehrere Artikel über Brosius gibt.
Geoffrey Gray schreibt ein schönes Porträt des New Yorker Avantgarde-Duftmeisters Christopher Brosius, der eine neue Tendenz zu Independent-Parfumeuren verkörpert. Seine Inspirationen sind manchmal recht drastisch und gehen bis zu (sauberen) Männerärschen. Sein letzter Duft soll "unsichtbar" sein. Ganz aus dem Häuschen gerät Gray aber bei "Soaked Earth", für das sich Brosius vom Dreck inspirieren ließ, in dem er als Kind spielte: "Als ich daran schnupperte, roch es nicht nach gewöhnlichem Dreck, Es war magischer Dreck. Sofort vertraut. Erinnerungen stiegen in mir hoch - starke emotionale Ströme. Ich sah die klapprige Tankstelle meiner Kindheit oben im Staat New York vor mir. Ich sah mich auf dem Beifahrersitz im Pickup truck meines Großvaters, der mit Hundehaaren übersät war." Gray empfiehlt Michelyn Camens Blog Cafleurebon, in dem es mehrere Artikel über Brosius gibt.Al Ahram Weekly (Ägypten), 28.04.2011
 Die Muslimbrüder entpuppen sich inzwischen in Ägypten als Wölfe im Schafspelz, meint Nehad Selaiha, die das allerdings nicht sehr überrascht. Sie trägt die markantesten Äußerungen der letzten Wochen zusammen: "Am Donnerstag, den 14. April, hielten die Muslimbrüder nördlich von Kairo eine Volksversammlung im Bezirk Imbaba ab (in den 80ern und 90ern ein bekannter Brutkasten für militante fundamentalistische Islamisten, die sich Gama'aat Al-Jihad nannten). Auf dieser Versammlung erklärte Sa'd Al-Husseini, ein führendes Mitglied der Muslimbrüder, klar und deutlich, dass 'die Bruderschaft derzeit anstrebe, der Gesellschaft ihre islamische Identität bewusst zu machen, um die islamische Herrschaft vorzubereiten'. Er forderte alle islamischen Gruppen - 'die Salafiten, die Sunniten, die Sufis' - auf, ihre Differenzen beiseite zu legen und 'zusammenzuarbeiten, um die Religion zu stärken', und ermutigte sie, sich auszubreiten und überall politisch aktiv zu werden - in Moscheen, Fabriken und Universitäten. Gleichzeitig verkündete auftrumpfend Mahmoud Izzat, ein Abgeordneter der Muslimführerschaft, die Bruderschaft werde islamische Strafen verhängen, sobald sie das Land besitze'".
Die Muslimbrüder entpuppen sich inzwischen in Ägypten als Wölfe im Schafspelz, meint Nehad Selaiha, die das allerdings nicht sehr überrascht. Sie trägt die markantesten Äußerungen der letzten Wochen zusammen: "Am Donnerstag, den 14. April, hielten die Muslimbrüder nördlich von Kairo eine Volksversammlung im Bezirk Imbaba ab (in den 80ern und 90ern ein bekannter Brutkasten für militante fundamentalistische Islamisten, die sich Gama'aat Al-Jihad nannten). Auf dieser Versammlung erklärte Sa'd Al-Husseini, ein führendes Mitglied der Muslimbrüder, klar und deutlich, dass 'die Bruderschaft derzeit anstrebe, der Gesellschaft ihre islamische Identität bewusst zu machen, um die islamische Herrschaft vorzubereiten'. Er forderte alle islamischen Gruppen - 'die Salafiten, die Sunniten, die Sufis' - auf, ihre Differenzen beiseite zu legen und 'zusammenzuarbeiten, um die Religion zu stärken', und ermutigte sie, sich auszubreiten und überall politisch aktiv zu werden - in Moscheen, Fabriken und Universitäten. Gleichzeitig verkündete auftrumpfend Mahmoud Izzat, ein Abgeordneter der Muslimführerschaft, die Bruderschaft werde islamische Strafen verhängen, sobald sie das Land besitze'".Weitere Artikel beschäftigen sich mit den Auswirkungen der Revolution auf die Philosophie, die Literatur und die Kunst.
New Republic (USA), 28.04.2011
 Auch Eric Trager hat nichts Gutes aus Ägypten zu berichten. Er porträtiert Amr Moussa, den ehemaligen Außenminister Mubaraks, der als Nationalist und erklärter Israelhasser Aussichten hat, die Wahlen in Ägypten zu gewinnen. "Obwohl ein Krieg zwischen Israel und Ägypten sehr unwahrscheinlich ist, erklärte Moussa kürzlich einer Gruppe ägyptischer Jugendlicher, dass das Camp David Abkommen 'verfallen' sei, offenbar von früheren Äußerungen zurückweichend, in denen er den ägyptisch-israelischen Friedens unterstützt hatte. Er hat auch 'Flugverbotszonen' über Gaza gefordert, Israel und das Gaddafi-Regime gleichsetzend. Darüber hinaus dürfte Ägypten unter Moussa weniger freundlich gegenüber der US-Regierung agieren: Wikileaks-Dokumente legen nahe, dass Moussa den Iran nicht als Bedrohung ansieht und arabisch-iranische Verbindungen stärken würde."
Auch Eric Trager hat nichts Gutes aus Ägypten zu berichten. Er porträtiert Amr Moussa, den ehemaligen Außenminister Mubaraks, der als Nationalist und erklärter Israelhasser Aussichten hat, die Wahlen in Ägypten zu gewinnen. "Obwohl ein Krieg zwischen Israel und Ägypten sehr unwahrscheinlich ist, erklärte Moussa kürzlich einer Gruppe ägyptischer Jugendlicher, dass das Camp David Abkommen 'verfallen' sei, offenbar von früheren Äußerungen zurückweichend, in denen er den ägyptisch-israelischen Friedens unterstützt hatte. Er hat auch 'Flugverbotszonen' über Gaza gefordert, Israel und das Gaddafi-Regime gleichsetzend. Darüber hinaus dürfte Ägypten unter Moussa weniger freundlich gegenüber der US-Regierung agieren: Wikileaks-Dokumente legen nahe, dass Moussa den Iran nicht als Bedrohung ansieht und arabisch-iranische Verbindungen stärken würde."Außerdem: Barak Barfi beschreibt in einem sehr interessanten Artikel die verschiedenen Gruppen, aus denen sich der Widerstand gegen Gaddafi rekrutiert. Ihr schwächster Zweig ist - ausgerechnet - der militärische, der sich nicht nach Kompetenz, sondern nach Stammeszugehörigkeit zusammensetzt. Überaus freundlich im Ton, in der Sache dann aber doch recht ablehnend bespricht Christine Stansell Leila Ahmeds feministisch-antiimperialistisches Buch über den Schleier, "A Quiet Revolution". Für Ahmed ist der Schleier ein antiimperialistisches Statement, so Stansell, die das etwas schlicht findet: "Es gibt in dem Buch eine Menge darüber, warum Frauen ihn nach 1970 wieder anlegten, aber fast nichts darüber, warum sie ihn in der Mitte des Jahrhunderts abgelegt hatten."
New Yorker (USA), 09.05.2011
 Kann eine bunt zusammengewürfelte Zivilarmee einen Diktator besiegen? Dieser Frage geht Jon Lee Anderson in seiner Reportage aus Libyen nach. Er begleitete Osama ben Sadik, einen freiwilligen Krankenwagenfahrer, der 2007 aus Benghazi mit seiner amerikanischen Frau nach Virginia gezogen war, im Februar dieses Jahres aber mit einem der letzten Flüge wieder dorthin zurückkehrte, weil sich seine Söhne auf die Seite der Gaddafi-Gegner geschlagen hatten. "Am Vormittag, erzählte er mir, sei ein Mann mittleren Alters aus der Stadt Tobruk in der Klinik vorgefahren und habe ihn gebeten, ihn nach Al Uqaylah, eine kleine Durchgangsstation in fünfundzwanzig Meilen Entfernung zu fahren. Osama warnte ihn, dass sie genau auf der Vormarschroute von Gaddafis Truppen liege, der Mann meinte jedoch, seine Sicherheit spiele keine Rolle: Er wollte nach Al Uqaylah, um nach der Leiche seines Sohnes zu suchen. Dieser war als freiwilliger Rebell losgezogen, um an vorderster Front zu kämpfen. Nachdem der Vater einige Tage nichts von ihm gehört hatte, rief er ihn auf seinem Handy an. Ein Fremder ging ran. Als der Vater sagte, wer er sei, erklärte ihm der Fremde: 'Ich bin nicht dein Sohn. Scheiß auf deinen Sohn. Komm her und hol ihn in Al Uqaylah ab. Er hat keinen Kopf mehr.'"
Kann eine bunt zusammengewürfelte Zivilarmee einen Diktator besiegen? Dieser Frage geht Jon Lee Anderson in seiner Reportage aus Libyen nach. Er begleitete Osama ben Sadik, einen freiwilligen Krankenwagenfahrer, der 2007 aus Benghazi mit seiner amerikanischen Frau nach Virginia gezogen war, im Februar dieses Jahres aber mit einem der letzten Flüge wieder dorthin zurückkehrte, weil sich seine Söhne auf die Seite der Gaddafi-Gegner geschlagen hatten. "Am Vormittag, erzählte er mir, sei ein Mann mittleren Alters aus der Stadt Tobruk in der Klinik vorgefahren und habe ihn gebeten, ihn nach Al Uqaylah, eine kleine Durchgangsstation in fünfundzwanzig Meilen Entfernung zu fahren. Osama warnte ihn, dass sie genau auf der Vormarschroute von Gaddafis Truppen liege, der Mann meinte jedoch, seine Sicherheit spiele keine Rolle: Er wollte nach Al Uqaylah, um nach der Leiche seines Sohnes zu suchen. Dieser war als freiwilliger Rebell losgezogen, um an vorderster Front zu kämpfen. Nachdem der Vater einige Tage nichts von ihm gehört hatte, rief er ihn auf seinem Handy an. Ein Fremder ging ran. Als der Vater sagte, wer er sei, erklärte ihm der Fremde: 'Ich bin nicht dein Sohn. Scheiß auf deinen Sohn. Komm her und hol ihn in Al Uqaylah ab. Er hat keinen Kopf mehr.'"Elet es Irodalom (Ungarn), 29.04.2011
 Normalerweise bezieht sich eine Verfassung auf die Gemeinschaft der Staatsbürger des betreffenden Staates. Umso bedauerlicher findet es die Historikerin Maria Ormos in ihrem Beitrag über die grundlegenden Zusammenhänge von Nation und Staatsbürgerschaft, dass in der neuen ungarischen Verfassung nur die Nation der Ungarn erwähnt und damit offenbar der Ausschluss von Randgruppen - wie den Roma - suggeriert wird: "Die heutige Gesellschaft kann man mitsamt der Nichtungarn (der nicht-ganz-Ungarn), der vom Unglück Getroffenen, der Armen und Alten akzeptieren - man muss es sogar, weil das Ganze nur mit ihnen zusammen ein Ganzes ist. Natürlich ist die menschliche Gesellschaft kein biologisches Lebewesen, dennoch ist sie auf ihre Art ein organisches Gebilde. [...] Aus diesem Grund meine ich, dass das System nicht durch die Begünstigung der einen oder anderen Gruppe auf Kosten einer anderen verbessert werden kann, einfach deshalb nicht, weil auch diese anderen - wir sind."
Normalerweise bezieht sich eine Verfassung auf die Gemeinschaft der Staatsbürger des betreffenden Staates. Umso bedauerlicher findet es die Historikerin Maria Ormos in ihrem Beitrag über die grundlegenden Zusammenhänge von Nation und Staatsbürgerschaft, dass in der neuen ungarischen Verfassung nur die Nation der Ungarn erwähnt und damit offenbar der Ausschluss von Randgruppen - wie den Roma - suggeriert wird: "Die heutige Gesellschaft kann man mitsamt der Nichtungarn (der nicht-ganz-Ungarn), der vom Unglück Getroffenen, der Armen und Alten akzeptieren - man muss es sogar, weil das Ganze nur mit ihnen zusammen ein Ganzes ist. Natürlich ist die menschliche Gesellschaft kein biologisches Lebewesen, dennoch ist sie auf ihre Art ein organisches Gebilde. [...] Aus diesem Grund meine ich, dass das System nicht durch die Begünstigung der einen oder anderen Gruppe auf Kosten einer anderen verbessert werden kann, einfach deshalb nicht, weil auch diese anderen - wir sind."Am vergangenen Sonntag wurde Johannes Paul II. von seinem Nachfolger Papst Benedikt XVI. selig gesprochen. Der Journalist (und ehemalige langjährige Mitarbeiter von Radio Freies Europa in München) Laszlo Kasza hätte sich anstelle dieses Akts lieber eine Reform der Katholischen Kirche gewünscht. Und er sieht sich damit nicht allein: Millionen von Katholiken "haben das Gefühl, dass solche Feierlichkeiten von den eigentlichen Problemen der mit einer moralischen Krise kämpfenden Katholischen Kirche ablenken sollen: vom Priestermangel und von der massenhaften Abwanderung. [...] Der Grund dafür ist nicht die Gleichgültigkeit oder die Absicht, Kirchensteuer zu sparen, wie dies schon früher beobachtet werden konnte. Es ist schlimmer. Laut Alois Glück, dem Präsidenten des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, verlassen die Gläubigen jetzt die Kirche mit dem Gefühl der Scham und der Wut. Mit Scham aufgrund des weltweiten Skandals der Pädophilie, den die Kirchenführer Jahrzehntelang verheimlicht haben, und mit Wut, weil unsere Kirche unfähig ist, die eigenen Gesetze einzuhalten und die Reformvorschläge des Zweiten Vatikanischen Konzils umzusetzen. Es wäre gut, wenn auch wir Katholiken den Lutherschen Satz im Zeichen der Ökumene ans Herz nehmen würden: Ecclesia semper reformanda."
Harper's Magazine (USA), 01.03.2011
 Ein Text aus Harper's Magazine, online veröffentlicht in txtpost: Lawrence Osborne ist für eine ziemlich farbige Reportage unterwegs in der Grenzregion zwischen Thailand und Malaysia. Der Krieg zwischen islamistischen Separatisten und der thailändischen Armee hat in den letzten Jahren 4.000 Todesopfer gefordert. Ziel Nummer 1 sind muslimische Touristen aus Malaysia, die für Sex und Alkohol Bordelle im Süden Thailands besuchen. Mit einer solchen Gruppe ist Osborne in ein Bordell namens PINK gegangen: "Ich lernte einige nützliche malayische Wörter. 'Schwanz' ist burung. 'Möse' ist nonok... Der edle Akt selbst heißt merodok. Als sie langsam in ihren fruchtigen Gintonics versanken, lösten sich auch ihre Zungen. Was ich über den 'islamischen Krieg' denke? Hatte ich von den beiden Thai-Soldaten gehört, die letzte Woche in Rusok getötet worden waren? Sie hatten Schullehrer begleitet. Was dachte ich über die muslimischen Aufständischen, die Bars bombadierten und Buddhisten auf Gummiplantagen enthaupteten? Ah, aber man muss auch ihre Beweggründe verstehen."
Ein Text aus Harper's Magazine, online veröffentlicht in txtpost: Lawrence Osborne ist für eine ziemlich farbige Reportage unterwegs in der Grenzregion zwischen Thailand und Malaysia. Der Krieg zwischen islamistischen Separatisten und der thailändischen Armee hat in den letzten Jahren 4.000 Todesopfer gefordert. Ziel Nummer 1 sind muslimische Touristen aus Malaysia, die für Sex und Alkohol Bordelle im Süden Thailands besuchen. Mit einer solchen Gruppe ist Osborne in ein Bordell namens PINK gegangen: "Ich lernte einige nützliche malayische Wörter. 'Schwanz' ist burung. 'Möse' ist nonok... Der edle Akt selbst heißt merodok. Als sie langsam in ihren fruchtigen Gintonics versanken, lösten sich auch ihre Zungen. Was ich über den 'islamischen Krieg' denke? Hatte ich von den beiden Thai-Soldaten gehört, die letzte Woche in Rusok getötet worden waren? Sie hatten Schullehrer begleitet. Was dachte ich über die muslimischen Aufständischen, die Bars bombadierten und Buddhisten auf Gummiplantagen enthaupteten? Ah, aber man muss auch ihre Beweggründe verstehen."Espresso (Italien), 29.04.2011
 Am 13. April veröffentlichte die International Herald Tribune eine polemische Wortmeldung gegen Bernard-Henri Levy und den Krieg in Libyen, die ihnen von Umberto Eco per Mail geschickt wurde (online ist er nicht mehr, hier der Nachhall bei Twitter). Es war aber gar nicht Eco.Was ist noch wahr im Netz, fragt er sich nun in seiner Kolumne. "Es scheint dass Mister X den gefälschten Brief an die Herald Tribune unter Verwendung einer E-Mail-Adresse gesendet hat, die er vorher mit größter Leichtigkeit selbst eingerichtet hat. Allerdings hat er seine echte Mobiltelefonnummer angegeben. Kontrolliert hat die niemand. Erst ein paar Tage später haben die Zweifel eingesetzt und die Zeitung hat sich bei mir gemeldet und gefragt, ob der Brief vielleicht eine Fälschung sei. Ich sagte ja, und die Zeitung hat sofort eine Gegendarstellung veröffentlicht." Die Wahrheit ist nicht unbedingt der Normalfall im Internet, sagt Eco. "Das Internet ist zu einem anarchischen Territorium geworden, wo man alles behaupten kann, ohne Lügen gestraft zu werden. Wenn es aber so schwierig ist festzustellen, ob eine Meldung im Netz wahr ist, ist es erst einmal ratsam anzunehmen, sie sei falsch."
Am 13. April veröffentlichte die International Herald Tribune eine polemische Wortmeldung gegen Bernard-Henri Levy und den Krieg in Libyen, die ihnen von Umberto Eco per Mail geschickt wurde (online ist er nicht mehr, hier der Nachhall bei Twitter). Es war aber gar nicht Eco.Was ist noch wahr im Netz, fragt er sich nun in seiner Kolumne. "Es scheint dass Mister X den gefälschten Brief an die Herald Tribune unter Verwendung einer E-Mail-Adresse gesendet hat, die er vorher mit größter Leichtigkeit selbst eingerichtet hat. Allerdings hat er seine echte Mobiltelefonnummer angegeben. Kontrolliert hat die niemand. Erst ein paar Tage später haben die Zweifel eingesetzt und die Zeitung hat sich bei mir gemeldet und gefragt, ob der Brief vielleicht eine Fälschung sei. Ich sagte ja, und die Zeitung hat sofort eine Gegendarstellung veröffentlicht." Die Wahrheit ist nicht unbedingt der Normalfall im Internet, sagt Eco. "Das Internet ist zu einem anarchischen Territorium geworden, wo man alles behaupten kann, ohne Lügen gestraft zu werden. Wenn es aber so schwierig ist festzustellen, ob eine Meldung im Netz wahr ist, ist es erst einmal ratsam anzunehmen, sie sei falsch."Abajournal (USA), 01.05.2011
Immer häufiger gibt es Grund, an Copyright-Gesetzen zu verzweifeln. Das National Jazz Museum in Harlem erwarb letztes Jahr einen unerhörten Schatz - über 900 Live-Aufnahmen von Jazzgrößen aus den dreißiger Jahren in erstklassiger Tonqualität mit Musikern von Benny Goodman über Billie Holiday bis Coleman Hawkins, die "Savory Collection" (die New York Times berichtete). Werden wir diese Musik jemals hören? Steven Seidenberg schildert im Abajournal, das sich juristischen Fragen widmet, die Hintergründe und zitiert zunächst den Kollegen David G. Post im Volokh Conspiracy blog (hier): "'Die Urheberrechtsproblematik dieser Aufnahmen könnte so groß und vor allem: so schwer einzuschätzen sein, dass sie womöglich niemals veröffentlicht werden können." Eine weit verbreitete Problematik, merkt Seidenfeld an: "Im Januar 2006 gab das U.S. Copyright Office einen Bericht über verwaiste Werke heraus, der das Ausmaß des Problems benennt und Lösungswege skizziert... Der Bericht vermerkt zum Beispiel, dass viele Bilder aus Dokumentarfilmen entfernt werden, weil die Rechteinhaber der Bilder nicht aufgefunden werden können. Museen besitzen Millionen von Archivdokumeten, Fotografien, Filmrollen, die sie nicht veröffentlichen oder digitalisieren können, weil die Frage der Rechte ungeklärt ist." In diesem Rundfunkgespräch sind Ausschnitte aus Aufnahmen der Savory Collection zu hören.
Le Monde (Frankreich), 30.04.2011
Die Intellektuellen Europas werden von einem Endzeit-Pathos beherrscht, diagnostiziert der Romancier und Essayist Pascal Bruckner in einem Text über das Verführerische der Katastrophe. "Ihre alarmistischen Diskurse über die Atomkraft, das Klima und die Zukunft des Planeten leiden unter einem Widerspruch. Wenn die Lage wirklich so ernst ist, wie sie behaupten, wogegen soll man dann noch rebellieren? Warum nicht einfach entspannt auf den Untergang warten? Die vorgeschlagenen Lösungen jedenfalls scheinen der Schwere des Übels unterlegen ... Um der Ungewissheit der Geschichte zu entkommen, wird deshalb die Gewissheit der Katastrophe dekretiert: Sie erlaubt, sich entspannt in den Süßen des Abgrunds einzurichten. Wann der Zusammenbruch kommt, ist egal, er erwischt uns sowieso. Der Diskurs der Angst sagt nicht vielleicht, sondern: Der Horror ist gewiss."
Magyar Narancs (Ungarn), 21.04.2011
 Der polnische Journalist Artur Domoslawski erinnert in seinem Beitrag für die polnische Wochenzeitschrift Polityka (den die ungarische Magyar Narancs übernommen hat und dessen Titel an das Gedicht "Ein armer Christ schaut auf das Ghetto" von Czeslaw Milosz anlehnt) noch einmal an den fragwürdigen Politiker Johannes Paul II., der in Fragen der Moral ein Absolutist, in der Politik aber eher ein Relativist gewesen sei - von seiner Haltung zur Pädophilie innerhalb der Kirche ganz zu schweigen. Auch Domoslawski steht der Seligsprechung kritisch gegenüber, will sich aber hüten, als Nichtgläubiger dem Papst Ratschläge zu erteilen: "Sehr wohl betrachtet der Nichtgläubige aber jene gänzlich zum Diesseits und zur Gegenwart gehörende Sphäre, in die der Prozess der Seligsprechung - aufgrund des bloßen Gewichts dieses Aktes - eindringt. (...) Für den Nichtgläubigen ist die Seligsprechung eine Art monumentales, symbolisches Denkmal. Karol Wojtyla war eine faszinierende historische Gestalt, in deren Denken und Taten sich eine ganze Reihe wichtiger ethischer, politischer und historischer Debatten verdichtet. Von nun an wird sich vor allem der national-religiöse Kitsch in ihm verdichten. Bedauerlicherweise sogar für den Nichtgläubigen."
Der polnische Journalist Artur Domoslawski erinnert in seinem Beitrag für die polnische Wochenzeitschrift Polityka (den die ungarische Magyar Narancs übernommen hat und dessen Titel an das Gedicht "Ein armer Christ schaut auf das Ghetto" von Czeslaw Milosz anlehnt) noch einmal an den fragwürdigen Politiker Johannes Paul II., der in Fragen der Moral ein Absolutist, in der Politik aber eher ein Relativist gewesen sei - von seiner Haltung zur Pädophilie innerhalb der Kirche ganz zu schweigen. Auch Domoslawski steht der Seligsprechung kritisch gegenüber, will sich aber hüten, als Nichtgläubiger dem Papst Ratschläge zu erteilen: "Sehr wohl betrachtet der Nichtgläubige aber jene gänzlich zum Diesseits und zur Gegenwart gehörende Sphäre, in die der Prozess der Seligsprechung - aufgrund des bloßen Gewichts dieses Aktes - eindringt. (...) Für den Nichtgläubigen ist die Seligsprechung eine Art monumentales, symbolisches Denkmal. Karol Wojtyla war eine faszinierende historische Gestalt, in deren Denken und Taten sich eine ganze Reihe wichtiger ethischer, politischer und historischer Debatten verdichtet. Von nun an wird sich vor allem der national-religiöse Kitsch in ihm verdichten. Bedauerlicherweise sogar für den Nichtgläubigen." Das Internationale Gerichtshof in Den Haag hat den kroatischen General Ante Gotovina zu 24 Jahren Gefängnisstrafe verurteilt - und dabei auch den inzwischen verstorbenen früheren kroatischen Staatschef Franjo Tudjman für schuldig befunden. Die liberale Wochenzeitschrift Magyar Narancs rekapituliert die Ereignisse vom August 1995, als die kroatische Armee im Rahmen der "Operation Sturm" Gebiete von der separatistischen "Republik Serbische Krajina" zurückeroberte und dabei die Stadt Knin beschoss. Auf den ersten Blick - und dies geht zunächst auch aus der Urteilsbegründung hervor - führte der kroatische General Gotovina einen gerechten Krieg gegen die Eroberer. Doch auch ein gerechter Krieg hat seine Regeln: "Weder der gerechte Krieg, noch das viele Leiden, das die serbischen Separatisten einem Teil der kroatischen Bevölkerung ab 1990 zugefügt hatten, können eine ethnische Säuberung rechtfertigen. Doch genau das ist dem Urteil zufolge während der 'Operation Sturm' geschehen. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass man mit dem Beschuss der Städte in der Krajina - allen voran Knins - nicht militärische Ziele vernichten, sondern die serbische Bevölkerung einschüchtern wollte... Unabhängig von ihrem persönlichen Schicksal oder von ihren politischen Ansichten, unabhängig davon, was sie von diesem Martic-Staat hielten - sie mussten fliehen, nur aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, nur, weil der kroatische Staatschef sie kollektiv für schuldig erklärt hatte. Oder sie mussten sterben. Diese Absicht geht auch aus den Protokollen jener Besprechung hervor, die unmittelbar vor der Aktion auf höchster Ebene stattfand. Es gibt keine Gerechtigkeit, die solch eine Politik oder die Beteiligung an ihrer konkreten Umsetzung rechtfertigen würde."
Literaturen (Deutschland), 01.05.2011
 Auf dem Titel des neuen Literaturen-Hefts findet sich Marshall McLuhan. Von den Artikeln dazu - darunter der Nachdruck eines Gesprächs von Tom Wolfe mit dem Medientheoretiker - gibt es nur einen Abriss von Leben und wichtigen Büchern im Netz.
Auf dem Titel des neuen Literaturen-Hefts findet sich Marshall McLuhan. Von den Artikeln dazu - darunter der Nachdruck eines Gesprächs von Tom Wolfe mit dem Medientheoretiker - gibt es nur einen Abriss von Leben und wichtigen Büchern im Netz.Hingerissen berichtet Jutta Person von einem Hausbesuch bei der Literaturwissenschaftlerin und seit einigen Jahren auch belletristisch tätigen Silvia Bovenschen, die gerade den Roman "Wie geht es Georg Laub?" vorgelegt hat: "Im grünen Salon wird es dämmriger, aber die Gedanken- und Wortblitze reißen keineswegs ab. Silvia Bovenschen erklärt mit Verve, was sie unter 'Gefühlsschleim' versteht. Solche Sprünge - von den Menschheits-Themen zur schmissigen Pointe - durchziehen nicht nur die Essays und Streitschriften, sondern auch das Gespräch. Apropos Menschheit: Die Literaturwissenschaftlerin hatte immer auch Tiere im Blick, und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Tier-Mensch-Differenz noch längst nicht zum kulturwissenschaftlichen Mode-Thema avanciert war."
Weitere Artikel: Frauke Meyer-Gosau gratuliert dem Verlag dtv zum Fünfzigsten. Ronald Düker stellt ein Buch über Alex Steinweiss, den Erfinder des modernen Album-Covers, vor. Patrick Bahners bespricht Dave Eggers' Katrina-Reportage "Zeitoun".
Prospect (UK), 20.04.2011
 Auf die Frage, was er täte, könnte er die Welt regieren, hat der Historiker Niall Ferguson, der selbst, wie er erklärt, nicht einmal seinen Hund kommandieren wollte und konnte, eine recht bestechende Antwort: "Ich würde meine Macht für die Dauer von höchstens einer Woche nutzen, um alle traditionellen Herrschaftssysteme auszumerzen und veraltete Hierarchiemodelle durch Netzwerke zu ersetzen. Ich begänne mit der Absetzung aller Autokraten und gäbe ihren ehemaligen Untertanen eine einfache Verfassung nach dem Modell derjenigen der Vereinigten Staaten. Ich würde dann auf einen Schlag alle sich herrschaftlich gebärdenden Wirtschaftsführer der Weltwirtschaft auf einen Schlag in den Ruhestand schicken und ihre Macht an Exekutivkommittees übergeben - ich wäre im übrigen versucht, mir als ersten Michael O'Leary von Ryanair vorzuknöpfen. Jetzt mögen Sie sagen, dies sei ein Rezept für Anarchie. Aber nein - da die Herrschaft des Rechts die eine Form der Herrschaft ist, die ich beibehalten würden... Und es gäbe noch genug Raum für Führung - eine ganz andere Sache als Herrschaft."
Auf die Frage, was er täte, könnte er die Welt regieren, hat der Historiker Niall Ferguson, der selbst, wie er erklärt, nicht einmal seinen Hund kommandieren wollte und konnte, eine recht bestechende Antwort: "Ich würde meine Macht für die Dauer von höchstens einer Woche nutzen, um alle traditionellen Herrschaftssysteme auszumerzen und veraltete Hierarchiemodelle durch Netzwerke zu ersetzen. Ich begänne mit der Absetzung aller Autokraten und gäbe ihren ehemaligen Untertanen eine einfache Verfassung nach dem Modell derjenigen der Vereinigten Staaten. Ich würde dann auf einen Schlag alle sich herrschaftlich gebärdenden Wirtschaftsführer der Weltwirtschaft auf einen Schlag in den Ruhestand schicken und ihre Macht an Exekutivkommittees übergeben - ich wäre im übrigen versucht, mir als ersten Michael O'Leary von Ryanair vorzuknöpfen. Jetzt mögen Sie sagen, dies sei ein Rezept für Anarchie. Aber nein - da die Herrschaft des Rechts die eine Form der Herrschaft ist, die ich beibehalten würden... Und es gäbe noch genug Raum für Führung - eine ganz andere Sache als Herrschaft."In einem weiteren Artikel sieht Anthony Lloyd nach drei Wochen in der libyschen Rebellenhochburg Bengasi die Revolutionsbewegung nicht nur unter militärischem Druck, sondern auch aufgrund ihrer inneren Heterogenität kurz vor der Implosion.
Open Democracy (UK), 27.04.2011
 Orthodoxe jüdische Feministinnen? Gibt es, schreibt Cassandra Balchin in einem hochinteressanten Artikel. Die Antifeministen sind die Ultraorthodoxen, die in einer komplizierten Gemengelage mit rechten Nationalisten zusammengehen. Und alle möchten sie, dass Frauen sich bescheiden kleiden, zu Hause bleiben und gebären. Dagegen formieren sich orthodoxe Frauen wie zum Beispiel Dr. Debbie Weissman, die zur Gruppe Kolech: Religious Women's Forum gehört und mehr Rechte für Frauen fordert. "Ein wichtiges Thema für Kolech ist die belastete Frage von Kleidung und Bescheidenheit - familiäres Territorium für muslimische Feministinnen und immer häufiger auch christlich-evangelikale Gemeinschaften. Weissman sieht die Ironie, die darin liegt, dass man 'die Religiosität von Mädchen daran misst, wie lang ihre Kleiderärmel sind: ob sie den Ellbogen bedecken oder nicht? Ob dieser Rock das Knie bedeckt oder nicht? In diesem Moment denkt und spricht man so viel über den weiblichen Körper, dass man das Gegenteil dessen erreicht, was man will.'"
Orthodoxe jüdische Feministinnen? Gibt es, schreibt Cassandra Balchin in einem hochinteressanten Artikel. Die Antifeministen sind die Ultraorthodoxen, die in einer komplizierten Gemengelage mit rechten Nationalisten zusammengehen. Und alle möchten sie, dass Frauen sich bescheiden kleiden, zu Hause bleiben und gebären. Dagegen formieren sich orthodoxe Frauen wie zum Beispiel Dr. Debbie Weissman, die zur Gruppe Kolech: Religious Women's Forum gehört und mehr Rechte für Frauen fordert. "Ein wichtiges Thema für Kolech ist die belastete Frage von Kleidung und Bescheidenheit - familiäres Territorium für muslimische Feministinnen und immer häufiger auch christlich-evangelikale Gemeinschaften. Weissman sieht die Ironie, die darin liegt, dass man 'die Religiosität von Mädchen daran misst, wie lang ihre Kleiderärmel sind: ob sie den Ellbogen bedecken oder nicht? Ob dieser Rock das Knie bedeckt oder nicht? In diesem Moment denkt und spricht man so viel über den weiblichen Körper, dass man das Gegenteil dessen erreicht, was man will.'"Weitere Artikel: Ekaterina Loushnikova besucht den hundertjährigen, äußerst agilen, Internet surfenden und bloggenden Kolyma-Überlebenden Pavel Galitsky. Anna Babinets erzählt, wie Agrarminister Mykola Prisyazhnyuk mittels einer mysteriösen Agentur den Weizenhandel in der Ukraine unter seine Kontrolle bringt. Mikhail Zakharov diagnostiziert einen handfesten Rassismus in Russland. Marie Gilbert findet es reichlich seltsam, dass so viele englischsprachigen Feministinnen den Niqab verteidigen.
New York Times (USA), 01.05.2011
In "33 Revolutions per Minute" erzählt Dorian Lynskey die Geschichte der Protestsongs. Sean Wilentz freut sich, dass dabei immerhin einige, wenn auch nicht alle Mythen über Pete Seegers, Bob Dylan, John Lennon oder M.I.A zertrümmert werden: "Lynskey schreibt sehr schön darüber, wie Wut oder sogar Hysterie, einmal kanalisiert, solch überwältigende Lieder wie Nina Simones 'Mississippi Goddam' hervorbringen können. Er ist am besten, wenn es um Künstler geht, die normalerweise nicht zur Protestkultur gehören. Ein starkes Kapitel über John Brown und sein 'Say It Loud - I'm Black and I'm Proud' zeigt, wie der Godfather of Soul - der sich selbst auch Minister of New New Super Heavy Funk genannte hätte - zwischen seinen eigenen politischen Sympathien für Hubert Humphrey und den Anforderung schwarzer Loyalität gefangen wurde, die die Black-Power-Politik ihm in den Sechzigern auferlegte. 'Say It Loud' war das Ergebnis, ein funkiger Megahit mit gemischten politischen Botschaften."
Hier die wunderbare zornige Nina Simone:
Außerdem: Fernanda Eberstadt preist den hierzulande etwas untergangenen Roman "Schwarze Schwestern" der belgisch-nigerianischen Autorin Chika Unigwe. Paul M. Barrett weiß nach Lektüre von William Cohans "Money and Power", dass Goldman Sachs heute so gut dasteht, weil die Bank erst mit Subprime Krediten viel Geld gemacht hat und dann rechtzeitig auf einen Zusammenbruch des Marktes gewettet hat. Und Stephen Greenblatt liest Arthur Philipps Shakespeare-Roman "The Tragedy of Arthur".
Hier die wunderbare zornige Nina Simone:
Außerdem: Fernanda Eberstadt preist den hierzulande etwas untergangenen Roman "Schwarze Schwestern" der belgisch-nigerianischen Autorin Chika Unigwe. Paul M. Barrett weiß nach Lektüre von William Cohans "Money and Power", dass Goldman Sachs heute so gut dasteht, weil die Bank erst mit Subprime Krediten viel Geld gemacht hat und dann rechtzeitig auf einen Zusammenbruch des Marktes gewettet hat. Und Stephen Greenblatt liest Arthur Philipps Shakespeare-Roman "The Tragedy of Arthur".
Kommentieren








