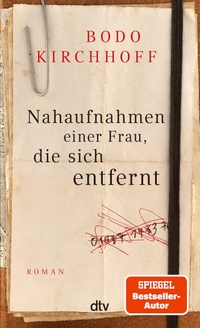Außer Atem: Das Berlinale Blog
Berlinale 4. Tag
Von Thekla Dannenberg, Thomas Groh
09.02.2009. Maren Ades Wettbewerbsfilm "Alle Anderen" erkundet jede mögliche Gasse und Sackgasse zwischen Ironie und Postironie. Michael Glawoggers "Das Vaterspiel" schlägt Funken. Die "Geschichte des israelischen Kinos" von Raphael Nadjari ist mit dreieinhalb Stunden einfach zu kurz. Dominic Murphy feiert in "White Lightning" einen drogensüchtigen steppenden Psychopathen. Luc Moodyssons Film "Mammoth" findet's zu Hause doch am schönsten.Erkundet jede mögliche Gasse und Sackgasse zwischen Ironie und Postironie: Maren Ades "Alle Anderen" (Wettbewerb)
Wo befinden wir uns? Auf Sardinien. Und wie befinden wir uns? Oje, längere Geschichte.
Vielleicht fängt man am besten mit Herbert Grönemeyer an, ausgerechnet. Kürzlich las ich ein Interview, das Jens Balzer mit Antony Hegarty führte, für die Spex. Antony Hegarty - bekannt als Sänger von "Antony and the Johnsons" - wird derzeit sehr gefeiert als Transgender-Künstler, der Künstlichkeit und Pathos zu bewegenden Songs zu verbinden versteht. Im erwähnten Interview kommt Balzer auf eine Zusammenarbeit Hegartys mit Herbert Grönemeyer zu sprechen (sic!) und Hegarty fragt in aller postironischen Unschuld zurück: Finden Sie Grönemeyer etwa nicht gut? Balzers schriftliche Antwort lautet, aus der Erinnerung, ungefähr: "Hmmm..."

Musik von Grönemeyer ist in einer der dichtesten Szenen von Maren Ades Film "Alle anderen" zu hören. Es geht um Liebe, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, ich finde Grönemeyer ja auch unerträglich. So einfach ist das hier aber nicht. Versammelt sind im Zimmer der Eltern von Chris (Lars Eidinger) die vier Personen, auf die sich - alle anderen aussparend - Maren Ade in aller Radikalität konzentriert. Diese dramatis personae sind: Chris, ein nach allem was wir erfahren, zwar brillanter, aber wegen Kompromisslosigkeit nicht sehr erfolgreicher Künstler. Seine Freundin Gitti (Birgit Minichmayr), PR-Frau bei der Musikfirma Universal. Die beiden stehen, bis zur Klaustrophobie, im Zentrum des Films. Als Reflektorfiguren eher denn als wirklich gleichberechtigte Spielpartner agieren Hans (Hans-Jochen Wagner), ein kompromissbereiterer Künstler mit sehr viel mehr Erfolg, und seine Freundin Sana (Nicole Marischka), eine offenkundig auch eher gefragte Modedesignerin.
Bei zwei Abendeinladungen begegnen sich die beiden Paare und bei beiden Gelegenheiten werden zuvor in geradezu übergenauen Details latent bleibende Probleme von Chris und Gitti manifest. Sie sprechen hier aus, was ihnen sonst auszusprechen nicht gelingt. Auf hohem Niveau nicht gelingt und immerzu nicht gelingt und teils sehr wortreich nicht gelingt. In gewisser Weise geht es nämlich immerzu um nichts anderes als das: einen Ausdruck zu finden für das, was man empfindet; oder sich im Ausdrücken klar darüber zu werden, wie es einem mit dem anderen eigentlich geht. Darum, weil hier nichts gesagt werden muss, ist die Musik auch so wichtig (mehrfach im Film). In der erwähnten Grönemeyer-Szene facettieren sich die Reaktionsmuster auf aufschlussreiche Weise: Während Sana Grönemeyers sehr direkte und eben auch sehr grobe Gefühlsansprache einfach gut findet (aber weiß, dass sie nicht dürfte) - und Hans Herbert Grönemeyer (und Sanas Reaktion) einfach peinlich ist ("Folter"), sieht man Chris und Gitti genau in jener unentschiedenen Mittellage der Gefühle zwischen Ironie und Postironie, die auch ihre Beziehungs- und Streitkultur bestimmt. Sie finden es, kurz gesagt, eher arrogant, ihr Wissen darum, dass Grönemeyer peinlich ist, gegenüber Sana zum Ausdruck zu bringen und verachten deshalb eher Hans, auf dessen Seite sie geschmackshalber eigentlich stehen.

Die beiden sind Virtuosen des Spielerischen, des Nicht-Ganz-Ernstnehmens, des Verlagerns ihrer Gefühle und Probleme auf Ersatzobjekte (eine Ingwerwurzel namens Schnappi ist da von einiger Bedeutung). Auf diese Weise verstehen sie sich gut, können aber selbst nie so genau sagen, ob man sich auf diese Weise überhaupt wirklich verstehen kann. Wie zum Beispiel kann man sich ironisch streiten? Und wie sagen, was man meint, ohne immer die Ausflucht offenzuhalten, dass es so ja gar nicht gemeint war? Und wie gelangt man zu einem postironischen Ernst, ohne auf die Grobheiten des exemplarischen Gegenpaars Sana und Hans zurückzufallen? Lässt sich gar - und das ist eine Frage, die nicht nur das Paar, sondern unweigerlich auch den ganzen Film betrifft - mit einem postironischen Pathos von all diesen Verwicklungen dann ganz direkt wieder so singen, wie das Antony Hegarty gelingt?
Dies zu tun, also noch einmal eine andere Verständigungsebene zu finden, das gelingt Chris und Gitti nicht. Darum hat der Film auch ein offenes Ende. Und weil auch Maren Ade aus dem postironischen Dilemma keinen anderen Ausweg findet, als den, aber auch jede mögliche Gasse und Sackgasse zu erkunden, bleibt "Alle anderen" zwar eine hoch virtuose Angelegenheit, zu der überdies Birgit Minichmayr als Gitti hinzutut, was sie an schauspielerischem Herzblut zu bieten hat. Hinaus aber aus dem ewigen Kreisen und Schwanken und der passiv-agressiven Ironie dieses Lebens findet der Film nicht. Er ist eine ungeheuer genaue und geduldige und darum immer wieder faszinierende Diagnose von Befindlichkeiten, deren sozialer und ästhetischer Ort genau angebbar ist. Man kann das "Alle Anderen" zum Vorwurf machen - muss dabei aber schon selbst sagen, von wo aus genau man selbst blickt oder spricht.
Ekkehard Knörer
Maren Ade: "Alle Anderen". Mit Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Hans Jochen Wagner, Nicole Marischka. Deutschland, 2009, 119 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Schlägt Funken: Michael Glawoggers Verfilmung von Josef Haslingers Roman "Das Vaterspiel" (Panorama)
 Ratz wohnt in Wien, ist studierter Publizist, aber schon während seines Studiums, Anfang der achtziger Jahre, saß er viel lieber vor dem damals noch sehr primitiven Computer. Jetzt, Jahre nach seinen ersten Programmierübungen, hat er im Alleingang ein Computerspiel entworfen. "Vaterspiel" nennt er dieses Spiel und es ist eine ödipale-Splatterfantasie: Der Spieler lädt ein Bild seines Vaters auf den Rechner und kann seinen digitalisierten Erzeuger dann hundertfach um die Ecke bringen. In erster Linie agiert Ratz mit "Vaterspiel" seinen Hass auf den Vater aus, einen sozialdemokratischen Politiker, der für seinen guten Ruf in der Öffentlichkeit alle familiären Probleme gnadenlos unter den Teppich kehrt.
Ratz wohnt in Wien, ist studierter Publizist, aber schon während seines Studiums, Anfang der achtziger Jahre, saß er viel lieber vor dem damals noch sehr primitiven Computer. Jetzt, Jahre nach seinen ersten Programmierübungen, hat er im Alleingang ein Computerspiel entworfen. "Vaterspiel" nennt er dieses Spiel und es ist eine ödipale-Splatterfantasie: Der Spieler lädt ein Bild seines Vaters auf den Rechner und kann seinen digitalisierten Erzeuger dann hundertfach um die Ecke bringen. In erster Linie agiert Ratz mit "Vaterspiel" seinen Hass auf den Vater aus, einen sozialdemokratischen Politiker, der für seinen guten Ruf in der Öffentlichkeit alle familiären Probleme gnadenlos unter den Teppich kehrt.
Mimi hat keinen Vater mehr, aber einen Großvater. Der lebt seit vielen Jahren in einem New Yorker Keller und darf nicht nach draußen. Der Ukrainer ist ein gesuchter Kriegsverbrecher, er war, das behauptet jedenfalls sein Ankläger, dem der Film in einer zunächst verwirrenden Parallelmontage Stimme verleiht, ein Anführer der ukrainischen Hilfstruppen, die den Deutschen im Zweiten Weltkrieg einen Teil der Drecksarbeit abgenommen haben. Mimi möchte das Kellerverließ, in dem ihr Großvater lebt, angenehmer gestalten. Es soll ausgebaut werden. Und da erinnert sich Mimi an Ratz, einen Bekannten aus der Studienzeit.
 Ein Anruf genügt und Ratz fliegt nach New York. Viel hält ihn nicht in Österreich. Der Hass auf seinen Vater hat längst pathologische Züge angenommen und dominiert sein Leben in jeder Hinsicht. Während diverser Autofahrten - im Film unterlegt mit modernistischer Streichermusik - halluziniert er sich abschießbare Vater-Avatare herbei, die alle gleich aussehen und bei jedem Treffer spritzt das Blut. Nach New York treibt ihn außerdem einerseits die Erinnerung an Mimi, wie sie nackt, mit keinem einzigen Haar am Körper (sie leidet unter Alopecia congenita) in einer halbgestrichenen Wohnung steht, andererseits die Hoffnung, in Amerika mit seinem "Vaterspiel" Geld verdienen zu können.
Ein Anruf genügt und Ratz fliegt nach New York. Viel hält ihn nicht in Österreich. Der Hass auf seinen Vater hat längst pathologische Züge angenommen und dominiert sein Leben in jeder Hinsicht. Während diverser Autofahrten - im Film unterlegt mit modernistischer Streichermusik - halluziniert er sich abschießbare Vater-Avatare herbei, die alle gleich aussehen und bei jedem Treffer spritzt das Blut. Nach New York treibt ihn außerdem einerseits die Erinnerung an Mimi, wie sie nackt, mit keinem einzigen Haar am Körper (sie leidet unter Alopecia congenita) in einer halbgestrichenen Wohnung steht, andererseits die Hoffnung, in Amerika mit seinem "Vaterspiel" Geld verdienen zu können.
Freilich erfährt er erst nach seiner Ankunft, was Mimi genau von ihm erwartet. Aus der Konfrontation der blutrünstig ödipalen Fantasien eines Wiener Bürgersohns mit den grausamen Fakten der Judenvernichtung erwächst im Folgenden die eigenartige Dynamik dieses Films. Zunächst gibt es nicht einfach nur eine Gegenwart. Es gibt die in Österreich und die in den USA, es gibt eine psychische in Ratzens Kopf, eine digitale in seinen Videospielen. Alle diese Gegenwarten hängen miteinander zusammen, gehen aber nie organisch auseinander hervor. Außerdem sind da noch die Rückblenden in die frühen Achtziger, in eine Zeit, in der die Vergangenheit noch viel unmittelbarer im politischen, studentischen Aktivismus aufscheint.
Natürlich kann es in einem Film wie "Vaterspiel" nicht ebensoviele Vergangenheiten wie Gegenwarten geben. Die Tatsache der Judenvernichtung steht nicht zur Diskussion, für keinen der Beteiligten. In einer symptomatischen Szene wird das Aussageprotokoll des Anklägers von mehreren Hauptfiguren gemeinsam verlesen. Was der Film dann aber macht, ist, dass er von diesem einen Fixpunkt aus zahlreiche, oft sehr eigenartige Linien zieht in die Gegenwart und jüngere Vergangenheit. Und was am Ende dieser Linien steht, das reibt sich aneinander und schlägt manchmal ganz sonderbare Funken.
Lukas Foerster
Michael Glawogger: "Das Vaterspiel". Mit Helmut Köpping, Ulrich Tukur, Sabine Timoteo, Christian Tramitz. Deutschland, Österreich, Frankreich 2008, 117 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Raphael Nadjari erzählt die Geschichte des israelischen Kinos (Forum)
In seiner Geschichte des israelischen Kinos lässt der 1971 in Marseille geborene Raphael Nadjari dreieinhalb Stunden lang einfach nur übers Kino reden. Filmhistoriker und Kritiker, Regisseure und Schauspieler sitzen vor der Kamera und erzählen von bedeutenden Filmen, von denen dann wiederum eine durchaus längere und aussagekräftige Sequenz gezeigt wird. Aber wie Nadjari dabei die gesamte israelische Kultur- und Kriegsgeschichte miterzählt, wie die Filmemacher und ihre Kritiker dabei über künstlerisches Selbstverständnis und die Rolle in der Gesellschaft nachdenken, über Filmsprache und Kommerz, über Zionismus und Individualismus, über die Besatzung und schwule Erotik, über Einwanderung und Rassismus, ergibt ein solch reichhaltiges Bild eines Landes und seines Kinos, dass man sich fragt, ob seine Dokumentation nicht etwas zu kurz ausfällt.
Der Film besteht aus zwei Teilen. Der erste umfasst den Zeitraum von 1932-1978, und hier haben noch vorrangig die Historiker das Wort, was den Rückblick nicht zwangsläufig spröde macht. Denn die lebhafte Diskussion geht gleich los. Wann beginnt der israelische Film. Und wo? Mit der Gründung Israels? Mit jüdischen Filmemachern in Europa? Mit dem Zionismus? Man einigt sich auf Chaim Halachmis "Oded, der Wanderer", der erste, dem Zionismus verschriebene Film, in dem jüdischen Einwanderern die Pracht und die Herrlichkeit der jüdäischen Heimat vorgeführt wurde.

Bis Ende der sechziger Jahre, muss man nach dieser Filmgeschichte zumindest sagen, stellt Otto Premingers von Ben Gurion höchstpersönlich gefördertes Einwanderunsgdrama "Exodus" für lange Zeit den Höhepunkt des israelischen Kinos dar, das bis dahin vor allem aus zionistischen Propaganda-Filmen über den neuen jungen und kräftigen Sabre oder Ephraim-Kishons Komödien über desorientierte Einwanderer wie etwa "Sallah Shabati" bestand. Das große das Trauma, der Holocaust, spielt absolut keine Rolle (und wird es auch später nicht tun). Die flachen Gewässer verließen ab 1967 israelische Autorenfilmer wie Uri Zohar (der später zum Chassidentum übertrat). Sie stellten sich in dieser kollektivistischen Gesellschaft, der jeglicher individueller Liberalismus fremd war, erstmals existenzialistische Fragen. Und auch wenn die israelischen Produzenten lieber auf populäre Komödien über das komplizierte aschkenasisch-sephardische Miteinander setzten - nach dem in seiner Herkunft umstrittenen Gebäck "Bourekas" genannt -, ließ sich das neue Kino nicht mehr aufhalten.
In diesem zweiten Teil, der den Zeitraum von 1979 bis 2007 umfasst, wird Nadjaris Dokumentation noch einmal viel spannender. Denn nun sprechen nicht nur die Historiker, sondern die Regisseure und Schauspieler selbst, die Filme werden drängender: Der Filmemacher David Perlov klagte in seinem dokumentarisch-poetischen "Diary" den Zynismus an, mit dem der Entebbe-Mythos kommerzialisiert wurde. Yehuda Judd Ne'eman (mehr hier) zeigte in seinem Film "Paratroopers" die Brutalität innerhalb der israelischen Armee, Daniel Wachsman in "Transit", wie unwohl sich ein Jude in Israel fühlen kann und Ram Levy in "Hirbeth Hizzath" die Gewalt gegenüber den Palästinensern (mehr hier): "New Sensitivity" lautete das Schlagwort.
Uri Barbash erzählt von seinem 1992 gedrehten Film "Beyond the Walls", der die Freundschaft zwischen einem Israeli und einem palästinensischen Terroristen zum Thema hat - und den Barbash heute nicht noch einmal drehen würde. Avi Mograbi, der im Gefängnis gesessen hat, weil er den Kriegsdienst im Libanon verweigerte, spricht über die Schwierigkeit, nicht nur politisch richtiges, sondern gutes Kino zu machen. Den Gipfel des politischen Kinos erreichte unbestritten Assi Dayan, als Sohn des Kriegshelden Moshe Dayan eigentlich der "ultimative Israeli". Doch in "Life According to Agfa" schlug er alles entzwei: IDF-Soldaten massakrieren sämtliche Gäste in einem Alternativ-Lokal, weil sie sich beleidigt fühlten. Dieses Land, so Dayans Botschaft, hat so viel Gewalt produziert, dass sie sich nach innen und gegen sich selbst richten muss.
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wendet sich das Kino von der Politik ab, wird autobiografischer, persönlicher, individualistischer. Und während Amos Gitai in Filmen wie "Kadosh" an die Entzauberung der Religion macht, treten ultra-orthodoxe Filmemacher auf den Plan, die die "Realität von Gott" zeigen wollen, aber auch georgische Einwanderer wie Dover Kosashvili, feministische Filmemacherinnen wie Ronit Elkabetz (mehr hier) und die palästinensischen Regisseure Hany Abu-Assad mit "Paradise Now" und Tawfik Abu Wael mit "Thirst". Das Erstaunliche an dieser Dokumentation ist, dass man auch nach dreieinhalb Stunden nicht genug vom israelischen Kino hat, sondern gleich in eine gute Videothek gehen möchte, um sich mindestens drei Filme auszuleihen.
Thekla Dannenberg
Raphael Nadjari: "A History of Israeli Cinema". Dokumentarfilm. Frankreich/Israel 2009, 210 Minuten. (Alle Vorführtermine, mehr hier)
Genüsslich sadistisch: Dominic Murphys "White Lightning" (Panorama)
Es soll Kreise geben, in denen ein gewisser Jesco White Kultstatus genießt. Der Mann ist schwerst drogensüchtig, lebt mit seiner dysfunktionalen Familie in einem Wohnwagen und tourt als "Dancing Outlaw" durch die Kneipen West Virginias. Hier trägt man die Holzfällerhemden offen, Cowboyhut und schwarze Zähne, mit Schwarzen will man lieber nichts zu tun haben, aber wenn eine Frau den Country-Schlager "It wasn't God who made honky tonk angels" singt, ist die gesamte Trinkhalle zu Tränen gerührt. Jescos Spezialität ist der appalachische Bergtanz, eine in dieser vernachlässigten und übel beleumundeten Region offenbar heimische Verbindung aus Stepptanz und Clogging. Und wie der britische Regisseur Dominic Murphy nach der Vorführung versichert, ist Jesco White "geisteskrank": "Aber wenn man ihn trifft, verliebt man sich sofort in ihn. Er ist wirklich liebenswert." In seinem Film "White Lightning" hat Murphy leider vergessen, das zu erwähnen. Hier ist Jesco White einfach nur ein schnüffelnder, gewalttätiger Psychopath, der einem so zuwider ist, dass man ihm und dem Film ein schnelles Ende wünscht.

Doch Murphy präsentiert ein ganzes Leben voller drogeninduzierter Gewalttaten und religiösem Wahn mit Genuss. In schwarzweißen, verzerrten und grobkörnigen Bildern, unterlegt mit extralautem Hardmetall oder dem Country von Hasil Adkins. Der Junge ist noch keine zehn, da schnüffelt er schon und landete immer wieder in der Besserungsanstalt, seine Eltern sind echter White Trash. Ein Biker verpasst dem Jungen einen Heroinschuss und bringt ihn damit auf einen Horrortrip, der für mehrere Jahre in der Irrenanstalt anhalten wird. Der Vater wird später auf brutale Art ermordet werden, aber das Tanzen hat er seinem Sohn noch beigebracht. Und so steppt er in den appalachischen Spelunken und wenn er gerade einen Rückfall hat, quält er entweder seine Freundin, schlitzt sich selbst die Arme mit einer zerbrochenen Flasche auf oder ermordet auf bestialische Weise die wieder aus dem Gefängnis entlassenen Mörder seines Vaters. Immer sadistischer und unrealistischer und ekelerregender werden die Brutalitäten in diesem Film, dass man sich wirklich ärgert, dass Murphy dafür so eine arme Type aus den Apalachen vorschiebt. Man ist nur froh, wenn dieser völlig sinnlose Horrorrip vorbei ist. Seltsamer Jubel aus dem Publikum.
Thekla Dannenberg
Dominic Murphy: "White Lightnin'". Großbritannien, USA, Kroatien, 2008. Mit Edward Hogg, Carrie Fisher, Muse Watson und anderen. 90 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Tief betroffen: Lukas Moodyssons "Mammoth" (Wettbewerb)
 Lukas Moodysson hat etwas entdeckt. Dass es in New York und auf den Philippinen Familien gibt. Dass es Globalisierung gibt. Dass hier wie dort gearbeitet wird. Dass es ein Wohlstandsgefälle gibt. Hier Überschuss, dort Mangel. Und dass es selbst im Mangel noch Unterschiede zwischen wenig und ganz erbärmlich wenig gibt. Und dass oft Kinder die Leidtragenden sind. Und dass das irgendwie alles miteinander zu tun hat. Muss man nur die Familien aneinander legen. Dann sieht man das. Deshalb hat Lukas Moodysson einen Film drüber gemacht.
Lukas Moodysson hat etwas entdeckt. Dass es in New York und auf den Philippinen Familien gibt. Dass es Globalisierung gibt. Dass hier wie dort gearbeitet wird. Dass es ein Wohlstandsgefälle gibt. Hier Überschuss, dort Mangel. Und dass es selbst im Mangel noch Unterschiede zwischen wenig und ganz erbärmlich wenig gibt. Und dass oft Kinder die Leidtragenden sind. Und dass das irgendwie alles miteinander zu tun hat. Muss man nur die Familien aneinander legen. Dann sieht man das. Deshalb hat Lukas Moodysson einen Film drüber gemacht.
Die Familie in New York lebt im Überfluss. Penthouse, Kühlschrank kunterbunt randvoll (trotzdem Pizza bestellen), in den Regalen Bücher (ungelesen?) und Platten, unanständig viel Raum zur Seite, nach oben. Das Trimm-Dich-Gerät steht oben auf dem Dach. Mutter Ärztin, leidet unter Schlafmangel, Vater, Computerspiele-Bastler und irgendwas mit Web 2.0, daher der Reichtum. Tochter? Bilderbuch-brav, Bilderbuch-Herz-aus-Gold, neugierig auf die Welt, der Traum jedes Was-ist-was-Buchverlegers. Eine Welt wie ein Kokon, abgeschirmt vor allem und jedem, nach innen wattig, aber doch irgendwie schnucklig-gut.
 Angelpunkte: Das mütterliche Kindermädchen (auch mit Herz-aus-Gold-Verdacht) von den Philippinen, für die Tochter ein Ticket in eine Welt der Primärerfahrung, und die Geschäftsreise des Vaters nach Thailand. Sie arbeitet hier - für Jahre, wie ihr Sohn in der Heimat dem kleinen Bruder erklärt -, damit die Familie zu Hause sich ein Haus bauen kann. Er, der er auch so irgendwie ein Herz aus Gold zu haben scheint, fliegt nach Thailand, um etwas zu unterschreiben, was der Web2.0-Spielefirma noch viel mehr Geld einbringen wird. Auf der Reise überreicht ihm sein Berater einen obszönen Kugelschreiber: Mit Mammut-Elfenbein besetzt. 3.000 Dollar. Damit er den Vertrag gediegen unterschreiben kann.
Angelpunkte: Das mütterliche Kindermädchen (auch mit Herz-aus-Gold-Verdacht) von den Philippinen, für die Tochter ein Ticket in eine Welt der Primärerfahrung, und die Geschäftsreise des Vaters nach Thailand. Sie arbeitet hier - für Jahre, wie ihr Sohn in der Heimat dem kleinen Bruder erklärt -, damit die Familie zu Hause sich ein Haus bauen kann. Er, der er auch so irgendwie ein Herz aus Gold zu haben scheint, fliegt nach Thailand, um etwas zu unterschreiben, was der Web2.0-Spielefirma noch viel mehr Geld einbringen wird. Auf der Reise überreicht ihm sein Berater einen obszönen Kugelschreiber: Mit Mammut-Elfenbein besetzt. 3.000 Dollar. Damit er den Vertrag gediegen unterschreiben kann.
Der Mammutfüller gibt dem Film nicht nur seinen Namen, er dient auch als Stichwortgeber für manche Philosophiererei auf Sparflamme, wie hier überhaupt sehr viel auf Sparflamme gestellt ist, wenn's um Wesentliches geht. Die Sparflamme freilich wird hinter viel Bohei versteckt, hinter Betroffenheitsgeheische (Kinderprostitution ist schlimm), einer brutalen Melodramatik (tote, geschundene Kinder gehen immer) und einer plumpen Eva-Hermann'schen Schlussagitation (Mutter, bleib bei deinem Kinde!), dass man Reißaus nehmen möchte vor soviel simplen Postkartengrüßen aus der Welt des zurecht gezimmerten Elends, in der am Ende jede Erbse wieder im eigenen Töpfchen landet: Alle sind wieder im je eigenen Land. Wie gut, dass wir uns haben, besser gewesen wär's, wir hätten nie rausgeschaut.
Thomas Groh
Lukas Moodysson: "Mammoth". Mit Gael Garcia Bernal, Michelle Williams, Sophie Nyweide, Tom McCarthy, Marife Necesito. Schweden, Deutschland, Dänemark 2009, 120 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Wo befinden wir uns? Auf Sardinien. Und wie befinden wir uns? Oje, längere Geschichte.
Vielleicht fängt man am besten mit Herbert Grönemeyer an, ausgerechnet. Kürzlich las ich ein Interview, das Jens Balzer mit Antony Hegarty führte, für die Spex. Antony Hegarty - bekannt als Sänger von "Antony and the Johnsons" - wird derzeit sehr gefeiert als Transgender-Künstler, der Künstlichkeit und Pathos zu bewegenden Songs zu verbinden versteht. Im erwähnten Interview kommt Balzer auf eine Zusammenarbeit Hegartys mit Herbert Grönemeyer zu sprechen (sic!) und Hegarty fragt in aller postironischen Unschuld zurück: Finden Sie Grönemeyer etwa nicht gut? Balzers schriftliche Antwort lautet, aus der Erinnerung, ungefähr: "Hmmm..."

Musik von Grönemeyer ist in einer der dichtesten Szenen von Maren Ades Film "Alle anderen" zu hören. Es geht um Liebe, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, ich finde Grönemeyer ja auch unerträglich. So einfach ist das hier aber nicht. Versammelt sind im Zimmer der Eltern von Chris (Lars Eidinger) die vier Personen, auf die sich - alle anderen aussparend - Maren Ade in aller Radikalität konzentriert. Diese dramatis personae sind: Chris, ein nach allem was wir erfahren, zwar brillanter, aber wegen Kompromisslosigkeit nicht sehr erfolgreicher Künstler. Seine Freundin Gitti (Birgit Minichmayr), PR-Frau bei der Musikfirma Universal. Die beiden stehen, bis zur Klaustrophobie, im Zentrum des Films. Als Reflektorfiguren eher denn als wirklich gleichberechtigte Spielpartner agieren Hans (Hans-Jochen Wagner), ein kompromissbereiterer Künstler mit sehr viel mehr Erfolg, und seine Freundin Sana (Nicole Marischka), eine offenkundig auch eher gefragte Modedesignerin.
Bei zwei Abendeinladungen begegnen sich die beiden Paare und bei beiden Gelegenheiten werden zuvor in geradezu übergenauen Details latent bleibende Probleme von Chris und Gitti manifest. Sie sprechen hier aus, was ihnen sonst auszusprechen nicht gelingt. Auf hohem Niveau nicht gelingt und immerzu nicht gelingt und teils sehr wortreich nicht gelingt. In gewisser Weise geht es nämlich immerzu um nichts anderes als das: einen Ausdruck zu finden für das, was man empfindet; oder sich im Ausdrücken klar darüber zu werden, wie es einem mit dem anderen eigentlich geht. Darum, weil hier nichts gesagt werden muss, ist die Musik auch so wichtig (mehrfach im Film). In der erwähnten Grönemeyer-Szene facettieren sich die Reaktionsmuster auf aufschlussreiche Weise: Während Sana Grönemeyers sehr direkte und eben auch sehr grobe Gefühlsansprache einfach gut findet (aber weiß, dass sie nicht dürfte) - und Hans Herbert Grönemeyer (und Sanas Reaktion) einfach peinlich ist ("Folter"), sieht man Chris und Gitti genau in jener unentschiedenen Mittellage der Gefühle zwischen Ironie und Postironie, die auch ihre Beziehungs- und Streitkultur bestimmt. Sie finden es, kurz gesagt, eher arrogant, ihr Wissen darum, dass Grönemeyer peinlich ist, gegenüber Sana zum Ausdruck zu bringen und verachten deshalb eher Hans, auf dessen Seite sie geschmackshalber eigentlich stehen.

Die beiden sind Virtuosen des Spielerischen, des Nicht-Ganz-Ernstnehmens, des Verlagerns ihrer Gefühle und Probleme auf Ersatzobjekte (eine Ingwerwurzel namens Schnappi ist da von einiger Bedeutung). Auf diese Weise verstehen sie sich gut, können aber selbst nie so genau sagen, ob man sich auf diese Weise überhaupt wirklich verstehen kann. Wie zum Beispiel kann man sich ironisch streiten? Und wie sagen, was man meint, ohne immer die Ausflucht offenzuhalten, dass es so ja gar nicht gemeint war? Und wie gelangt man zu einem postironischen Ernst, ohne auf die Grobheiten des exemplarischen Gegenpaars Sana und Hans zurückzufallen? Lässt sich gar - und das ist eine Frage, die nicht nur das Paar, sondern unweigerlich auch den ganzen Film betrifft - mit einem postironischen Pathos von all diesen Verwicklungen dann ganz direkt wieder so singen, wie das Antony Hegarty gelingt?
Dies zu tun, also noch einmal eine andere Verständigungsebene zu finden, das gelingt Chris und Gitti nicht. Darum hat der Film auch ein offenes Ende. Und weil auch Maren Ade aus dem postironischen Dilemma keinen anderen Ausweg findet, als den, aber auch jede mögliche Gasse und Sackgasse zu erkunden, bleibt "Alle anderen" zwar eine hoch virtuose Angelegenheit, zu der überdies Birgit Minichmayr als Gitti hinzutut, was sie an schauspielerischem Herzblut zu bieten hat. Hinaus aber aus dem ewigen Kreisen und Schwanken und der passiv-agressiven Ironie dieses Lebens findet der Film nicht. Er ist eine ungeheuer genaue und geduldige und darum immer wieder faszinierende Diagnose von Befindlichkeiten, deren sozialer und ästhetischer Ort genau angebbar ist. Man kann das "Alle Anderen" zum Vorwurf machen - muss dabei aber schon selbst sagen, von wo aus genau man selbst blickt oder spricht.
Ekkehard Knörer
Maren Ade: "Alle Anderen". Mit Birgit Minichmayr, Lars Eidinger, Hans Jochen Wagner, Nicole Marischka. Deutschland, 2009, 119 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Schlägt Funken: Michael Glawoggers Verfilmung von Josef Haslingers Roman "Das Vaterspiel" (Panorama)
 Ratz wohnt in Wien, ist studierter Publizist, aber schon während seines Studiums, Anfang der achtziger Jahre, saß er viel lieber vor dem damals noch sehr primitiven Computer. Jetzt, Jahre nach seinen ersten Programmierübungen, hat er im Alleingang ein Computerspiel entworfen. "Vaterspiel" nennt er dieses Spiel und es ist eine ödipale-Splatterfantasie: Der Spieler lädt ein Bild seines Vaters auf den Rechner und kann seinen digitalisierten Erzeuger dann hundertfach um die Ecke bringen. In erster Linie agiert Ratz mit "Vaterspiel" seinen Hass auf den Vater aus, einen sozialdemokratischen Politiker, der für seinen guten Ruf in der Öffentlichkeit alle familiären Probleme gnadenlos unter den Teppich kehrt.
Ratz wohnt in Wien, ist studierter Publizist, aber schon während seines Studiums, Anfang der achtziger Jahre, saß er viel lieber vor dem damals noch sehr primitiven Computer. Jetzt, Jahre nach seinen ersten Programmierübungen, hat er im Alleingang ein Computerspiel entworfen. "Vaterspiel" nennt er dieses Spiel und es ist eine ödipale-Splatterfantasie: Der Spieler lädt ein Bild seines Vaters auf den Rechner und kann seinen digitalisierten Erzeuger dann hundertfach um die Ecke bringen. In erster Linie agiert Ratz mit "Vaterspiel" seinen Hass auf den Vater aus, einen sozialdemokratischen Politiker, der für seinen guten Ruf in der Öffentlichkeit alle familiären Probleme gnadenlos unter den Teppich kehrt.Mimi hat keinen Vater mehr, aber einen Großvater. Der lebt seit vielen Jahren in einem New Yorker Keller und darf nicht nach draußen. Der Ukrainer ist ein gesuchter Kriegsverbrecher, er war, das behauptet jedenfalls sein Ankläger, dem der Film in einer zunächst verwirrenden Parallelmontage Stimme verleiht, ein Anführer der ukrainischen Hilfstruppen, die den Deutschen im Zweiten Weltkrieg einen Teil der Drecksarbeit abgenommen haben. Mimi möchte das Kellerverließ, in dem ihr Großvater lebt, angenehmer gestalten. Es soll ausgebaut werden. Und da erinnert sich Mimi an Ratz, einen Bekannten aus der Studienzeit.
 Ein Anruf genügt und Ratz fliegt nach New York. Viel hält ihn nicht in Österreich. Der Hass auf seinen Vater hat längst pathologische Züge angenommen und dominiert sein Leben in jeder Hinsicht. Während diverser Autofahrten - im Film unterlegt mit modernistischer Streichermusik - halluziniert er sich abschießbare Vater-Avatare herbei, die alle gleich aussehen und bei jedem Treffer spritzt das Blut. Nach New York treibt ihn außerdem einerseits die Erinnerung an Mimi, wie sie nackt, mit keinem einzigen Haar am Körper (sie leidet unter Alopecia congenita) in einer halbgestrichenen Wohnung steht, andererseits die Hoffnung, in Amerika mit seinem "Vaterspiel" Geld verdienen zu können.
Ein Anruf genügt und Ratz fliegt nach New York. Viel hält ihn nicht in Österreich. Der Hass auf seinen Vater hat längst pathologische Züge angenommen und dominiert sein Leben in jeder Hinsicht. Während diverser Autofahrten - im Film unterlegt mit modernistischer Streichermusik - halluziniert er sich abschießbare Vater-Avatare herbei, die alle gleich aussehen und bei jedem Treffer spritzt das Blut. Nach New York treibt ihn außerdem einerseits die Erinnerung an Mimi, wie sie nackt, mit keinem einzigen Haar am Körper (sie leidet unter Alopecia congenita) in einer halbgestrichenen Wohnung steht, andererseits die Hoffnung, in Amerika mit seinem "Vaterspiel" Geld verdienen zu können. Freilich erfährt er erst nach seiner Ankunft, was Mimi genau von ihm erwartet. Aus der Konfrontation der blutrünstig ödipalen Fantasien eines Wiener Bürgersohns mit den grausamen Fakten der Judenvernichtung erwächst im Folgenden die eigenartige Dynamik dieses Films. Zunächst gibt es nicht einfach nur eine Gegenwart. Es gibt die in Österreich und die in den USA, es gibt eine psychische in Ratzens Kopf, eine digitale in seinen Videospielen. Alle diese Gegenwarten hängen miteinander zusammen, gehen aber nie organisch auseinander hervor. Außerdem sind da noch die Rückblenden in die frühen Achtziger, in eine Zeit, in der die Vergangenheit noch viel unmittelbarer im politischen, studentischen Aktivismus aufscheint.
Natürlich kann es in einem Film wie "Vaterspiel" nicht ebensoviele Vergangenheiten wie Gegenwarten geben. Die Tatsache der Judenvernichtung steht nicht zur Diskussion, für keinen der Beteiligten. In einer symptomatischen Szene wird das Aussageprotokoll des Anklägers von mehreren Hauptfiguren gemeinsam verlesen. Was der Film dann aber macht, ist, dass er von diesem einen Fixpunkt aus zahlreiche, oft sehr eigenartige Linien zieht in die Gegenwart und jüngere Vergangenheit. Und was am Ende dieser Linien steht, das reibt sich aneinander und schlägt manchmal ganz sonderbare Funken.
Lukas Foerster
Michael Glawogger: "Das Vaterspiel". Mit Helmut Köpping, Ulrich Tukur, Sabine Timoteo, Christian Tramitz. Deutschland, Österreich, Frankreich 2008, 117 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Raphael Nadjari erzählt die Geschichte des israelischen Kinos (Forum)
In seiner Geschichte des israelischen Kinos lässt der 1971 in Marseille geborene Raphael Nadjari dreieinhalb Stunden lang einfach nur übers Kino reden. Filmhistoriker und Kritiker, Regisseure und Schauspieler sitzen vor der Kamera und erzählen von bedeutenden Filmen, von denen dann wiederum eine durchaus längere und aussagekräftige Sequenz gezeigt wird. Aber wie Nadjari dabei die gesamte israelische Kultur- und Kriegsgeschichte miterzählt, wie die Filmemacher und ihre Kritiker dabei über künstlerisches Selbstverständnis und die Rolle in der Gesellschaft nachdenken, über Filmsprache und Kommerz, über Zionismus und Individualismus, über die Besatzung und schwule Erotik, über Einwanderung und Rassismus, ergibt ein solch reichhaltiges Bild eines Landes und seines Kinos, dass man sich fragt, ob seine Dokumentation nicht etwas zu kurz ausfällt.
Der Film besteht aus zwei Teilen. Der erste umfasst den Zeitraum von 1932-1978, und hier haben noch vorrangig die Historiker das Wort, was den Rückblick nicht zwangsläufig spröde macht. Denn die lebhafte Diskussion geht gleich los. Wann beginnt der israelische Film. Und wo? Mit der Gründung Israels? Mit jüdischen Filmemachern in Europa? Mit dem Zionismus? Man einigt sich auf Chaim Halachmis "Oded, der Wanderer", der erste, dem Zionismus verschriebene Film, in dem jüdischen Einwanderern die Pracht und die Herrlichkeit der jüdäischen Heimat vorgeführt wurde.

Bis Ende der sechziger Jahre, muss man nach dieser Filmgeschichte zumindest sagen, stellt Otto Premingers von Ben Gurion höchstpersönlich gefördertes Einwanderunsgdrama "Exodus" für lange Zeit den Höhepunkt des israelischen Kinos dar, das bis dahin vor allem aus zionistischen Propaganda-Filmen über den neuen jungen und kräftigen Sabre oder Ephraim-Kishons Komödien über desorientierte Einwanderer wie etwa "Sallah Shabati" bestand. Das große das Trauma, der Holocaust, spielt absolut keine Rolle (und wird es auch später nicht tun). Die flachen Gewässer verließen ab 1967 israelische Autorenfilmer wie Uri Zohar (der später zum Chassidentum übertrat). Sie stellten sich in dieser kollektivistischen Gesellschaft, der jeglicher individueller Liberalismus fremd war, erstmals existenzialistische Fragen. Und auch wenn die israelischen Produzenten lieber auf populäre Komödien über das komplizierte aschkenasisch-sephardische Miteinander setzten - nach dem in seiner Herkunft umstrittenen Gebäck "Bourekas" genannt -, ließ sich das neue Kino nicht mehr aufhalten.
In diesem zweiten Teil, der den Zeitraum von 1979 bis 2007 umfasst, wird Nadjaris Dokumentation noch einmal viel spannender. Denn nun sprechen nicht nur die Historiker, sondern die Regisseure und Schauspieler selbst, die Filme werden drängender: Der Filmemacher David Perlov klagte in seinem dokumentarisch-poetischen "Diary" den Zynismus an, mit dem der Entebbe-Mythos kommerzialisiert wurde. Yehuda Judd Ne'eman (mehr hier) zeigte in seinem Film "Paratroopers" die Brutalität innerhalb der israelischen Armee, Daniel Wachsman in "Transit", wie unwohl sich ein Jude in Israel fühlen kann und Ram Levy in "Hirbeth Hizzath" die Gewalt gegenüber den Palästinensern (mehr hier): "New Sensitivity" lautete das Schlagwort.
Uri Barbash erzählt von seinem 1992 gedrehten Film "Beyond the Walls", der die Freundschaft zwischen einem Israeli und einem palästinensischen Terroristen zum Thema hat - und den Barbash heute nicht noch einmal drehen würde. Avi Mograbi, der im Gefängnis gesessen hat, weil er den Kriegsdienst im Libanon verweigerte, spricht über die Schwierigkeit, nicht nur politisch richtiges, sondern gutes Kino zu machen. Den Gipfel des politischen Kinos erreichte unbestritten Assi Dayan, als Sohn des Kriegshelden Moshe Dayan eigentlich der "ultimative Israeli". Doch in "Life According to Agfa" schlug er alles entzwei: IDF-Soldaten massakrieren sämtliche Gäste in einem Alternativ-Lokal, weil sie sich beleidigt fühlten. Dieses Land, so Dayans Botschaft, hat so viel Gewalt produziert, dass sie sich nach innen und gegen sich selbst richten muss.
In der zweiten Hälfte der neunziger Jahre wendet sich das Kino von der Politik ab, wird autobiografischer, persönlicher, individualistischer. Und während Amos Gitai in Filmen wie "Kadosh" an die Entzauberung der Religion macht, treten ultra-orthodoxe Filmemacher auf den Plan, die die "Realität von Gott" zeigen wollen, aber auch georgische Einwanderer wie Dover Kosashvili, feministische Filmemacherinnen wie Ronit Elkabetz (mehr hier) und die palästinensischen Regisseure Hany Abu-Assad mit "Paradise Now" und Tawfik Abu Wael mit "Thirst". Das Erstaunliche an dieser Dokumentation ist, dass man auch nach dreieinhalb Stunden nicht genug vom israelischen Kino hat, sondern gleich in eine gute Videothek gehen möchte, um sich mindestens drei Filme auszuleihen.
Thekla Dannenberg
Raphael Nadjari: "A History of Israeli Cinema". Dokumentarfilm. Frankreich/Israel 2009, 210 Minuten. (Alle Vorführtermine, mehr hier)
Genüsslich sadistisch: Dominic Murphys "White Lightning" (Panorama)
Es soll Kreise geben, in denen ein gewisser Jesco White Kultstatus genießt. Der Mann ist schwerst drogensüchtig, lebt mit seiner dysfunktionalen Familie in einem Wohnwagen und tourt als "Dancing Outlaw" durch die Kneipen West Virginias. Hier trägt man die Holzfällerhemden offen, Cowboyhut und schwarze Zähne, mit Schwarzen will man lieber nichts zu tun haben, aber wenn eine Frau den Country-Schlager "It wasn't God who made honky tonk angels" singt, ist die gesamte Trinkhalle zu Tränen gerührt. Jescos Spezialität ist der appalachische Bergtanz, eine in dieser vernachlässigten und übel beleumundeten Region offenbar heimische Verbindung aus Stepptanz und Clogging. Und wie der britische Regisseur Dominic Murphy nach der Vorführung versichert, ist Jesco White "geisteskrank": "Aber wenn man ihn trifft, verliebt man sich sofort in ihn. Er ist wirklich liebenswert." In seinem Film "White Lightning" hat Murphy leider vergessen, das zu erwähnen. Hier ist Jesco White einfach nur ein schnüffelnder, gewalttätiger Psychopath, der einem so zuwider ist, dass man ihm und dem Film ein schnelles Ende wünscht.

Doch Murphy präsentiert ein ganzes Leben voller drogeninduzierter Gewalttaten und religiösem Wahn mit Genuss. In schwarzweißen, verzerrten und grobkörnigen Bildern, unterlegt mit extralautem Hardmetall oder dem Country von Hasil Adkins. Der Junge ist noch keine zehn, da schnüffelt er schon und landete immer wieder in der Besserungsanstalt, seine Eltern sind echter White Trash. Ein Biker verpasst dem Jungen einen Heroinschuss und bringt ihn damit auf einen Horrortrip, der für mehrere Jahre in der Irrenanstalt anhalten wird. Der Vater wird später auf brutale Art ermordet werden, aber das Tanzen hat er seinem Sohn noch beigebracht. Und so steppt er in den appalachischen Spelunken und wenn er gerade einen Rückfall hat, quält er entweder seine Freundin, schlitzt sich selbst die Arme mit einer zerbrochenen Flasche auf oder ermordet auf bestialische Weise die wieder aus dem Gefängnis entlassenen Mörder seines Vaters. Immer sadistischer und unrealistischer und ekelerregender werden die Brutalitäten in diesem Film, dass man sich wirklich ärgert, dass Murphy dafür so eine arme Type aus den Apalachen vorschiebt. Man ist nur froh, wenn dieser völlig sinnlose Horrorrip vorbei ist. Seltsamer Jubel aus dem Publikum.
Thekla Dannenberg
Dominic Murphy: "White Lightnin'". Großbritannien, USA, Kroatien, 2008. Mit Edward Hogg, Carrie Fisher, Muse Watson und anderen. 90 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Tief betroffen: Lukas Moodyssons "Mammoth" (Wettbewerb)
 Lukas Moodysson hat etwas entdeckt. Dass es in New York und auf den Philippinen Familien gibt. Dass es Globalisierung gibt. Dass hier wie dort gearbeitet wird. Dass es ein Wohlstandsgefälle gibt. Hier Überschuss, dort Mangel. Und dass es selbst im Mangel noch Unterschiede zwischen wenig und ganz erbärmlich wenig gibt. Und dass oft Kinder die Leidtragenden sind. Und dass das irgendwie alles miteinander zu tun hat. Muss man nur die Familien aneinander legen. Dann sieht man das. Deshalb hat Lukas Moodysson einen Film drüber gemacht.
Lukas Moodysson hat etwas entdeckt. Dass es in New York und auf den Philippinen Familien gibt. Dass es Globalisierung gibt. Dass hier wie dort gearbeitet wird. Dass es ein Wohlstandsgefälle gibt. Hier Überschuss, dort Mangel. Und dass es selbst im Mangel noch Unterschiede zwischen wenig und ganz erbärmlich wenig gibt. Und dass oft Kinder die Leidtragenden sind. Und dass das irgendwie alles miteinander zu tun hat. Muss man nur die Familien aneinander legen. Dann sieht man das. Deshalb hat Lukas Moodysson einen Film drüber gemacht.Die Familie in New York lebt im Überfluss. Penthouse, Kühlschrank kunterbunt randvoll (trotzdem Pizza bestellen), in den Regalen Bücher (ungelesen?) und Platten, unanständig viel Raum zur Seite, nach oben. Das Trimm-Dich-Gerät steht oben auf dem Dach. Mutter Ärztin, leidet unter Schlafmangel, Vater, Computerspiele-Bastler und irgendwas mit Web 2.0, daher der Reichtum. Tochter? Bilderbuch-brav, Bilderbuch-Herz-aus-Gold, neugierig auf die Welt, der Traum jedes Was-ist-was-Buchverlegers. Eine Welt wie ein Kokon, abgeschirmt vor allem und jedem, nach innen wattig, aber doch irgendwie schnucklig-gut.
 Angelpunkte: Das mütterliche Kindermädchen (auch mit Herz-aus-Gold-Verdacht) von den Philippinen, für die Tochter ein Ticket in eine Welt der Primärerfahrung, und die Geschäftsreise des Vaters nach Thailand. Sie arbeitet hier - für Jahre, wie ihr Sohn in der Heimat dem kleinen Bruder erklärt -, damit die Familie zu Hause sich ein Haus bauen kann. Er, der er auch so irgendwie ein Herz aus Gold zu haben scheint, fliegt nach Thailand, um etwas zu unterschreiben, was der Web2.0-Spielefirma noch viel mehr Geld einbringen wird. Auf der Reise überreicht ihm sein Berater einen obszönen Kugelschreiber: Mit Mammut-Elfenbein besetzt. 3.000 Dollar. Damit er den Vertrag gediegen unterschreiben kann.
Angelpunkte: Das mütterliche Kindermädchen (auch mit Herz-aus-Gold-Verdacht) von den Philippinen, für die Tochter ein Ticket in eine Welt der Primärerfahrung, und die Geschäftsreise des Vaters nach Thailand. Sie arbeitet hier - für Jahre, wie ihr Sohn in der Heimat dem kleinen Bruder erklärt -, damit die Familie zu Hause sich ein Haus bauen kann. Er, der er auch so irgendwie ein Herz aus Gold zu haben scheint, fliegt nach Thailand, um etwas zu unterschreiben, was der Web2.0-Spielefirma noch viel mehr Geld einbringen wird. Auf der Reise überreicht ihm sein Berater einen obszönen Kugelschreiber: Mit Mammut-Elfenbein besetzt. 3.000 Dollar. Damit er den Vertrag gediegen unterschreiben kann.Der Mammutfüller gibt dem Film nicht nur seinen Namen, er dient auch als Stichwortgeber für manche Philosophiererei auf Sparflamme, wie hier überhaupt sehr viel auf Sparflamme gestellt ist, wenn's um Wesentliches geht. Die Sparflamme freilich wird hinter viel Bohei versteckt, hinter Betroffenheitsgeheische (Kinderprostitution ist schlimm), einer brutalen Melodramatik (tote, geschundene Kinder gehen immer) und einer plumpen Eva-Hermann'schen Schlussagitation (Mutter, bleib bei deinem Kinde!), dass man Reißaus nehmen möchte vor soviel simplen Postkartengrüßen aus der Welt des zurecht gezimmerten Elends, in der am Ende jede Erbse wieder im eigenen Töpfchen landet: Alle sind wieder im je eigenen Land. Wie gut, dass wir uns haben, besser gewesen wär's, wir hätten nie rausgeschaut.
Thomas Groh
Lukas Moodysson: "Mammoth". Mit Gael Garcia Bernal, Michelle Williams, Sophie Nyweide, Tom McCarthy, Marife Necesito. Schweden, Deutschland, Dänemark 2009, 120 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Kommentieren