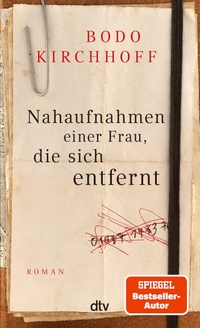Außer Atem: Das Berlinale Blog
Absolute Seh-Souveränität: Harry Patramanis' 'Fynbos' (Forum)
Von Elena Meilicke
08.02.2013. Thom Anderson denkt in seinem Videoessay "Los Angeles Plays Itself" (2003) (Youtube) unter anderem darüber nach, warum modernistische Architektur im Hollywoodkino so schlecht wegkommt: es wohnen immer die Bösen in den Richard-Neutra- und Frank-Lloyd-Wright-Häusern.
Thom Anderson denkt in seinem Videoessay "Los Angeles Plays Itself" (2003) (Youtube) unter anderem darüber nach, warum modernistische Architektur im Hollywoodkino so schlecht wegkommt: es wohnen immer die Bösen in den Richard-Neutra- und Frank-Lloyd-Wright-Häusern.
Ein solches Haus – weiß, gerade, spektakulär, mit Flachdach und Fassaden aus Glas – spielt auch die Hauptrolle in "Fynbos". Südafrika, westlich von Kapstadt: eingenestelt in einem Tal vor atemberaubender Bergkulisse liegt die Villa Fynbos, umgeben von üppiger Vegetation. Ein Paradies auf Erden, das zum Verkauf steht. Aber auch ein Fremdkörper in der archaischen Landschaft, ein Raumschiff, eine fast dämonische Präsenz. Mitten im Bau ist das Geld ausgegangen, ein Teil des Hauses ist unfertig geblieben, wird versteckt unter großen Plastikplanen, die nachts im Wind flattern.
Richard muss das Haus unbedingt loswerden, sonst droht ihm der Ruin, verzweifelt versucht er, das Anwesen an ein britisches Geschwisterpaar zu verkaufen. Vorzüge anpreisen, einen guten Eindruck machen, Missklänge vermeiden. Seine Frau Meryl macht ihm einen Strich durch die Rechnung, somnambul durchwandert sie das Haus, hört und sieht Dinge, die nicht da sind. Auftritt: das Unheimliche. Deutlich wird außerdem, wie viel Ausschluss- und Abgrenzungsarbeit die Produktion des irdischen Paradieses erfordert. Schau nicht hin, fordert Richard, wenn der Blick seiner Frau über die ärmlichen Township-Behausungen gleich hinter der Grenze des Anwesens schweift. Ein großes Tor und ein kilometerlanger Stacheldrahtzaun umschließen das Fynbos-Gelände, das Alarmsystem, wirbt Richard, ist hochsensibel.
"Fynbos" erzählt so von einem Auschließen und Abschließen, das nicht auf wirkliche Gefahren reagiert, sondern symptomatisch für die rassistisch durchwirkten Ängste einer weißen Ober- und Mittelschicht ist. Wie Regisseur Harry Patramanis (ein Grieche, der an der HFF München studiert hat) diese diffusen Ängste in Filmbilder fasst und die Angst ganz a-psychologisch als Funktion des Hauses beschreibt, hat mir sehr gut gefallen. Nachts werden die meterhohen Glaswände, die tagsüber Transparenz und absolute Seh-Souveränität versprechen, zum Einwegspiegel: von außen gut einsehbar, zeigen sie dem, der im Haus sitzt, nur das eigene Antlitz. Man kann hineinschauen, aber nicht hinaus. Ein Ausschließen und Abschließen auch auf der Tonspur: oft werden Dialogszenen durch Glasscheiben hindurch gefilmt, und bleiben auf diese Weise stumm, tonlos, schallisoliert.

Es ist vielleicht nicht unbedingt subtil, wie "Fynbos" bestimmte Dichotomien durchexerziert: schwarz vs. weiß, arm vs. reich, Männer vs. Frauen, Kultur vs. Geld. Aber die Art, wie "Fynbos" von einem einem Weniger-Werden, einem graduellen Verschwinden erzählt, übt dennoch eine ganz eigene Faszination aus. Es erinnert fast ein bisschen an die hypnotischen Qualitäten eines Weerasethakul, wenn auch auf grobschlächtigere Weise, eingehegt in deutlich konventionellere Erzählstrukturen, als man sie von dem thailändischen Regisseur kennt. Vor der überwältigenden Bergkulisse erscheinen die Plotbewegungen in "Fynbos" manchmal fast klischeehaft und kümmerlich, aber irgendwie ist das ganz richtig so. Die Figuren bleiben marginal, sie tauchen auf und wieder ab. Einer nach dem anderen verlassen die Gäste das Anwesen und reisen ab, Meryl ist verschwunden, vielleicht auch tot.
Elena Meilicke
"Fynbos". Regie: Harry Patramanis. Mit Jessica Haines, Warrick Grier, Standiwe Kgoroge, Susan Danford u.a. Südafrika / Griechenland 2012, 96 Minuten. (Alle Vorführtermine)
Kommentieren