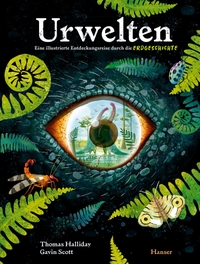Vom Nachttisch geräumt
Die Bücherkolumne. Von Arno Widmann
12.12.2005. Unser Autor spaziert mit Samuel Beckett durch Berlin, verfängt sich in den Tagebuchnotizen von Said, trauert um Positano, wie es einmal war, spekuliert über Harry Graf Kesslers Vater, lernt aus einem Gedicht von Jimmy Carter, wie Politik funktioniert und bewundert polnische Wohnzimmer. Ein Kant'scher Gedanke unter einer Präfektenmütze
 Erika Tophoven war zusammen mit ihrem Mann Elmar über Jahrzehnte die Übersetzerin Samuel Becketts. Ihr neuestes Buch, es ist opulent bebildert, trägt den Titel: "Beckett in Berlin". Sie erzählt darin von den sechs Wochen, die der irische Autor im Winter 1936-1937 in Berlin verbrachte. Als Grundlagen ihrer Arbeit nennt sie ein kleines dunkelrotes Notizbuch, das "Whoroscope notebook", in dem sich Vermerke aus den dreißiger Jahren finden, die Korrespondenz mit seinem Freund MacGreevy und als wichtigstes Stück sechs Hefte mit tagtäglichen Eintragungen von der Deutschlandreise im Winterhalbjahr 1936-1937.
Erika Tophoven war zusammen mit ihrem Mann Elmar über Jahrzehnte die Übersetzerin Samuel Becketts. Ihr neuestes Buch, es ist opulent bebildert, trägt den Titel: "Beckett in Berlin". Sie erzählt darin von den sechs Wochen, die der irische Autor im Winter 1936-1937 in Berlin verbrachte. Als Grundlagen ihrer Arbeit nennt sie ein kleines dunkelrotes Notizbuch, das "Whoroscope notebook", in dem sich Vermerke aus den dreißiger Jahren finden, die Korrespondenz mit seinem Freund MacGreevy und als wichtigstes Stück sechs Hefte mit tagtäglichen Eintragungen von der Deutschlandreise im Winterhalbjahr 1936-1937.
Es sind 500 dicht beschriebene, schwer zu entziffernde Seiten. Tophovens Buch bietet keine Übersetzung der Beckettschen Notizen, sondern so etwas wie eine thematisch gegliederte Nacherzählung, die durch zahlreiche zusätzliche Informationen das Verständnis der Lage des dreißigjährigen Reisenden erheblich erleichtern. Es ist der Blick des späteren "Endspiel"-Autors auf Nazi-Deutschland. "Eintopf, pfui!" findet sich mehrfach im Tagebuch. Es ist nicht klar, ob es sich auf den neuen Kult, das Ritual des gemeinsamen Eintopfverzehrs, oder aber auf den Geschmack des Gerichts bezieht.
Im Zentrum des Buches stehen allerdings - wie auch im Zentrum von Becketts Berlin-Aufenthalt - die Museumsbesuche des irischen Autors. Beckett war ein großer Gemäldebetrachter. Er sah sich nicht nur viele an, er sah sie sich auch gründlich an. Manchmal war er mit einem Gemälde eine ganze Stunde beschäftigt. Dabei ging er ganz systematisch vor. Saal für Saal. Man kann an Hand des Tagebuches genau feststellen, was er wann gesehen hat. Man könnte die Hängung der Bilder danach rekonstruieren. Die Kommentare zu den Bildern sind, wenn man Tophovens Darstellung folgt, eher kurz und immer ein wenig ruppig. Nachdem er die Rembrandträume betrachtet hat, notiert Beckett: "Ich gäbe alle Rembrandts für den kleinen Brouwer-Hirten am Wege, der die Schalmei bläst." Oder seine Anmerkungen anlässlich der Arbeiten von Eduard Munch: "Die Zeichnung 'Krankes Mädchen' auch kaum mehr als hübsch. Woran liegt es, dass diese kompromisslosen Nordländer (Nolde & Hamsun ebenfalls) immer Gefahr laufen, alles zu kippen. Man findet es auch in der deutschen Gotik, mehr als in der englischen. Ein unverdauter Brocken von Naivität, bäuerisch grober Art, beinahe Debilität. Eine gelobte Debilität. Fast so als ob ein ganzer Nervenbereich im Kopf sich nie entwickelt hätte, nicht nur ein blinder Fleck, sondern ein Kretinismus, der noch kultiviert und in die Aussage mit hineingezogen wird. Eine gewollte Kargheit, höflich ausgedrückt, denn oft ist es vielmehr unbewusste Trivialität, ein Kant'scher Gedanke unter einer Präfektenmütze."
Erika Tophoven: "Becketts Berlin". Nicolai Verlag, Berlin 2005. Format: 21 x 22,5 cm, 105 s/w und 21 farbige Abbildungen, gebunden mit Schutzumschlag, 144 Seiten, 24,90 Euro. ISBN 3894791594.
Das Gefühl völliger Hilflosigkeit
 Überspringen Sie den einführenden Radioessay und überspringen Sie das Gespräch, das dessen Autor, der iranische Exilschriftsteller Said, mit dem ehemaligen Bayerischen Kultusminister Hans Maier führte. Beginnen Sie mit den Tagebuchnotizen Saids, und Sie werden nicht aufhören, bis Sie das Buch zu Ende gelesen haben. Es sind lakonische Notizen, die die Mauern einreißen, die wir errichten zwischen uns und dem, das wir nicht wahrnehmen wollen. Am 25. Juli 1996 notiert Said, was der oberste Staatsanwalt des Iran einem Journalisten zu dem neuen Gesetz gegen Diebstahl sagt: "Erst werden dem Dieb vier Finger der rechten Hand abgeschnitten; bei Rückfälligkeit werden alle Zehen des linken Fußes amputiert; sollte er wieder rückfällig werden, wird der Dieb zu lebenslänglicher Haft verurteilt; sollte er im Gefängnis oder während eines Freigangs erneut Diebstahl begehen, wird er hingerichtet."
Überspringen Sie den einführenden Radioessay und überspringen Sie das Gespräch, das dessen Autor, der iranische Exilschriftsteller Said, mit dem ehemaligen Bayerischen Kultusminister Hans Maier führte. Beginnen Sie mit den Tagebuchnotizen Saids, und Sie werden nicht aufhören, bis Sie das Buch zu Ende gelesen haben. Es sind lakonische Notizen, die die Mauern einreißen, die wir errichten zwischen uns und dem, das wir nicht wahrnehmen wollen. Am 25. Juli 1996 notiert Said, was der oberste Staatsanwalt des Iran einem Journalisten zu dem neuen Gesetz gegen Diebstahl sagt: "Erst werden dem Dieb vier Finger der rechten Hand abgeschnitten; bei Rückfälligkeit werden alle Zehen des linken Fußes amputiert; sollte er wieder rückfällig werden, wird der Dieb zu lebenslänglicher Haft verurteilt; sollte er im Gefängnis oder während eines Freigangs erneut Diebstahl begehen, wird er hingerichtet."
Wir hatten das auch gelesen. Wir waren entsetzt. Dann blätterten wir weiter in unserer Zeitung. Dieser Satz hört sich an wie ein Urteil, aber er beschreibt nur, was wir taten und fortfahren zu tun. Ich weiß nicht, ob Said ein religiöser Mensch ist. Ich weiß nur, dass er Wert auf Religion legt. Er tut das, so ist mein Eindruck, aus Misstrauen gegenüber Menschen, denen es an Demut fehlt. Aber es bedarf nicht der Religion, um sich klar darüber zu werden, wie klein wir sind. Im Gegenteil. Den meisten Menschen dient die Religion nur dazu, sich und die Gemeinschaft, zu der sie gehören, aufzublasen. Es gibt eine kleine Stelle in dem Buch, da erliegt auch Said dieser Versuchung. Auf Seite 80 schreibt er: "Kann eine Religion aber überhaupt als Feind gelten? Die Frage muss verneint werden. Denn auch die Kultur des Orients wäre ohne den Islam undenkbar; Hafis ohne den Islam? So, wie der Okzident ohne Christentum der Kulturbarbarei verfallen wäre; Bach ohne Jesus von Nazareth?"
Das ist alles richtig. Bis auf das Wort von der "Kulturbarbarei". Das Christentum hat die Welt nicht von der Barbarei erlöst. Man muss nicht so weit gehen wie zum Beispiel Goethe und den Verdacht hegen, das Christentum habe die Antike in die Barbarei gestürzt, man kann einfach feststellen, dass es auch ohne Christentum Kultur gab, ja dass es sogar ohne das, was Said als Religion betrachtet, Kultur gibt. Ob der Mensch sich seinem Mitmenschen gegenüber menschlich verhält, ist nicht nur ganz unabhängig davon, welcher Religion er angehört, sondern auch davon, ob er überhaupt an ein höheres oder mehrere höhere Wesen glaubt. Saids Tagebuchnotizen laden ein zu einem Gespräch mit ihm. Sie sind so klar, so entschieden, dass man sich aufgefordert fühlt, ihm zu antworten, weil man weiß, er wird zuhören, er wird sich freuen über jede Entgegnung, und ihm wird es wiederum Freude machen zu entgegnen.
Nach den Tagebuchnotizen kommt "Mina - Eine Begegnung". Einen ergreifenderen Text habe ich nicht gelesen. Der Erzähler wird nach einer Lesung in einer Stadt im Ruhrgebiet von einer Iranerin angesprochen. Sie erzählt ihm, wie sie in Teheran eines Tages von den Revolutionsgardisten Khomeinis verhaftet, verhört und vergewaltigt wurde. Sie erzählt ihm, wie ihr die Flucht aus Persien gelang und wie ihr Mann es nicht ertrug, dass sie vergewaltigt worden war. Said erzählt das vorsichtig. Desto niederschmetternder ist die Wirkung. Das Gefühl völliger Hilflosigkeit, aus der nichts einen retten kann, wächst von Satz zu Satz. Es beginnt als Kopfidee und breitet sich dann im ganzen Körper aus, bis man davon angefüllt ist bis in die Fingerspitzen hinein.
Die Frau überlebt es. Sie schildert, wie: "Ich beschließe, nichts zu tun. Irgendwann werden die müde. Irgendwann werde ich bluten. Irgendwann werde ich ohnmächtig. Ich habe hier keine Aufgabe. Ich muss mir eine Aufgabe geben. Gegen den Schmerz. Gegen die Erniedrigung. Ich muss durchhalten. Das ist meine Aufgabe. Ich muss an etwas denken. An etwas glauben. Ich denke an meinen Mann. Daran, dass ich mit ihm, irgendwann, ein Kind haben will. Jemand spuckt auf etwas. Es geht wieder los. Wie lange kann ich aushalten? Wann werde ich endlich ohnmächtig? Warum nimmt mich Mahmud nicht in seine Arme? Immer an etwas anderes denken. Gegen den Schmerz denken. Gegen die Erniedrigung. An etwas Schönes denken. Van Gogh. Cafeterrasse bei Nacht. Van Gogh ist gut. Er ist unschuldig. Er hilft. Gegen den Schmerz. Gegen die Erniedrigung."
Van Gogh! In lange zurückliegenden Debatten über Ästhetik wurde uns gesagt, Texten könne auch noch, nachdem sie geschrieben wurden, neue Bedeutung zuwachsen. Van Gogh! Der Name liest sich jetzt - nach der Ermordung seines Nachkommen durch einen islamistischen Attentäter - nicht mehr tröstend, sondern er verschärft die Lage. Denn er kommt als Trost nicht mehr in Frage. Der Text ist somit radikaler, härter geworden. Härter als der Autor. Das steigert seine Schönheit.
Said: "Ich und der Islam". C.H. Beck Verlag, München 2005. 168 Seiten, Klappenbroschur, 14,90 Euro. ISBN 3406535534.
Das Meer, das die fünf Teile der Welt einhüllt
 Es ist ein Coffee-Table-Book. Es macht sich hervorragend in einem Wintergarten auf einem kleinen Marmortischchen. Wer gleich für Gesprächsstoff sorgen möchte, der lässt die Seiten 208-209 aufgeschlagen liegen. Sepiabraun liegt dann der fotografisch festgehaltene Vesuvausbruch von 1872 vor dem Betrachter. Wer zurückblättert, der findet einen kleinen Text von Blaise Cendrars aus dem Jahre 1948: "Ich sitze hinter der Landzunge des Posilip, unter einer Weinlaube im Garten eines Gasthofs in Pozzuoli. Ich trinke. Ich esse. Ich rauche. Ich rauche. Im Vorhafen schaukelt eine an einer Boje festgemachte Barke mit fremdländischer Takelage. Das Meer liegt einsam da; das Meer, das an den Kiesstrand klatscht; das Meer, das die fünf Teile der Welt einhüllt. Die Zeit vergeht. Ich esse, ich rauche, ich trinke und forsche am Horizont. Am Horizont ist das Meer nur noch ein dunkler Streifen. Ich trinke. Der Wein aus Pozzuoli ist gut, dick und dunkel wie Druckerschwärze."
Es ist ein Coffee-Table-Book. Es macht sich hervorragend in einem Wintergarten auf einem kleinen Marmortischchen. Wer gleich für Gesprächsstoff sorgen möchte, der lässt die Seiten 208-209 aufgeschlagen liegen. Sepiabraun liegt dann der fotografisch festgehaltene Vesuvausbruch von 1872 vor dem Betrachter. Wer zurückblättert, der findet einen kleinen Text von Blaise Cendrars aus dem Jahre 1948: "Ich sitze hinter der Landzunge des Posilip, unter einer Weinlaube im Garten eines Gasthofs in Pozzuoli. Ich trinke. Ich esse. Ich rauche. Ich rauche. Im Vorhafen schaukelt eine an einer Boje festgemachte Barke mit fremdländischer Takelage. Das Meer liegt einsam da; das Meer, das an den Kiesstrand klatscht; das Meer, das die fünf Teile der Welt einhüllt. Die Zeit vergeht. Ich esse, ich rauche, ich trinke und forsche am Horizont. Am Horizont ist das Meer nur noch ein dunkler Streifen. Ich trinke. Der Wein aus Pozzuoli ist gut, dick und dunkel wie Druckerschwärze."
Wer das liest, spürt ein Gefühl der Seligkeit in sich aufsteigen. Er wird weiterlesen in diesem Buch, das also gar kein Coffee-Table-Book ist, sondern eine süchtig, eine sehnsüchtig machende Droge. "Legendäre Reisen in Italien" heißt der Band. Er dokumentiert nicht berühmte Italienreisen. Er bringt Zitate aus den Berichten von Stendhal, Nietzsche, Goethe, Ruskin, Musset, Hesse, Somerset Maugham - u.a. mit einer Feststellung aus dem Jahre 1929, die einen so traurig macht, dass man lauthals lachen muss: "Positano liegt an einem Südhang, und man darf damit rechnen, es im Sommer für sich allein zu haben" -, Isabelle Eberhardt, Thomas Mann, Seume, Maupassant, Dickens, Zola, Koeppen, Simone de Beauvoir usw. usw. Natürlich fallen einem sofort Namen ein, die fehlen. Um uns aufs B. zu beschränken zum Beispiel Bachmann und Brinckmann.
Aber das macht gar nichts. Da ist die um 1880 entstandene Aufnahme der Bucht von Sorrent. Oben rechts sitzt ein Mann, der noch die Tracht trägt, wie wir sie von den Gemälden Tischbeins und Kochs kennen. Und unten links in der Ferne sehe ich die Stelle, an der heute Freunde von mir ein Haus haben. Ich lege das Buch zur Seite, gehe ins Internet und buche einen Flug nach Neapel. Am 31. Oktober werde ich dort sein. Am Tag danach werde ich zu der Stelle fahren und mich exakt dorthin setzen, wo 1880 der Schäfer saß mit seiner Zipfelmütze. Ein teures Buch.
Nicht nur die alten Fotos, die alten Texte begeistern, sondern auch die Einführungen von Catherine Donzel. Die sieben Seiten zum "Italien der Reisenden" sind ein Wunderwerk. Wie schafft man es, auf so kleinem Raum soviel über das Land und seine Wahrnehmung so plastisch, so verführerisch zu schreiben?
Das Kapitel über die Reisen von Triest nach Taranto endet mit den Sätzen: "Und dann der blaue Schlund des ionischen Meeres, zweifelsohne unverändert seit der Zeit, als die Exilspartaner es überquerten, um Taranto zu gründen. Hier im Süden liegt Italien mit seinen Träumen. Hier liegen auch unsere Träume Italiens." Wer wichtige Tage und noch wichtigere Stunden seiner Pubertät im Museo Archeologico in Taranto verbrachte, der wird spätestens an dieser Stelle das Buch zur Seite legen und seinen Träumen folgen. Auch wenn er keinen Wintergarten hat.
Catherine Donzel, Marc Walter und Sabine Arque: "Legendäre Reisen in Italien". Aus dem Französischen von Angela Wagner. Geosaison, Frederking & Thaler. Mit 161 s/w- u. 145 Farbfotos, 4 Karten und einliegenden kleinen Faksimiles von u.a. einer Speisekarte, einem Theaterprogramm und einer Seilbahnwerbung, 320 Seiten, 50 Euro. ISBN 3894056436.
Alles Andre ist Firlefanz
 Harry Graf Kessler (1868-1937) hat Tagebuch geführt. Von 1880 bis 1937. Harry Graf Kessler gehörte zur europäisch-amerikanischen Elite seiner Zeit. Er kannte fast jeden, der in Politik, Wirtschaft und Kultur eine Rolle spielte. Er kannte die, die das Sagen hatten, und er kannte die, deren Bedeutung erst die Nachwelt erkannte. Er war ein Förderer zeitgenössischer Kunst und Literatur, und er war selbst ein Künstler und Literat. Es gibt in Deutschland keinen Autor, dessen Tagebücher mit den seinen zu vergleichen sind. Das hat zwei Gründe: Es gibt keinen Autor, dessen Leben auch nur annähernd mit dem Kesslers zu vergleichen wäre. Kesslers Schriftstellerdasein ging fast ganz in die Arbeit an den Tagebüchern. Hier ist zu beobachten die glückliche, auf fast jeder Zeile anregende Verbindung einer niemals ermüdenden Neugier auf die Welt und ihre Interpretation mit der von der eigenen Wahrnehmungslust begeisterten Formulierungsfreude eines Autors, der zu reich war, um wirklich Schriftsteller zu werden.
Harry Graf Kessler (1868-1937) hat Tagebuch geführt. Von 1880 bis 1937. Harry Graf Kessler gehörte zur europäisch-amerikanischen Elite seiner Zeit. Er kannte fast jeden, der in Politik, Wirtschaft und Kultur eine Rolle spielte. Er kannte die, die das Sagen hatten, und er kannte die, deren Bedeutung erst die Nachwelt erkannte. Er war ein Förderer zeitgenössischer Kunst und Literatur, und er war selbst ein Künstler und Literat. Es gibt in Deutschland keinen Autor, dessen Tagebücher mit den seinen zu vergleichen sind. Das hat zwei Gründe: Es gibt keinen Autor, dessen Leben auch nur annähernd mit dem Kesslers zu vergleichen wäre. Kesslers Schriftstellerdasein ging fast ganz in die Arbeit an den Tagebüchern. Hier ist zu beobachten die glückliche, auf fast jeder Zeile anregende Verbindung einer niemals ermüdenden Neugier auf die Welt und ihre Interpretation mit der von der eigenen Wahrnehmungslust begeisterten Formulierungsfreude eines Autors, der zu reich war, um wirklich Schriftsteller zu werden.
Kesslers Vater war geadelt und bald darauf in den erblichen Grafenstand erhoben worden. Die Geschwindigkeit, mit der letzteres geschah, ließ den Verdacht aufkommen, Wilhelm I. habe nicht nur die Gräfin, Kesslers Mutter, reizend gefunden, sondern er sei auch der Vater Harrys gewesen. Da der Kaiser als er Harrys Mutter kennen lernte, die Siebzig schon lange überschritten hatte, scheint das zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich und trug vielleicht auch ein wenig zur Wilhelm-Begeisterung - "Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wiederhaben!" - bei. Buchhalterische Beckmesser freilich, die nichts auf die Schönheit des Klatsches geben, erinnern daran, dass der Kaiser Alice Kessler erst im Sommer 1870 kennenlernte. Er sprach sie höchstselbst auf der Kurpromenade in Bad Ems an. Er habe sich schon seit langem gewünscht, erklärte er, mit ihr bekannt gemacht zu werden. Nicht sehr originell, aber es hat geklappt. Harry war damals schon zwei Jahre alt. Seine kaiserliche Majestät kommt also als Erzeuger dieses "vielleicht kosmopolitischsten Menschen, der je gelebt hat" (so W.H. Auden) nicht in Betracht. Aber auch so war Harry ja nicht von schlechten Eltern. Sein Vater, ein Bankier, hatte es nach dem Krieg gegen Frankreich (1870/71) verstanden, ein Millionenvermögen zusammenzutragen, "dessen Anlagen sich von Kanada bis Persien über drei Kontinente erstreckte. Allein in der kanadischen Provinz Quebec gehörten ihm achthundert Quadratkilometer Wald." (Laird M. Easton: "Der rote Graf".)
 Der Vater hatte sein Hauptquartier in Paris, lebte aber auch in Berlin, New York und London. Im Sommer ging die Familie nach Deutschland, in die Kurbäder Ems und Kissingen. Man muss die vielfältigen Aktivitäten des Sohnes nicht kennen, um sich in den Tagebüchern zu verlieren. Man kann Kessler auch erst über die Lektüre der Tagebücher kennenlernen. Wer lieber erst etwas über den Mann wissen möchte, der lese zunächst Eastons große Biografie. Aber auch wer die Tagebücher liest, wird bald zu dieser Biografie greifen, um Näheres über den einen oder anderen Namen oder über die Bedeutung der einen oder anderen Person in Kesslers Leben zu erfahren. Die Tagebücher selbst nämlich sind zwar sehr schön gemacht, aber leider verzichten sie auf Anmerkungen. Außer höchst spartanischen Erläuterungen zu den erwähnten Personen findet sich nichts Erklärendes in den Bänden. Wer an die Akribie denkt, mit der Inge Jens die Tagebücher Thomas Manns kommentiert hat, trauert darüber, was ihm bei der Lektüre der Kessler-Tagebücher entgeht. So genießt man eben dumm, wenn Kessler am 8. Februar 1892 in New York überrascht notiert, dass im Anschluss an eine Abendgesellschaft, zu der nur die beste Gesellschaft eingeladen war, die Herren sich an der Garderobe mit Fäusten schlagen, um ihre Sachen zu bekommen.
Der Vater hatte sein Hauptquartier in Paris, lebte aber auch in Berlin, New York und London. Im Sommer ging die Familie nach Deutschland, in die Kurbäder Ems und Kissingen. Man muss die vielfältigen Aktivitäten des Sohnes nicht kennen, um sich in den Tagebüchern zu verlieren. Man kann Kessler auch erst über die Lektüre der Tagebücher kennenlernen. Wer lieber erst etwas über den Mann wissen möchte, der lese zunächst Eastons große Biografie. Aber auch wer die Tagebücher liest, wird bald zu dieser Biografie greifen, um Näheres über den einen oder anderen Namen oder über die Bedeutung der einen oder anderen Person in Kesslers Leben zu erfahren. Die Tagebücher selbst nämlich sind zwar sehr schön gemacht, aber leider verzichten sie auf Anmerkungen. Außer höchst spartanischen Erläuterungen zu den erwähnten Personen findet sich nichts Erklärendes in den Bänden. Wer an die Akribie denkt, mit der Inge Jens die Tagebücher Thomas Manns kommentiert hat, trauert darüber, was ihm bei der Lektüre der Kessler-Tagebücher entgeht. So genießt man eben dumm, wenn Kessler am 8. Februar 1892 in New York überrascht notiert, dass im Anschluss an eine Abendgesellschaft, zu der nur die beste Gesellschaft eingeladen war, die Herren sich an der Garderobe mit Fäusten schlagen, um ihre Sachen zu bekommen.
Noch mit der Erinnerung an die jüngste Überschwemmung liest man eigentümlich berührt, was Kessler am 16. März über New Orleans schreibt: "Die weissgetünchten Häuser mit ihren grünen Läden erinnern an Italien. Weitvorspringende Terrassen auf Säulen ruhend überdachen die Fussteige; Gallerien und Veranden umgeben die Häuser oft bis zum obersten Stockwerk; man sieht, dass die Bewohner ihr Leben im Freien zubringen. Die Luft ist heute wie in Deutschland im Juni; blühende Rosen- und Jasmin-Sträuche ranken sich in den Vorstädten an den Häusern empor; die Gärten sind bunt vor Blüten und Blumen. Den fremdartigsten Eindruck macht der Markt; Neger und Chinesen, langhaarige Mexikaner und schwarzäugige Creolinnen wogen durcheinander, handelnd und keifend, mit Geschrei und Gebärden, in unbeschreiblichem Wirrwarr, und in diesem ganzen Völkergemisch hört man kaum ein Wort Englisch. Gerade hinter dem Markt läuft die Levee entlang, der Damm, der die Stadt vor den gelben, reissenden Fluten des Mississippi schützt; der Fluss ist nicht breiter wie die Elbe bei Hamburg aber vor der Stadt 250 Fuss tief. Mehrere zwei Stockwerke hohe Baumwolldampfer ankern rauchend an der Levee."
Und dann kommt der Satz, bei dem der Leser nach einer Erklärung schreien möchte: "Unten am Hafen steht eine Säule zur Erinnerung an die Befreiung von Louisiana vom Joch der Negerherrschaft durch die Bürger von New Orleans im September 1874." Nun eine "Negerherrschaft" hatte es nie gegeben. Am 14. September kam es allerdings zur größten Straßenschlacht der US-Geschichte als Angehörige einer militanten Weißenorganisation die Stadtregierung, die ihnen zu freundlich gegenüber den freigelassenen schwarzen Sklaven vorkam, bewaffnet attackierte. Die offizielle Geschichtsschreibung ist die eine Sache. Wie man die Geschichte heute in New Orleans sieht, darüber kann man sich im Internet informieren.
Dieser Hinweis ist jetzt schon zu lang, aber eine Stelle muss ich noch zitieren. Sie zeigt Kesslers Intelligenz, seine Lust an der Zuspitzung und die Ambivalenz seiner Ansichten. Sie zeigt auch, wie er sich steigert und in Rage schreibt, wie er nicht zurückschreckt vor dem, was ihm einfällt, sondern im Gegenteil dessen Extravaganz lustvoll genießt. Das macht die Lektüre, für alle die, die nicht nur Selbstbestätigung, sondern Widerspruch suchen, auf jeder Seite spannend. Am 7. Juni 1905 notiert Harry Graf Kessler in London: "Im Savoy gefrühstückt. Die Form des modernen Luxus das Hotel. Das Hotel entspricht demokratisch der Funktion des Palastes früherer Zeiten; große festliche Räume von immer steigendem Raffinement, die beste Küche, ein Überfluss an Dienerschaft und Comfort, aber statt für Einen für Hunderte, anonyme Hunderte. Es überflügelt allmählich den Palast selbst amerikanischer Millionäre. Hotels wie Savoy, Carlton, Ritz bieten mehr als wohl je der größte Luxus eines Crassus oder Soubise. Sie gehören zu den greifbarsten Zeichen einer neuen demokratischen, d.h. auf unübersehbar viele grosse Vermögen aufgebauten Kultur. - Aristokratie: wenige, benennbare grosse Vermögen. Demokratie: zahlreiche, anonyme grosse Vermögen. Der Reichtum bleibt die Axe, aber weniger greifbar. Demgegenüber giebt es nur Monarchie oder Büreaukratie, die auf Polizei und Waffen fundierte Macht. Demokratie verhält sich zu Aristokratie etwa wie Büreaukratie zu Monarchie. Alles Andre ist Firlefanz. Es giebt in der Gesellschaft nur diese vier Möglichkeiten. Die Sozialdemokratie ist ein büreaukratisches Ideal. - Anders ausgedrückt: es giebt nur zwei wirkliche soziale Mächte, den Besitz und das Schwert; und jede kann in zwei Formen sich äussern: durch Einzelne, greifbare Persönlichkeiten, oder durch viele, anonyme. Die Einzelnen, Greifbaren sind bei Waffengewalt der König, bei Besitzgewalt die Aristokratie, die Vielen, Anonymen bei Waffengewalt die Büreaukratie, bei Besitzgewalt die Demokratie. Die Büreaukratie ist das Kleingeld eines Königs, wie die Demokratie das Kleingeld einer Aristokratie. Natürlich giebt es Zwischenformen, Kombinationen aller Art; aber nur diese vier Elemente, aus denen sie bestehen können. Der Geist, die Ideen, die Kunst sind nur ein Aufputz, ein farbiger Schleier um diese Formen; oder Mittel, die Eine in die Andre umzuwandeln."
Neun Bände soll die Ausgabe der gesamten Tagebücher umfassen. Drei sind bisher erschienen:
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch". Zweiter Band, 1892-1897. Herausgegeben von Roland S. Kamzelak und Ulrich Ott. Klett-Cotta, Stuttgart 2004, Leinen mit eingelassenem Titelschild, Lesebändchen, im Grauschuber, 777 Seiten, 58 Euro. ISBN: 376819812X.
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch". Dritter Band, 1897-1905. Herausgegeben von Roland S. Kamzelak und Ulrich Ott. Klett-Cotta, Stuttgart 2004. Leinen mit eingelassenem Titelschild, Lesebändchen, im Grauschuber, 1199 Seiten, 63 Euro. ISBN 3768198138.
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch". Vierter Band, 1906-1914. Herausgegeben von Jörg Schuster unter Mitarbeit von Janna Brechmacher. Klett-Cotta, Stuttgart 2005. Leinen mit eingelassenem Titelschild, Lesebändchen, im Grauschuber, 32 Seiten s/w-Tafelteil, 1303 Seiten, 63 Euro. ISBN 3768198146.
Wer die Tagebücher liest oder auch nur in ihnen liest, wird schnell lesen wollen:
Laird M. Easton: "Der Rote Graf". Harry Graf Kessler und seine Zeit. Aus dem Amerikanischen von Klaus Kochmann. Klett Cotta, Stuttgart 2005. Leinen mit Schutzumschlag, Fadenheftung, Lesebändchen, 16 Seiten s/w-Tafelteil, 591Seiten, 39,50 Euro. ISBN 3608936947.
Ich verlor die nächste Wahl
 Jimmy Carter, geboren 1924 in Plains, Georgia, war 1977 bis 1981 Präsident der Vereinigten Staaten der USA. 1982 gründete er das Carter Center, eine unparteiische Nonprofit Einrichtung, die sich um nationale und internationale Konfliktlösungen bemüht. 2002 bekam Jimmy Carter den Friedensnobelpreis "für seine Jahrzehnte langen, unermüdlichen Anstrengungen, friedliche Lösungen für internationale Konflikte zu finden und Demokratie und Menschenrechte und wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern." Jimmy Carter hat 19 Bücher geschrieben: Lebenserinnerungen, politische Essays - der neueste ist gerade erschienen: "Our Endangered Values: America's Moral Crisis" -, einen Roman, aber auch Gedichte. In einem erzählt er in wenigen Zeilen, wie Politik funktioniert:
Jimmy Carter, geboren 1924 in Plains, Georgia, war 1977 bis 1981 Präsident der Vereinigten Staaten der USA. 1982 gründete er das Carter Center, eine unparteiische Nonprofit Einrichtung, die sich um nationale und internationale Konfliktlösungen bemüht. 2002 bekam Jimmy Carter den Friedensnobelpreis "für seine Jahrzehnte langen, unermüdlichen Anstrengungen, friedliche Lösungen für internationale Konflikte zu finden und Demokratie und Menschenrechte und wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern." Jimmy Carter hat 19 Bücher geschrieben: Lebenserinnerungen, politische Essays - der neueste ist gerade erschienen: "Our Endangered Values: America's Moral Crisis" -, einen Roman, aber auch Gedichte. In einem erzählt er in wenigen Zeilen, wie Politik funktioniert:
"Der Fortschritt hat es manchmal schwer
Als Abgeordneter in meinem Bundesstaat brachte ich mein erstes Gesetz ein, das besagte, dass Bürger nicht wählen können, nachdem sie gestorben sind. Meine Kollegen begegneten dem Problem mutig, debattierten hart darüber, ob, nachdem jemand gestorben war, drei Jahre angemessen seien, in denen die Familie - sich an ihn erinnernd - entscheide, wem eine geliebte Person die Stimme gegeben hätte, wenn sie den Wahltag noch erlebt hätte. Meine eigenen Nachbarn warnten mich, ich sei zu weit gegangen, das lang Bewährte zu ändern. Ich verlor die nächste Wahl und gewann nicht einen einzigen Bezirk mit einem Friedhof."
Jimmy Carter: "Angesichts der Leere". Gedichte. Übersetzt von Walter Grünzweig und Wolfgang Niehues. Weidle Verlag, Bonn 2005. 120 Seiten, 21 Euro. ISBN 393113587X.
Die wie aus tiefer Vergangenheit grüßende Ansicht einer Tür
 Jessica Backhaus wohnt seit 1993 zusammen mit ihrer Familie in dem Dorf Netno, 120 Kilometer östlich von Stettin, in Westpommern. Seit 2001 fotografiert Jessica Backhaus ihre Umgebung, ihre Nachbarn und deren Wohnungen. 94 Aufnahmen aus Hunderten von Filmrollen wurden für diesen Band ausgewählt. Es ist ein Rückblick auf ein Polen, das gerade dabei ist zu verschwinden. Ein Wohnzimmer, dessen Holztäfelung an eine Sauna denken lässt, in dessen Ecke ein übermannsgroßer Kühlschrank steht zwischen zwei Sesseln und einem runden Tischchen, dessen rote Decke bis auf den Fußboden reicht, auf der aber noch einmal eine kleine weiße Decke liegt, auf der eine Vase mit Kunststoffrosen steht.
Jessica Backhaus wohnt seit 1993 zusammen mit ihrer Familie in dem Dorf Netno, 120 Kilometer östlich von Stettin, in Westpommern. Seit 2001 fotografiert Jessica Backhaus ihre Umgebung, ihre Nachbarn und deren Wohnungen. 94 Aufnahmen aus Hunderten von Filmrollen wurden für diesen Band ausgewählt. Es ist ein Rückblick auf ein Polen, das gerade dabei ist zu verschwinden. Ein Wohnzimmer, dessen Holztäfelung an eine Sauna denken lässt, in dessen Ecke ein übermannsgroßer Kühlschrank steht zwischen zwei Sesseln und einem runden Tischchen, dessen rote Decke bis auf den Fußboden reicht, auf der aber noch einmal eine kleine weiße Decke liegt, auf der eine Vase mit Kunststoffrosen steht.
So etwas werden wir nicht mehr lange sehen können. Jessica Backhaus hat es festgehalten. Kalt, aber mit Sinn für die Monumentalität dieser Arrangements. Das Sofa mit der Häkeldecke darauf und dem Kreuz darüber, daneben das Bild von den herbstlichen Birken am Bach - sie sieht das Exotische daran. Aber sie macht sich nicht lustig. Manchmal fragt man sich, ob sie nicht mitgewirkt hat an der Einrichtung der Interieurs. Das altrosa glänzende Kissen zum Beispiel - hat sie es auf das Sofa gelegt?
Wer sich Zeit nimmt, der entdeckt die Schönheit dieser unserem Geschmack so fernen Welt. Die zwei Grüns einer Küchenwand zum Beispiel oder die wie aus tiefer Vergangenheit grüßende Ansicht einer Tür und eines Schaufensters - das öffnet einem die Augen für die eigene Umgebung. Nun betrachtet auch einer, der nichts gelernt hat als lesen und darum jahrzehntelang über die Türen alten Aufzüge, Fenstergriffe, all die zahllosen Details unseres Alltagslebens hinweg gesehen hatte, den Putz alter Häuser, Farbe und Form der Handseife, das Arrangement der Blumen auf dem Fernseher, Tapetenmuster und Jesusbildchen mit fast zärtlicher Aufmerksamkeit und versucht sie zu lesen als Spuren der Menschen, die ihre Nester mit ihnen schmücken. Die Augen dafür hat ihm Jessica Backhaus geöffnet mit ihrem Buch "Jesus and the Cherries", das sie hat einschlagen lassen in eine jener Plastikimitate von Häkeldeckchen, die er noch aus den westdeutschen Eisdielen der 60er Jahre kennt. Der Band führt auch in die eigene Vergangenheit.
Jessica Backhaus: "Jesus and the Cherries". Texte von Monika Rydiger und Stephan Schmidt-Wulffen. Kehrer Verlag, Heidelberg. 144 Seiten, 94 Farbbilder, Spitzendeckchen-Einband, 58 Euro. ISBN 393663663X.
 Erika Tophoven war zusammen mit ihrem Mann Elmar über Jahrzehnte die Übersetzerin Samuel Becketts. Ihr neuestes Buch, es ist opulent bebildert, trägt den Titel: "Beckett in Berlin". Sie erzählt darin von den sechs Wochen, die der irische Autor im Winter 1936-1937 in Berlin verbrachte. Als Grundlagen ihrer Arbeit nennt sie ein kleines dunkelrotes Notizbuch, das "Whoroscope notebook", in dem sich Vermerke aus den dreißiger Jahren finden, die Korrespondenz mit seinem Freund MacGreevy und als wichtigstes Stück sechs Hefte mit tagtäglichen Eintragungen von der Deutschlandreise im Winterhalbjahr 1936-1937.
Erika Tophoven war zusammen mit ihrem Mann Elmar über Jahrzehnte die Übersetzerin Samuel Becketts. Ihr neuestes Buch, es ist opulent bebildert, trägt den Titel: "Beckett in Berlin". Sie erzählt darin von den sechs Wochen, die der irische Autor im Winter 1936-1937 in Berlin verbrachte. Als Grundlagen ihrer Arbeit nennt sie ein kleines dunkelrotes Notizbuch, das "Whoroscope notebook", in dem sich Vermerke aus den dreißiger Jahren finden, die Korrespondenz mit seinem Freund MacGreevy und als wichtigstes Stück sechs Hefte mit tagtäglichen Eintragungen von der Deutschlandreise im Winterhalbjahr 1936-1937. Es sind 500 dicht beschriebene, schwer zu entziffernde Seiten. Tophovens Buch bietet keine Übersetzung der Beckettschen Notizen, sondern so etwas wie eine thematisch gegliederte Nacherzählung, die durch zahlreiche zusätzliche Informationen das Verständnis der Lage des dreißigjährigen Reisenden erheblich erleichtern. Es ist der Blick des späteren "Endspiel"-Autors auf Nazi-Deutschland. "Eintopf, pfui!" findet sich mehrfach im Tagebuch. Es ist nicht klar, ob es sich auf den neuen Kult, das Ritual des gemeinsamen Eintopfverzehrs, oder aber auf den Geschmack des Gerichts bezieht.
Im Zentrum des Buches stehen allerdings - wie auch im Zentrum von Becketts Berlin-Aufenthalt - die Museumsbesuche des irischen Autors. Beckett war ein großer Gemäldebetrachter. Er sah sich nicht nur viele an, er sah sie sich auch gründlich an. Manchmal war er mit einem Gemälde eine ganze Stunde beschäftigt. Dabei ging er ganz systematisch vor. Saal für Saal. Man kann an Hand des Tagebuches genau feststellen, was er wann gesehen hat. Man könnte die Hängung der Bilder danach rekonstruieren. Die Kommentare zu den Bildern sind, wenn man Tophovens Darstellung folgt, eher kurz und immer ein wenig ruppig. Nachdem er die Rembrandträume betrachtet hat, notiert Beckett: "Ich gäbe alle Rembrandts für den kleinen Brouwer-Hirten am Wege, der die Schalmei bläst." Oder seine Anmerkungen anlässlich der Arbeiten von Eduard Munch: "Die Zeichnung 'Krankes Mädchen' auch kaum mehr als hübsch. Woran liegt es, dass diese kompromisslosen Nordländer (Nolde & Hamsun ebenfalls) immer Gefahr laufen, alles zu kippen. Man findet es auch in der deutschen Gotik, mehr als in der englischen. Ein unverdauter Brocken von Naivität, bäuerisch grober Art, beinahe Debilität. Eine gelobte Debilität. Fast so als ob ein ganzer Nervenbereich im Kopf sich nie entwickelt hätte, nicht nur ein blinder Fleck, sondern ein Kretinismus, der noch kultiviert und in die Aussage mit hineingezogen wird. Eine gewollte Kargheit, höflich ausgedrückt, denn oft ist es vielmehr unbewusste Trivialität, ein Kant'scher Gedanke unter einer Präfektenmütze."
Erika Tophoven: "Becketts Berlin". Nicolai Verlag, Berlin 2005. Format: 21 x 22,5 cm, 105 s/w und 21 farbige Abbildungen, gebunden mit Schutzumschlag, 144 Seiten, 24,90 Euro. ISBN 3894791594.
Das Gefühl völliger Hilflosigkeit
 Überspringen Sie den einführenden Radioessay und überspringen Sie das Gespräch, das dessen Autor, der iranische Exilschriftsteller Said, mit dem ehemaligen Bayerischen Kultusminister Hans Maier führte. Beginnen Sie mit den Tagebuchnotizen Saids, und Sie werden nicht aufhören, bis Sie das Buch zu Ende gelesen haben. Es sind lakonische Notizen, die die Mauern einreißen, die wir errichten zwischen uns und dem, das wir nicht wahrnehmen wollen. Am 25. Juli 1996 notiert Said, was der oberste Staatsanwalt des Iran einem Journalisten zu dem neuen Gesetz gegen Diebstahl sagt: "Erst werden dem Dieb vier Finger der rechten Hand abgeschnitten; bei Rückfälligkeit werden alle Zehen des linken Fußes amputiert; sollte er wieder rückfällig werden, wird der Dieb zu lebenslänglicher Haft verurteilt; sollte er im Gefängnis oder während eines Freigangs erneut Diebstahl begehen, wird er hingerichtet."
Überspringen Sie den einführenden Radioessay und überspringen Sie das Gespräch, das dessen Autor, der iranische Exilschriftsteller Said, mit dem ehemaligen Bayerischen Kultusminister Hans Maier führte. Beginnen Sie mit den Tagebuchnotizen Saids, und Sie werden nicht aufhören, bis Sie das Buch zu Ende gelesen haben. Es sind lakonische Notizen, die die Mauern einreißen, die wir errichten zwischen uns und dem, das wir nicht wahrnehmen wollen. Am 25. Juli 1996 notiert Said, was der oberste Staatsanwalt des Iran einem Journalisten zu dem neuen Gesetz gegen Diebstahl sagt: "Erst werden dem Dieb vier Finger der rechten Hand abgeschnitten; bei Rückfälligkeit werden alle Zehen des linken Fußes amputiert; sollte er wieder rückfällig werden, wird der Dieb zu lebenslänglicher Haft verurteilt; sollte er im Gefängnis oder während eines Freigangs erneut Diebstahl begehen, wird er hingerichtet." Wir hatten das auch gelesen. Wir waren entsetzt. Dann blätterten wir weiter in unserer Zeitung. Dieser Satz hört sich an wie ein Urteil, aber er beschreibt nur, was wir taten und fortfahren zu tun. Ich weiß nicht, ob Said ein religiöser Mensch ist. Ich weiß nur, dass er Wert auf Religion legt. Er tut das, so ist mein Eindruck, aus Misstrauen gegenüber Menschen, denen es an Demut fehlt. Aber es bedarf nicht der Religion, um sich klar darüber zu werden, wie klein wir sind. Im Gegenteil. Den meisten Menschen dient die Religion nur dazu, sich und die Gemeinschaft, zu der sie gehören, aufzublasen. Es gibt eine kleine Stelle in dem Buch, da erliegt auch Said dieser Versuchung. Auf Seite 80 schreibt er: "Kann eine Religion aber überhaupt als Feind gelten? Die Frage muss verneint werden. Denn auch die Kultur des Orients wäre ohne den Islam undenkbar; Hafis ohne den Islam? So, wie der Okzident ohne Christentum der Kulturbarbarei verfallen wäre; Bach ohne Jesus von Nazareth?"
Das ist alles richtig. Bis auf das Wort von der "Kulturbarbarei". Das Christentum hat die Welt nicht von der Barbarei erlöst. Man muss nicht so weit gehen wie zum Beispiel Goethe und den Verdacht hegen, das Christentum habe die Antike in die Barbarei gestürzt, man kann einfach feststellen, dass es auch ohne Christentum Kultur gab, ja dass es sogar ohne das, was Said als Religion betrachtet, Kultur gibt. Ob der Mensch sich seinem Mitmenschen gegenüber menschlich verhält, ist nicht nur ganz unabhängig davon, welcher Religion er angehört, sondern auch davon, ob er überhaupt an ein höheres oder mehrere höhere Wesen glaubt. Saids Tagebuchnotizen laden ein zu einem Gespräch mit ihm. Sie sind so klar, so entschieden, dass man sich aufgefordert fühlt, ihm zu antworten, weil man weiß, er wird zuhören, er wird sich freuen über jede Entgegnung, und ihm wird es wiederum Freude machen zu entgegnen.
Nach den Tagebuchnotizen kommt "Mina - Eine Begegnung". Einen ergreifenderen Text habe ich nicht gelesen. Der Erzähler wird nach einer Lesung in einer Stadt im Ruhrgebiet von einer Iranerin angesprochen. Sie erzählt ihm, wie sie in Teheran eines Tages von den Revolutionsgardisten Khomeinis verhaftet, verhört und vergewaltigt wurde. Sie erzählt ihm, wie ihr die Flucht aus Persien gelang und wie ihr Mann es nicht ertrug, dass sie vergewaltigt worden war. Said erzählt das vorsichtig. Desto niederschmetternder ist die Wirkung. Das Gefühl völliger Hilflosigkeit, aus der nichts einen retten kann, wächst von Satz zu Satz. Es beginnt als Kopfidee und breitet sich dann im ganzen Körper aus, bis man davon angefüllt ist bis in die Fingerspitzen hinein.
Die Frau überlebt es. Sie schildert, wie: "Ich beschließe, nichts zu tun. Irgendwann werden die müde. Irgendwann werde ich bluten. Irgendwann werde ich ohnmächtig. Ich habe hier keine Aufgabe. Ich muss mir eine Aufgabe geben. Gegen den Schmerz. Gegen die Erniedrigung. Ich muss durchhalten. Das ist meine Aufgabe. Ich muss an etwas denken. An etwas glauben. Ich denke an meinen Mann. Daran, dass ich mit ihm, irgendwann, ein Kind haben will. Jemand spuckt auf etwas. Es geht wieder los. Wie lange kann ich aushalten? Wann werde ich endlich ohnmächtig? Warum nimmt mich Mahmud nicht in seine Arme? Immer an etwas anderes denken. Gegen den Schmerz denken. Gegen die Erniedrigung. An etwas Schönes denken. Van Gogh. Cafeterrasse bei Nacht. Van Gogh ist gut. Er ist unschuldig. Er hilft. Gegen den Schmerz. Gegen die Erniedrigung."
Van Gogh! In lange zurückliegenden Debatten über Ästhetik wurde uns gesagt, Texten könne auch noch, nachdem sie geschrieben wurden, neue Bedeutung zuwachsen. Van Gogh! Der Name liest sich jetzt - nach der Ermordung seines Nachkommen durch einen islamistischen Attentäter - nicht mehr tröstend, sondern er verschärft die Lage. Denn er kommt als Trost nicht mehr in Frage. Der Text ist somit radikaler, härter geworden. Härter als der Autor. Das steigert seine Schönheit.
Said: "Ich und der Islam". C.H. Beck Verlag, München 2005. 168 Seiten, Klappenbroschur, 14,90 Euro. ISBN 3406535534.
Das Meer, das die fünf Teile der Welt einhüllt
 Es ist ein Coffee-Table-Book. Es macht sich hervorragend in einem Wintergarten auf einem kleinen Marmortischchen. Wer gleich für Gesprächsstoff sorgen möchte, der lässt die Seiten 208-209 aufgeschlagen liegen. Sepiabraun liegt dann der fotografisch festgehaltene Vesuvausbruch von 1872 vor dem Betrachter. Wer zurückblättert, der findet einen kleinen Text von Blaise Cendrars aus dem Jahre 1948: "Ich sitze hinter der Landzunge des Posilip, unter einer Weinlaube im Garten eines Gasthofs in Pozzuoli. Ich trinke. Ich esse. Ich rauche. Ich rauche. Im Vorhafen schaukelt eine an einer Boje festgemachte Barke mit fremdländischer Takelage. Das Meer liegt einsam da; das Meer, das an den Kiesstrand klatscht; das Meer, das die fünf Teile der Welt einhüllt. Die Zeit vergeht. Ich esse, ich rauche, ich trinke und forsche am Horizont. Am Horizont ist das Meer nur noch ein dunkler Streifen. Ich trinke. Der Wein aus Pozzuoli ist gut, dick und dunkel wie Druckerschwärze."
Es ist ein Coffee-Table-Book. Es macht sich hervorragend in einem Wintergarten auf einem kleinen Marmortischchen. Wer gleich für Gesprächsstoff sorgen möchte, der lässt die Seiten 208-209 aufgeschlagen liegen. Sepiabraun liegt dann der fotografisch festgehaltene Vesuvausbruch von 1872 vor dem Betrachter. Wer zurückblättert, der findet einen kleinen Text von Blaise Cendrars aus dem Jahre 1948: "Ich sitze hinter der Landzunge des Posilip, unter einer Weinlaube im Garten eines Gasthofs in Pozzuoli. Ich trinke. Ich esse. Ich rauche. Ich rauche. Im Vorhafen schaukelt eine an einer Boje festgemachte Barke mit fremdländischer Takelage. Das Meer liegt einsam da; das Meer, das an den Kiesstrand klatscht; das Meer, das die fünf Teile der Welt einhüllt. Die Zeit vergeht. Ich esse, ich rauche, ich trinke und forsche am Horizont. Am Horizont ist das Meer nur noch ein dunkler Streifen. Ich trinke. Der Wein aus Pozzuoli ist gut, dick und dunkel wie Druckerschwärze." Wer das liest, spürt ein Gefühl der Seligkeit in sich aufsteigen. Er wird weiterlesen in diesem Buch, das also gar kein Coffee-Table-Book ist, sondern eine süchtig, eine sehnsüchtig machende Droge. "Legendäre Reisen in Italien" heißt der Band. Er dokumentiert nicht berühmte Italienreisen. Er bringt Zitate aus den Berichten von Stendhal, Nietzsche, Goethe, Ruskin, Musset, Hesse, Somerset Maugham - u.a. mit einer Feststellung aus dem Jahre 1929, die einen so traurig macht, dass man lauthals lachen muss: "Positano liegt an einem Südhang, und man darf damit rechnen, es im Sommer für sich allein zu haben" -, Isabelle Eberhardt, Thomas Mann, Seume, Maupassant, Dickens, Zola, Koeppen, Simone de Beauvoir usw. usw. Natürlich fallen einem sofort Namen ein, die fehlen. Um uns aufs B. zu beschränken zum Beispiel Bachmann und Brinckmann.
Aber das macht gar nichts. Da ist die um 1880 entstandene Aufnahme der Bucht von Sorrent. Oben rechts sitzt ein Mann, der noch die Tracht trägt, wie wir sie von den Gemälden Tischbeins und Kochs kennen. Und unten links in der Ferne sehe ich die Stelle, an der heute Freunde von mir ein Haus haben. Ich lege das Buch zur Seite, gehe ins Internet und buche einen Flug nach Neapel. Am 31. Oktober werde ich dort sein. Am Tag danach werde ich zu der Stelle fahren und mich exakt dorthin setzen, wo 1880 der Schäfer saß mit seiner Zipfelmütze. Ein teures Buch.
Nicht nur die alten Fotos, die alten Texte begeistern, sondern auch die Einführungen von Catherine Donzel. Die sieben Seiten zum "Italien der Reisenden" sind ein Wunderwerk. Wie schafft man es, auf so kleinem Raum soviel über das Land und seine Wahrnehmung so plastisch, so verführerisch zu schreiben?
Das Kapitel über die Reisen von Triest nach Taranto endet mit den Sätzen: "Und dann der blaue Schlund des ionischen Meeres, zweifelsohne unverändert seit der Zeit, als die Exilspartaner es überquerten, um Taranto zu gründen. Hier im Süden liegt Italien mit seinen Träumen. Hier liegen auch unsere Träume Italiens." Wer wichtige Tage und noch wichtigere Stunden seiner Pubertät im Museo Archeologico in Taranto verbrachte, der wird spätestens an dieser Stelle das Buch zur Seite legen und seinen Träumen folgen. Auch wenn er keinen Wintergarten hat.
Catherine Donzel, Marc Walter und Sabine Arque: "Legendäre Reisen in Italien". Aus dem Französischen von Angela Wagner. Geosaison, Frederking & Thaler. Mit 161 s/w- u. 145 Farbfotos, 4 Karten und einliegenden kleinen Faksimiles von u.a. einer Speisekarte, einem Theaterprogramm und einer Seilbahnwerbung, 320 Seiten, 50 Euro. ISBN 3894056436.
Alles Andre ist Firlefanz
 Harry Graf Kessler (1868-1937) hat Tagebuch geführt. Von 1880 bis 1937. Harry Graf Kessler gehörte zur europäisch-amerikanischen Elite seiner Zeit. Er kannte fast jeden, der in Politik, Wirtschaft und Kultur eine Rolle spielte. Er kannte die, die das Sagen hatten, und er kannte die, deren Bedeutung erst die Nachwelt erkannte. Er war ein Förderer zeitgenössischer Kunst und Literatur, und er war selbst ein Künstler und Literat. Es gibt in Deutschland keinen Autor, dessen Tagebücher mit den seinen zu vergleichen sind. Das hat zwei Gründe: Es gibt keinen Autor, dessen Leben auch nur annähernd mit dem Kesslers zu vergleichen wäre. Kesslers Schriftstellerdasein ging fast ganz in die Arbeit an den Tagebüchern. Hier ist zu beobachten die glückliche, auf fast jeder Zeile anregende Verbindung einer niemals ermüdenden Neugier auf die Welt und ihre Interpretation mit der von der eigenen Wahrnehmungslust begeisterten Formulierungsfreude eines Autors, der zu reich war, um wirklich Schriftsteller zu werden.
Harry Graf Kessler (1868-1937) hat Tagebuch geführt. Von 1880 bis 1937. Harry Graf Kessler gehörte zur europäisch-amerikanischen Elite seiner Zeit. Er kannte fast jeden, der in Politik, Wirtschaft und Kultur eine Rolle spielte. Er kannte die, die das Sagen hatten, und er kannte die, deren Bedeutung erst die Nachwelt erkannte. Er war ein Förderer zeitgenössischer Kunst und Literatur, und er war selbst ein Künstler und Literat. Es gibt in Deutschland keinen Autor, dessen Tagebücher mit den seinen zu vergleichen sind. Das hat zwei Gründe: Es gibt keinen Autor, dessen Leben auch nur annähernd mit dem Kesslers zu vergleichen wäre. Kesslers Schriftstellerdasein ging fast ganz in die Arbeit an den Tagebüchern. Hier ist zu beobachten die glückliche, auf fast jeder Zeile anregende Verbindung einer niemals ermüdenden Neugier auf die Welt und ihre Interpretation mit der von der eigenen Wahrnehmungslust begeisterten Formulierungsfreude eines Autors, der zu reich war, um wirklich Schriftsteller zu werden.Kesslers Vater war geadelt und bald darauf in den erblichen Grafenstand erhoben worden. Die Geschwindigkeit, mit der letzteres geschah, ließ den Verdacht aufkommen, Wilhelm I. habe nicht nur die Gräfin, Kesslers Mutter, reizend gefunden, sondern er sei auch der Vater Harrys gewesen. Da der Kaiser als er Harrys Mutter kennen lernte, die Siebzig schon lange überschritten hatte, scheint das zwar unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich und trug vielleicht auch ein wenig zur Wilhelm-Begeisterung - "Wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wiederhaben!" - bei. Buchhalterische Beckmesser freilich, die nichts auf die Schönheit des Klatsches geben, erinnern daran, dass der Kaiser Alice Kessler erst im Sommer 1870 kennenlernte. Er sprach sie höchstselbst auf der Kurpromenade in Bad Ems an. Er habe sich schon seit langem gewünscht, erklärte er, mit ihr bekannt gemacht zu werden. Nicht sehr originell, aber es hat geklappt. Harry war damals schon zwei Jahre alt. Seine kaiserliche Majestät kommt also als Erzeuger dieses "vielleicht kosmopolitischsten Menschen, der je gelebt hat" (so W.H. Auden) nicht in Betracht. Aber auch so war Harry ja nicht von schlechten Eltern. Sein Vater, ein Bankier, hatte es nach dem Krieg gegen Frankreich (1870/71) verstanden, ein Millionenvermögen zusammenzutragen, "dessen Anlagen sich von Kanada bis Persien über drei Kontinente erstreckte. Allein in der kanadischen Provinz Quebec gehörten ihm achthundert Quadratkilometer Wald." (Laird M. Easton: "Der rote Graf".)
 Der Vater hatte sein Hauptquartier in Paris, lebte aber auch in Berlin, New York und London. Im Sommer ging die Familie nach Deutschland, in die Kurbäder Ems und Kissingen. Man muss die vielfältigen Aktivitäten des Sohnes nicht kennen, um sich in den Tagebüchern zu verlieren. Man kann Kessler auch erst über die Lektüre der Tagebücher kennenlernen. Wer lieber erst etwas über den Mann wissen möchte, der lese zunächst Eastons große Biografie. Aber auch wer die Tagebücher liest, wird bald zu dieser Biografie greifen, um Näheres über den einen oder anderen Namen oder über die Bedeutung der einen oder anderen Person in Kesslers Leben zu erfahren. Die Tagebücher selbst nämlich sind zwar sehr schön gemacht, aber leider verzichten sie auf Anmerkungen. Außer höchst spartanischen Erläuterungen zu den erwähnten Personen findet sich nichts Erklärendes in den Bänden. Wer an die Akribie denkt, mit der Inge Jens die Tagebücher Thomas Manns kommentiert hat, trauert darüber, was ihm bei der Lektüre der Kessler-Tagebücher entgeht. So genießt man eben dumm, wenn Kessler am 8. Februar 1892 in New York überrascht notiert, dass im Anschluss an eine Abendgesellschaft, zu der nur die beste Gesellschaft eingeladen war, die Herren sich an der Garderobe mit Fäusten schlagen, um ihre Sachen zu bekommen.
Der Vater hatte sein Hauptquartier in Paris, lebte aber auch in Berlin, New York und London. Im Sommer ging die Familie nach Deutschland, in die Kurbäder Ems und Kissingen. Man muss die vielfältigen Aktivitäten des Sohnes nicht kennen, um sich in den Tagebüchern zu verlieren. Man kann Kessler auch erst über die Lektüre der Tagebücher kennenlernen. Wer lieber erst etwas über den Mann wissen möchte, der lese zunächst Eastons große Biografie. Aber auch wer die Tagebücher liest, wird bald zu dieser Biografie greifen, um Näheres über den einen oder anderen Namen oder über die Bedeutung der einen oder anderen Person in Kesslers Leben zu erfahren. Die Tagebücher selbst nämlich sind zwar sehr schön gemacht, aber leider verzichten sie auf Anmerkungen. Außer höchst spartanischen Erläuterungen zu den erwähnten Personen findet sich nichts Erklärendes in den Bänden. Wer an die Akribie denkt, mit der Inge Jens die Tagebücher Thomas Manns kommentiert hat, trauert darüber, was ihm bei der Lektüre der Kessler-Tagebücher entgeht. So genießt man eben dumm, wenn Kessler am 8. Februar 1892 in New York überrascht notiert, dass im Anschluss an eine Abendgesellschaft, zu der nur die beste Gesellschaft eingeladen war, die Herren sich an der Garderobe mit Fäusten schlagen, um ihre Sachen zu bekommen. Noch mit der Erinnerung an die jüngste Überschwemmung liest man eigentümlich berührt, was Kessler am 16. März über New Orleans schreibt: "Die weissgetünchten Häuser mit ihren grünen Läden erinnern an Italien. Weitvorspringende Terrassen auf Säulen ruhend überdachen die Fussteige; Gallerien und Veranden umgeben die Häuser oft bis zum obersten Stockwerk; man sieht, dass die Bewohner ihr Leben im Freien zubringen. Die Luft ist heute wie in Deutschland im Juni; blühende Rosen- und Jasmin-Sträuche ranken sich in den Vorstädten an den Häusern empor; die Gärten sind bunt vor Blüten und Blumen. Den fremdartigsten Eindruck macht der Markt; Neger und Chinesen, langhaarige Mexikaner und schwarzäugige Creolinnen wogen durcheinander, handelnd und keifend, mit Geschrei und Gebärden, in unbeschreiblichem Wirrwarr, und in diesem ganzen Völkergemisch hört man kaum ein Wort Englisch. Gerade hinter dem Markt läuft die Levee entlang, der Damm, der die Stadt vor den gelben, reissenden Fluten des Mississippi schützt; der Fluss ist nicht breiter wie die Elbe bei Hamburg aber vor der Stadt 250 Fuss tief. Mehrere zwei Stockwerke hohe Baumwolldampfer ankern rauchend an der Levee."
Und dann kommt der Satz, bei dem der Leser nach einer Erklärung schreien möchte: "Unten am Hafen steht eine Säule zur Erinnerung an die Befreiung von Louisiana vom Joch der Negerherrschaft durch die Bürger von New Orleans im September 1874." Nun eine "Negerherrschaft" hatte es nie gegeben. Am 14. September kam es allerdings zur größten Straßenschlacht der US-Geschichte als Angehörige einer militanten Weißenorganisation die Stadtregierung, die ihnen zu freundlich gegenüber den freigelassenen schwarzen Sklaven vorkam, bewaffnet attackierte. Die offizielle Geschichtsschreibung ist die eine Sache. Wie man die Geschichte heute in New Orleans sieht, darüber kann man sich im Internet informieren.
Dieser Hinweis ist jetzt schon zu lang, aber eine Stelle muss ich noch zitieren. Sie zeigt Kesslers Intelligenz, seine Lust an der Zuspitzung und die Ambivalenz seiner Ansichten. Sie zeigt auch, wie er sich steigert und in Rage schreibt, wie er nicht zurückschreckt vor dem, was ihm einfällt, sondern im Gegenteil dessen Extravaganz lustvoll genießt. Das macht die Lektüre, für alle die, die nicht nur Selbstbestätigung, sondern Widerspruch suchen, auf jeder Seite spannend. Am 7. Juni 1905 notiert Harry Graf Kessler in London: "Im Savoy gefrühstückt. Die Form des modernen Luxus das Hotel. Das Hotel entspricht demokratisch der Funktion des Palastes früherer Zeiten; große festliche Räume von immer steigendem Raffinement, die beste Küche, ein Überfluss an Dienerschaft und Comfort, aber statt für Einen für Hunderte, anonyme Hunderte. Es überflügelt allmählich den Palast selbst amerikanischer Millionäre. Hotels wie Savoy, Carlton, Ritz bieten mehr als wohl je der größte Luxus eines Crassus oder Soubise. Sie gehören zu den greifbarsten Zeichen einer neuen demokratischen, d.h. auf unübersehbar viele grosse Vermögen aufgebauten Kultur. - Aristokratie: wenige, benennbare grosse Vermögen. Demokratie: zahlreiche, anonyme grosse Vermögen. Der Reichtum bleibt die Axe, aber weniger greifbar. Demgegenüber giebt es nur Monarchie oder Büreaukratie, die auf Polizei und Waffen fundierte Macht. Demokratie verhält sich zu Aristokratie etwa wie Büreaukratie zu Monarchie. Alles Andre ist Firlefanz. Es giebt in der Gesellschaft nur diese vier Möglichkeiten. Die Sozialdemokratie ist ein büreaukratisches Ideal. - Anders ausgedrückt: es giebt nur zwei wirkliche soziale Mächte, den Besitz und das Schwert; und jede kann in zwei Formen sich äussern: durch Einzelne, greifbare Persönlichkeiten, oder durch viele, anonyme. Die Einzelnen, Greifbaren sind bei Waffengewalt der König, bei Besitzgewalt die Aristokratie, die Vielen, Anonymen bei Waffengewalt die Büreaukratie, bei Besitzgewalt die Demokratie. Die Büreaukratie ist das Kleingeld eines Königs, wie die Demokratie das Kleingeld einer Aristokratie. Natürlich giebt es Zwischenformen, Kombinationen aller Art; aber nur diese vier Elemente, aus denen sie bestehen können. Der Geist, die Ideen, die Kunst sind nur ein Aufputz, ein farbiger Schleier um diese Formen; oder Mittel, die Eine in die Andre umzuwandeln."
Neun Bände soll die Ausgabe der gesamten Tagebücher umfassen. Drei sind bisher erschienen:
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch". Zweiter Band, 1892-1897. Herausgegeben von Roland S. Kamzelak und Ulrich Ott. Klett-Cotta, Stuttgart 2004, Leinen mit eingelassenem Titelschild, Lesebändchen, im Grauschuber, 777 Seiten, 58 Euro. ISBN: 376819812X.
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch". Dritter Band, 1897-1905. Herausgegeben von Roland S. Kamzelak und Ulrich Ott. Klett-Cotta, Stuttgart 2004. Leinen mit eingelassenem Titelschild, Lesebändchen, im Grauschuber, 1199 Seiten, 63 Euro. ISBN 3768198138.
Harry Graf Kessler: "Das Tagebuch". Vierter Band, 1906-1914. Herausgegeben von Jörg Schuster unter Mitarbeit von Janna Brechmacher. Klett-Cotta, Stuttgart 2005. Leinen mit eingelassenem Titelschild, Lesebändchen, im Grauschuber, 32 Seiten s/w-Tafelteil, 1303 Seiten, 63 Euro. ISBN 3768198146.
Wer die Tagebücher liest oder auch nur in ihnen liest, wird schnell lesen wollen:
Laird M. Easton: "Der Rote Graf". Harry Graf Kessler und seine Zeit. Aus dem Amerikanischen von Klaus Kochmann. Klett Cotta, Stuttgart 2005. Leinen mit Schutzumschlag, Fadenheftung, Lesebändchen, 16 Seiten s/w-Tafelteil, 591Seiten, 39,50 Euro. ISBN 3608936947.
Ich verlor die nächste Wahl
 Jimmy Carter, geboren 1924 in Plains, Georgia, war 1977 bis 1981 Präsident der Vereinigten Staaten der USA. 1982 gründete er das Carter Center, eine unparteiische Nonprofit Einrichtung, die sich um nationale und internationale Konfliktlösungen bemüht. 2002 bekam Jimmy Carter den Friedensnobelpreis "für seine Jahrzehnte langen, unermüdlichen Anstrengungen, friedliche Lösungen für internationale Konflikte zu finden und Demokratie und Menschenrechte und wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern." Jimmy Carter hat 19 Bücher geschrieben: Lebenserinnerungen, politische Essays - der neueste ist gerade erschienen: "Our Endangered Values: America's Moral Crisis" -, einen Roman, aber auch Gedichte. In einem erzählt er in wenigen Zeilen, wie Politik funktioniert:
Jimmy Carter, geboren 1924 in Plains, Georgia, war 1977 bis 1981 Präsident der Vereinigten Staaten der USA. 1982 gründete er das Carter Center, eine unparteiische Nonprofit Einrichtung, die sich um nationale und internationale Konfliktlösungen bemüht. 2002 bekam Jimmy Carter den Friedensnobelpreis "für seine Jahrzehnte langen, unermüdlichen Anstrengungen, friedliche Lösungen für internationale Konflikte zu finden und Demokratie und Menschenrechte und wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern." Jimmy Carter hat 19 Bücher geschrieben: Lebenserinnerungen, politische Essays - der neueste ist gerade erschienen: "Our Endangered Values: America's Moral Crisis" -, einen Roman, aber auch Gedichte. In einem erzählt er in wenigen Zeilen, wie Politik funktioniert: "Der Fortschritt hat es manchmal schwer
Als Abgeordneter in meinem Bundesstaat brachte ich mein erstes Gesetz ein, das besagte, dass Bürger nicht wählen können, nachdem sie gestorben sind. Meine Kollegen begegneten dem Problem mutig, debattierten hart darüber, ob, nachdem jemand gestorben war, drei Jahre angemessen seien, in denen die Familie - sich an ihn erinnernd - entscheide, wem eine geliebte Person die Stimme gegeben hätte, wenn sie den Wahltag noch erlebt hätte. Meine eigenen Nachbarn warnten mich, ich sei zu weit gegangen, das lang Bewährte zu ändern. Ich verlor die nächste Wahl und gewann nicht einen einzigen Bezirk mit einem Friedhof."
Jimmy Carter: "Angesichts der Leere". Gedichte. Übersetzt von Walter Grünzweig und Wolfgang Niehues. Weidle Verlag, Bonn 2005. 120 Seiten, 21 Euro. ISBN 393113587X.
Die wie aus tiefer Vergangenheit grüßende Ansicht einer Tür
 Jessica Backhaus wohnt seit 1993 zusammen mit ihrer Familie in dem Dorf Netno, 120 Kilometer östlich von Stettin, in Westpommern. Seit 2001 fotografiert Jessica Backhaus ihre Umgebung, ihre Nachbarn und deren Wohnungen. 94 Aufnahmen aus Hunderten von Filmrollen wurden für diesen Band ausgewählt. Es ist ein Rückblick auf ein Polen, das gerade dabei ist zu verschwinden. Ein Wohnzimmer, dessen Holztäfelung an eine Sauna denken lässt, in dessen Ecke ein übermannsgroßer Kühlschrank steht zwischen zwei Sesseln und einem runden Tischchen, dessen rote Decke bis auf den Fußboden reicht, auf der aber noch einmal eine kleine weiße Decke liegt, auf der eine Vase mit Kunststoffrosen steht.
Jessica Backhaus wohnt seit 1993 zusammen mit ihrer Familie in dem Dorf Netno, 120 Kilometer östlich von Stettin, in Westpommern. Seit 2001 fotografiert Jessica Backhaus ihre Umgebung, ihre Nachbarn und deren Wohnungen. 94 Aufnahmen aus Hunderten von Filmrollen wurden für diesen Band ausgewählt. Es ist ein Rückblick auf ein Polen, das gerade dabei ist zu verschwinden. Ein Wohnzimmer, dessen Holztäfelung an eine Sauna denken lässt, in dessen Ecke ein übermannsgroßer Kühlschrank steht zwischen zwei Sesseln und einem runden Tischchen, dessen rote Decke bis auf den Fußboden reicht, auf der aber noch einmal eine kleine weiße Decke liegt, auf der eine Vase mit Kunststoffrosen steht. So etwas werden wir nicht mehr lange sehen können. Jessica Backhaus hat es festgehalten. Kalt, aber mit Sinn für die Monumentalität dieser Arrangements. Das Sofa mit der Häkeldecke darauf und dem Kreuz darüber, daneben das Bild von den herbstlichen Birken am Bach - sie sieht das Exotische daran. Aber sie macht sich nicht lustig. Manchmal fragt man sich, ob sie nicht mitgewirkt hat an der Einrichtung der Interieurs. Das altrosa glänzende Kissen zum Beispiel - hat sie es auf das Sofa gelegt?
Wer sich Zeit nimmt, der entdeckt die Schönheit dieser unserem Geschmack so fernen Welt. Die zwei Grüns einer Küchenwand zum Beispiel oder die wie aus tiefer Vergangenheit grüßende Ansicht einer Tür und eines Schaufensters - das öffnet einem die Augen für die eigene Umgebung. Nun betrachtet auch einer, der nichts gelernt hat als lesen und darum jahrzehntelang über die Türen alten Aufzüge, Fenstergriffe, all die zahllosen Details unseres Alltagslebens hinweg gesehen hatte, den Putz alter Häuser, Farbe und Form der Handseife, das Arrangement der Blumen auf dem Fernseher, Tapetenmuster und Jesusbildchen mit fast zärtlicher Aufmerksamkeit und versucht sie zu lesen als Spuren der Menschen, die ihre Nester mit ihnen schmücken. Die Augen dafür hat ihm Jessica Backhaus geöffnet mit ihrem Buch "Jesus and the Cherries", das sie hat einschlagen lassen in eine jener Plastikimitate von Häkeldeckchen, die er noch aus den westdeutschen Eisdielen der 60er Jahre kennt. Der Band führt auch in die eigene Vergangenheit.
Jessica Backhaus: "Jesus and the Cherries". Texte von Monika Rydiger und Stephan Schmidt-Wulffen. Kehrer Verlag, Heidelberg. 144 Seiten, 94 Farbbilder, Spitzendeckchen-Einband, 58 Euro. ISBN 393663663X.