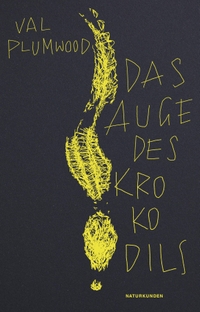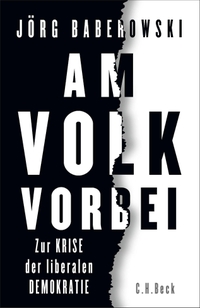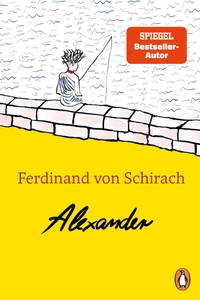Außer Atem: Das Berlinale Blog
Erzählt von einer Mordserie an Roma: Bence Fliegaufs 'Just the Wind' (Wettbewerb)
Von Lukas Foerster
16.02.2012.
Ein Tag im Leben einer Familie ungarischer Roma in einem kleinen Dorf, ausgehend von den schlaftrunkenen, gemeinsamen, größtenteils sprachlosen Tagesvorbereitungen in der digitalen Dunkelheit des beginnenden Morgengrauens. Dann splittet der Film sich auf in drei Stränge und verfolgt: Mutter, Tochter, Sohn. "Verfolgt" ganz buchstäblich, denn die Kamera klebt oft am Rücken, im Nacken der Protagonisten, wie sie sich von einem Ort zum nächsten bewegen, wie sich voneinander trennen, wie sich ihre Wege gelegentlich überschneiden und wie sie schließlich wieder zusammenkommen. Die Mutter Mari versucht mit mehreren Jobs ihre Familie über Wasser zu halten und versinkt doch in Schulden (ihr Mann lebt in Kanada und hofft, seine Angehörigen bald nachholen zu können). Die Tochter Anna geht zur Schule, zeichnet auf dem Pausenhof dunkle Engel und tupft sich blaue Flecken auf die Fingernägel, später geht sie mit einem jungen Mädchen baden. Der Sohn Rio schwänzt die Schule und richtet sich im Wald in einem Bunker häuslich ein. Das ist keine Marotte, sondern vernünftig. Denn es herrscht Krieg.
Wenn Anna zur Schule geht, begegnet sie einer Gruppe Männer, die sie auffordern, ihr Handy nicht auszuschalten: Eine Art Bürgerwehr der örtlichen Roma-community, die sich gebildet hat, nachdem eine ganze Familie von rassistischen Mördern kaltblütig niedergemetzelt wurde - Bence (früher Benedek) Fliegaufs Film ist die Dramatisierung einer Mordserie, die Ungarn zwischen 2008 und 2009 in Atem hielt und doch nur der offensichtlichste Ausdruck des tief in der Bevölkerung - nicht nur der Ungarns, selbstverständlich - verankerten Antiziganismus war. Rechtsextreme Milizen, die vorgeben, die aufrechte magyarische Bevölkerung vor Roma-Übergriffen beschützen zu wollen, existieren nach wie vor, oft unter fast schon ausdrücklicher Duldung der nationalkonservativen Fidesz-Regierung.
"Just the Wind" möchte, so scheint es, mindestens zweierlei gleichzeitig: Einerseits geht es darum, Alltag als permanenten Ausnahmezustand erfahrbar zu machen, um Subjektivierung, um die unbedingte Nähe zu den Protagonisten und deren Sensorium. Rios ängstliche Blicke auf ein schwarzes Auto, das ein paar Meter weit neben ihm her fährt. Annas gesenkter Kopf, wenn sie durch die Straßen ihres Wohnorts läuft, von dem sie möglichst wenig sehen und hören möchte. Manchmal dazu monotone Klavieranschläge, keine Melodien, nur einschnürende Klangwiederholungen, die sich irgendwann zu einem Ambient-Teppich zu verdichten scheinen.
Andererseits will der Film auch so etwas wie eine Gesamtschau: ein soziales Feld eröffnen, zeigen, wie die Roma mit der ungarischen Gesellschaft interagieren, wer mit ihnen redet und wer nicht, was für Optionen sie haben. Einmal, in der einzigen schlecht, weil sichtbar konstruierten, aber gerade deswegen sehr instruktiven Szene, belauscht Rio, wie zwei Polizisten sich über die Morde unterhalten und einer von ihnen nicht nur ein wenig Verständnis für die Täter zeigt.

Das doppelte Interesse des Films schreibt sich direkt in die Kamerabewegung ein. Dominant ist jene handgeführte Klammer- und Verfolgungsbewegung, die im Festivalkino seit Jahren dauerpräsent ist - und in deren Handhabe Fliegaufs Landsmann Bela Tarr schon früh zur Meisterschaft gelangt war. Bestimmend für den Film sind jedoch auch die Seitenblicke, die kurzen Ausflüge des Blicks, die gewöhnlich nicht auf ein Mehr an Alltag abzielen, auf ein Moment der Kontingenz, sondern die direkt Informationswert haben: Was sind das für Typen, die sich in der Bürgerwehr organisieren (Machos, natürlich), was ist das für ein Typ, für den Mari putzen geht (auch ein Macho, natürlich), was ist das für ein Typ, der die Roma-Kinder bei sich Playstation spielen lässt (ein ziemlich heruntergekommener).
In derartigen Markierungen offenbart sich, wie dicht und konzentriert der Film, der lange vorgibt, nur einen beliebigen Tag darzustellen, gebaut ist. Fliegauf ist ein zu geschickter Regisseur (und bis zu einem gewissen Grad ist das tatsächlich ein Vorwurf, obwohl mich "Just the Wind" durchaus beeindruckt hat), als dass er das dramaturgische Prinzip seines Films offen ausstellen würde. "Just the Wind" löst das Doppelinteresse an subjektiver Erfahrung und objektivem Erkenntnisinteresse bis zum Ende nicht in die eine oder andere Richtung auf - oder erst dann, wenn der unerbittliche Verlauf der Ereignisse ihm diese Alternative abnimmt. Doch noch in der letzten Einstellung, der eines düsteren, menschenleeren Korridors, kann man einer Erfahrungsdimension nachspüren, einer jetzt körperlosen, gespenstischen.
Da der Wettbewerb nun mal ein Wettbewerb ist, eine Prognose: "Just the Wind" wäre ein logischer Siegerfilm; vielleicht sogar ein zu logischer, das könnte sein größtes Problem werden.
Lukas Foerster
"Csak a szél - Just the Wind". Regie: Bence Fliegauf. Mit Lajos Sárkány, Katalin Toldi, Gyöngyi Lendvai, György Toldi u.a., Ungarn / Deutschland / Frankreich 2012, 98 Minuten. (Vorführtermine)
Kommentieren