Magazinrundschau
Ein Faible für Satire und Demokratie
Ein Blick in internationale Magazine. Jeden Dienstag Mittag
22.09.2020. Die London Review erinnert an die Siebziger, als sich die Putzfrauen von London gewerkschaftlich zu organisieren begannen. Ohne Organisation geht gar nichts, lernen auch Aktivisten in Chicago, die Obdachlose in ein Sheraton Hotel einquartierten, erzählt Harper's, das außerdem die Synthesizer-Pionierin Wendy Carlos vorstellt. Pitchfork erzählt, wie Enyas Balladen aus den Achtzigern Melodiker wie Weyes Blood ebenso beeinflusst haben wie die Death Metal Band Blood Incantation oder den Avantgardisten Oneohtrix Point Never. Atlantic warnt die Qualitätspresse: Lügen sind nicht einfach andere Fakten. Das sollte auch Facebook kapieren, meint Bloomberg. Der Guardian spuckt seinen genveränderten Lachs aus.
London Review of Books (UK), 24.09.2020
 Wer sich für die Geschichte der Frauenbewegung in Britannien interessiert, sollte sich nicht lange mit Philippa Lowthorpes oberflächlichem Film "Misbehaviour" aufhalten, meint Jenny Turner. Sie rät stattdessen zu Margaretta Jollys fantastischer Oral History "Sisterhood and After", ein epochales Werk, das strikt zwischen feministischer Theorie und sozialer Bewegung unterscheidet, besonders die "Aura des Augenblicks" betont und um die beiden spektakulärsten Momente der Bewegung kreist, die Proteste gegen Bob Hopes schmierige Miss-World-Wahlen 1970 und Greenham Common Women's Peace Camp in den Achtzigern. Sehr empfehlen kann Turner aber auch die wieder ausgegrabene und sehr bewegende Dokumentation "Nightcleaners" von 1975, in der das Berwick Street Film Collective vom heldinnenhaften Versuch Londoner Putzfrauen erzählt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ein echter Kontrapunkt zum liberalen Mittelklasse- oder Medien-Feminismus, meint Turner: "'Der Arzt hat mir geraten aufzuhören, sagt die in offenkundiger Erschöpfung rauchende und schwitzende Annie, 'ich glaube, mein Körper ist müde. Das geht aufs Gewicht und auf Herz.' Die Frauen müssen arbeiten, sagten sie, weil ihre Männer nicht genug verdienen. Sie konnten nicht zu Hause bei den Kindern bleiben, und eben weil sie Kinder hatten und Hausarbeit zu erledigen, mussten sie nachts arbeiten. 'Keine Frau putzt nachts, wenn sie es nicht wirklich muss', sagt Elsie. 'Es gibt viele kaputte Ehen unter den Putzfrauen, das haben Sie wahrscheinlich selbst schon rausgefunden. Wissen Sie, alle sind müde, aber sie wollen das nicht ihrem Mann sagen - sie wollen nur schlafen und ihre Ruhe haben.' Von Anfang an galt 'Nightcleaners' als abschreckend avantgardistisch: Jump Cuts, lange schwarze Pausen, eine große Schere zwischen Bild und Ton, Fetzen der 'Seeräuber Jenny' und Scott Joplins 'Maple Leaf Rag'. Alles ist schwer, unbequem und unangenehm, alle sind erschöpft und wissen, dass sie scheitern werden, wahrscheinlich selbst die Filmemacher, die ahnen mussten, dass ihre Arbeit für die Menschen, um die es ging, von keinerlei Nutzen war. Und trotzdem: Die Interview sind großartig und die Gesichter wunderschön. Annie, die so fertig und niedergeschlagen aussah, wird ein wenig später gezeigt, wie sie mit ihren Kindern einkaufen geht. Alle haben ein Lachen im Gesicht."
Wer sich für die Geschichte der Frauenbewegung in Britannien interessiert, sollte sich nicht lange mit Philippa Lowthorpes oberflächlichem Film "Misbehaviour" aufhalten, meint Jenny Turner. Sie rät stattdessen zu Margaretta Jollys fantastischer Oral History "Sisterhood and After", ein epochales Werk, das strikt zwischen feministischer Theorie und sozialer Bewegung unterscheidet, besonders die "Aura des Augenblicks" betont und um die beiden spektakulärsten Momente der Bewegung kreist, die Proteste gegen Bob Hopes schmierige Miss-World-Wahlen 1970 und Greenham Common Women's Peace Camp in den Achtzigern. Sehr empfehlen kann Turner aber auch die wieder ausgegrabene und sehr bewegende Dokumentation "Nightcleaners" von 1975, in der das Berwick Street Film Collective vom heldinnenhaften Versuch Londoner Putzfrauen erzählt, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Ein echter Kontrapunkt zum liberalen Mittelklasse- oder Medien-Feminismus, meint Turner: "'Der Arzt hat mir geraten aufzuhören, sagt die in offenkundiger Erschöpfung rauchende und schwitzende Annie, 'ich glaube, mein Körper ist müde. Das geht aufs Gewicht und auf Herz.' Die Frauen müssen arbeiten, sagten sie, weil ihre Männer nicht genug verdienen. Sie konnten nicht zu Hause bei den Kindern bleiben, und eben weil sie Kinder hatten und Hausarbeit zu erledigen, mussten sie nachts arbeiten. 'Keine Frau putzt nachts, wenn sie es nicht wirklich muss', sagt Elsie. 'Es gibt viele kaputte Ehen unter den Putzfrauen, das haben Sie wahrscheinlich selbst schon rausgefunden. Wissen Sie, alle sind müde, aber sie wollen das nicht ihrem Mann sagen - sie wollen nur schlafen und ihre Ruhe haben.' Von Anfang an galt 'Nightcleaners' als abschreckend avantgardistisch: Jump Cuts, lange schwarze Pausen, eine große Schere zwischen Bild und Ton, Fetzen der 'Seeräuber Jenny' und Scott Joplins 'Maple Leaf Rag'. Alles ist schwer, unbequem und unangenehm, alle sind erschöpft und wissen, dass sie scheitern werden, wahrscheinlich selbst die Filmemacher, die ahnen mussten, dass ihre Arbeit für die Menschen, um die es ging, von keinerlei Nutzen war. Und trotzdem: Die Interview sind großartig und die Gesichter wunderschön. Annie, die so fertig und niedergeschlagen aussah, wird ein wenig später gezeigt, wie sie mit ihren Kindern einkaufen geht. Alle haben ein Lachen im Gesicht."Wenn die Engländer die Union mit Schottland retten wollen, sollten sie nicht britischer werden, meint der Historiker Neal Ascherson in einem Abgesang auf die zentralistische Monarchie des 17. Jahrhundert, sondern im Gegenteil englischer: "Britannien ist ein eingebildetes Königreich, das in seiner Vorstellung über bloßen Nationalstaaten schwebt; England ist ein Land wie seine Nachbarstaaten. Britannien ist außergewöhnlich und denkt sich selbst in Superlativen (das weltbeste, weltweit führende, effizienteste Land auf dem Planeten); England ist ein mittelgroßes Land mit erstklassigen Wissenschaftlern und einem verkommenen Management. Britannien träumt davon, eine stolze, schwerbewaffnete Freibeutermacht zu werden, die allen internationalen Regeln trotzt; England ist eine bescheidene, skeptische Nation mit einem Faible für Satire und Demokratie."
Guardian (UK), 21.09.2020
Magyar Narancs (Ungarn), 27.08.2020
 Anlässlich des Beethoven-Jahres spricht der Pianist András Schiff im Interview mit Judit Rácz u.a. über die entschwundene Klangvielfalt: "Wir verzerren die Stücke zwar nicht, doch dadurch, dass heutzutage jeder auf einem Steinway spielt, wird das Klangbild verengt. Die Menschen haben die Freude an der Vielfältigkeit verloren. In den Zeiten von Beethoven gab es allein in Wien um die einhundert Klavierbauer, was zu sehr vielfältigen Klavierklängen führte. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde viel auf Bösendorfer, Bechstein und Pleyel gespielt, doch nach dem Kriege erlangte Steinway fast eine Monopolstellung. (...) (Der Steinway) kann fast alles, aber es fällt ihm zum Beispiel in der Kammermusik schwer, sich unter die anderen Instrumenten oder die Gesangstimme zu mischen. (...) Ich habe vor kurzem Chopin auf einem Pleyel-Piano gespielt, auf dem Chopin komponierte. Auf dem ist Chopin ein ganz anderer Komponist als auf einem Steinway. Der Steinway ist ein Elefant. Wären doch die Pianisten ein bisschen neugieriger und würden sie doch auf alten Klavieren spielen, damit sie erfahren, wie die Stücke damals geklungen haben mögen, dann würden sie auch auf dem Steinway anders spielen."
Anlässlich des Beethoven-Jahres spricht der Pianist András Schiff im Interview mit Judit Rácz u.a. über die entschwundene Klangvielfalt: "Wir verzerren die Stücke zwar nicht, doch dadurch, dass heutzutage jeder auf einem Steinway spielt, wird das Klangbild verengt. Die Menschen haben die Freude an der Vielfältigkeit verloren. In den Zeiten von Beethoven gab es allein in Wien um die einhundert Klavierbauer, was zu sehr vielfältigen Klavierklängen führte. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde viel auf Bösendorfer, Bechstein und Pleyel gespielt, doch nach dem Kriege erlangte Steinway fast eine Monopolstellung. (...) (Der Steinway) kann fast alles, aber es fällt ihm zum Beispiel in der Kammermusik schwer, sich unter die anderen Instrumenten oder die Gesangstimme zu mischen. (...) Ich habe vor kurzem Chopin auf einem Pleyel-Piano gespielt, auf dem Chopin komponierte. Auf dem ist Chopin ein ganz anderer Komponist als auf einem Steinway. Der Steinway ist ein Elefant. Wären doch die Pianisten ein bisschen neugieriger und würden sie doch auf alten Klavieren spielen, damit sie erfahren, wie die Stücke damals geklungen haben mögen, dann würden sie auch auf dem Steinway anders spielen."Artforum (USA), 22.09.2020
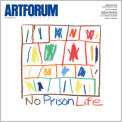 Im neuen Heft unterhält sich die Autorin Rachel Kushner mit der Kunsthistorikerin Nicole R. Fleetwood über deren neues Buch "Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration", einen Index aktueller Kunst von Gefängnisinsassen, zu dem es auch eine Ausstellung im MoMA geben soll. Hier erklärt Fleetwood ihren Ansatz im Hinblick auf eine andere Kunstgeschichte: "I war sehr interessiert an 'cultural mapping', wörtlich und symbolisch - daran, Künstler in Isolation mit anderen in Kontakt zu bringen. Oft wird in diesem Kontext marginalisierend von Autodidaktik außerhalb institutioneller Beziehungen gesprochen. Das Gegenteil der Fall: In dieser Kunst geht es nur um institutionelle Beziehungen. Zieht man den immensen Effekt der Gefängniskultur auf die Gesellschaft in Betracht, wird klar, dass ein Künstler, der eingesperrt ist oder war, im Zentrum kultureller Produktion steht. Ich wollte diese Künstler ins Zentrum der Gegenwartskunst einschreiben. Es war mir wichtig, das Buch mit ihnen und für ihre Angehörigen als das erste Publikum zu schreiben. Durch den Fond 'Kunst für Gerechtigkeit' war es der Harvard University Press möglich, Gefangenen eine Paperback-Ausgabe des Buches umsonst zugänglich zu machen … Es ging darum, die Grenzen der Museen und andere Kunst-Institutionen zu erweitern. Ich denke, es handelt sich oft um Grenzen, die durch träges Denken und Mangel an Neugier und Engagement jenseits des bestehenden Wissens entstehen. Es war nicht mein Ziel, Kategorien wie 'Volkskunst' oder 'Art Brut' infrage zu stellen, sondern eher, das System der Bewertung und des Werts zu hinterfragen, das beeinflusst, wie wir Museen, Gefängnisse, Künstler und Häftlinge begreifen … Das Buch zeigt, wie Menschen in Gefangenschaft mit den Bedingungen des Eingesperrtseins experimentieren, mit Materialknappheit, räumlicher Begrenzung und Strafe, um sich etwas anderes 'auszumalen' als nur ihre Unfreiheit."
Im neuen Heft unterhält sich die Autorin Rachel Kushner mit der Kunsthistorikerin Nicole R. Fleetwood über deren neues Buch "Marking Time: Art in the Age of Mass Incarceration", einen Index aktueller Kunst von Gefängnisinsassen, zu dem es auch eine Ausstellung im MoMA geben soll. Hier erklärt Fleetwood ihren Ansatz im Hinblick auf eine andere Kunstgeschichte: "I war sehr interessiert an 'cultural mapping', wörtlich und symbolisch - daran, Künstler in Isolation mit anderen in Kontakt zu bringen. Oft wird in diesem Kontext marginalisierend von Autodidaktik außerhalb institutioneller Beziehungen gesprochen. Das Gegenteil der Fall: In dieser Kunst geht es nur um institutionelle Beziehungen. Zieht man den immensen Effekt der Gefängniskultur auf die Gesellschaft in Betracht, wird klar, dass ein Künstler, der eingesperrt ist oder war, im Zentrum kultureller Produktion steht. Ich wollte diese Künstler ins Zentrum der Gegenwartskunst einschreiben. Es war mir wichtig, das Buch mit ihnen und für ihre Angehörigen als das erste Publikum zu schreiben. Durch den Fond 'Kunst für Gerechtigkeit' war es der Harvard University Press möglich, Gefangenen eine Paperback-Ausgabe des Buches umsonst zugänglich zu machen … Es ging darum, die Grenzen der Museen und andere Kunst-Institutionen zu erweitern. Ich denke, es handelt sich oft um Grenzen, die durch träges Denken und Mangel an Neugier und Engagement jenseits des bestehenden Wissens entstehen. Es war nicht mein Ziel, Kategorien wie 'Volkskunst' oder 'Art Brut' infrage zu stellen, sondern eher, das System der Bewertung und des Werts zu hinterfragen, das beeinflusst, wie wir Museen, Gefängnisse, Künstler und Häftlinge begreifen … Das Buch zeigt, wie Menschen in Gefangenschaft mit den Bedingungen des Eingesperrtseins experimentieren, mit Materialknappheit, räumlicher Begrenzung und Strafe, um sich etwas anderes 'auszumalen' als nur ihre Unfreiheit."Harper's Magazine (USA), 01.10.2020
 Sehr ausführlich befasst sich Will Stephenson mit Amanda Sewells vor kurzem veröffentlichter Biografie über die Synthesizer-Pionierin Wendy Carlos, die vielen wohl vor allem für ihre düster dräuenden Soundtrack-Kompositionen zu Stanley Kubricks "Clockwork Orange" und "The Shining" und für ihr elektronisches "Switched On Bach"-Album bekannt ist (mehr zu dessen mühsamer Entstehung bereits in dieser Magazinrundschau). Letzteres wird heute gerne als Skurrilität abgetan. "Es ist schwierig geworden, die Provokation zu hören, die in diesem Album steckt. Diese hat zu tun mit dem unerwarteten, aber profunden Einverständnis zwischen Bachs Musik und dem frühen Synthesizer. In diesem Bündnis liegt einfach etwas urwüchsig stimmiges. Bach selbst war ein Techniker und Instrumentekonstrukteur. ... Hinzu kommt noch die grundlegende Präzision und täuschende Einfachheit dieser Musik. 'Bach repräsentiert den Triumph der reinen Logik', schrieb der Pianist Jeremy Denk einmal. 'Er erfasst tiefste Gefühle, bleibt dabei aber streng logisch und zeigt auf diese Weise, dass zwischen beiden Geboten kein Widerspruch besteht.' Dies kam der nicht nur der (depressiven) Physikstudentin in Carlos entgegen, sondern passte auch zu den spezifischen Möglichkeiten und Begrenzungen des musikalischen Mediums. Akkorde zum Beispiel konnte der Moog-Synthesizer kaum hervorbringen. Aus ihm kam lediglich eine Note nach der anderen. ... Und wie das Cembalo war das Keyboard auch nicht kontaktempfindlich, was es erschwerte, die hierarchischen Beziehungen zwischen Melodiestimmen auf eine Weise hervorzubringen, wie es einem Pianisten instinktiv gelingt. In dieser Hinsicht, war der Moog die perfekte Maschine, um tatsächliche Kontrapunkte herzustellen, etwas, womit wir Bach fast schon synonymhaft verbinden." Für Glenn Gould "repräsentierte 'Switched on Bach' jene Form unmenschlicher Perfektion, auf die er zwar abzielte, die er aber auch für unerreichbar hielt. Er hatte Carlos zu Gast in einer Sendung für das kanadische Radio, in der er das Album als 'eine der aufregendsten Leistungen der Musikindustrie in dieser Generation' und 'als eines der großen Meisterstücke in der Geschichte des Klavierspiels' bezeichnete." Das Album selbst ist auf Youtube leider nicht zu finden, auch in den Streamingdiensten schlägt es nicht auf - offenbar eine Rückzugsgeste der Komponistin. Dafür gibt es ein BBC-Interview aus den späten 80ern, das die Komponistin in ihrem beeindruckenden Studio zeigt:
Sehr ausführlich befasst sich Will Stephenson mit Amanda Sewells vor kurzem veröffentlichter Biografie über die Synthesizer-Pionierin Wendy Carlos, die vielen wohl vor allem für ihre düster dräuenden Soundtrack-Kompositionen zu Stanley Kubricks "Clockwork Orange" und "The Shining" und für ihr elektronisches "Switched On Bach"-Album bekannt ist (mehr zu dessen mühsamer Entstehung bereits in dieser Magazinrundschau). Letzteres wird heute gerne als Skurrilität abgetan. "Es ist schwierig geworden, die Provokation zu hören, die in diesem Album steckt. Diese hat zu tun mit dem unerwarteten, aber profunden Einverständnis zwischen Bachs Musik und dem frühen Synthesizer. In diesem Bündnis liegt einfach etwas urwüchsig stimmiges. Bach selbst war ein Techniker und Instrumentekonstrukteur. ... Hinzu kommt noch die grundlegende Präzision und täuschende Einfachheit dieser Musik. 'Bach repräsentiert den Triumph der reinen Logik', schrieb der Pianist Jeremy Denk einmal. 'Er erfasst tiefste Gefühle, bleibt dabei aber streng logisch und zeigt auf diese Weise, dass zwischen beiden Geboten kein Widerspruch besteht.' Dies kam der nicht nur der (depressiven) Physikstudentin in Carlos entgegen, sondern passte auch zu den spezifischen Möglichkeiten und Begrenzungen des musikalischen Mediums. Akkorde zum Beispiel konnte der Moog-Synthesizer kaum hervorbringen. Aus ihm kam lediglich eine Note nach der anderen. ... Und wie das Cembalo war das Keyboard auch nicht kontaktempfindlich, was es erschwerte, die hierarchischen Beziehungen zwischen Melodiestimmen auf eine Weise hervorzubringen, wie es einem Pianisten instinktiv gelingt. In dieser Hinsicht, war der Moog die perfekte Maschine, um tatsächliche Kontrapunkte herzustellen, etwas, womit wir Bach fast schon synonymhaft verbinden." Für Glenn Gould "repräsentierte 'Switched on Bach' jene Form unmenschlicher Perfektion, auf die er zwar abzielte, die er aber auch für unerreichbar hielt. Er hatte Carlos zu Gast in einer Sendung für das kanadische Radio, in der er das Album als 'eine der aufregendsten Leistungen der Musikindustrie in dieser Generation' und 'als eines der großen Meisterstücke in der Geschichte des Klavierspiels' bezeichnete." Das Album selbst ist auf Youtube leider nicht zu finden, auch in den Streamingdiensten schlägt es nicht auf - offenbar eine Rückzugsgeste der Komponistin. Dafür gibt es ein BBC-Interview aus den späten 80ern, das die Komponistin in ihrem beeindruckenden Studio zeigt: Im Mai übernahmen Aktivisten in Chicago ein pleite gegangenes vierstöckiges Sheraton Hotel und quartierten dort Obdachlose ein. Ihre Vorstellungen waren heroisch - naiv, aber heroisch, meint Wes Enzinna, der selbst dort mithalf: Autonomie, Teilen, Sex und Drogen sollten erlaubt sein, keine Polizei. Das Experiment lief nach kürzester Zeit aus dem Ruder, aber dennoch: War es schlechter als die Zustände, in denen die Obdachlosen zuvor gelebt hatten? Kurz vor dem Ende des Experiments brach gegen 3 Uhr morgens auf dem Parkplatz vor dem Hotel, eine Schlägerei aus: "Steve, der gerade draußen war und die Menge kontrollierte, kam mit erhobenen Händen rein und sagte: 'Darauf lasse ich mich nicht ein.' Die anderen Freiwilligen taten dasselbe. Am Ende verpuffte der Kampf, aber ich fragte mich, was Steve oder irgendjemand anders getan hätte, wenn die Gewalt noch weiter eskaliert wäre, da klar war, dass die Freiwilligen weder die Fähigkeit noch die Willenskraft zum Eingreifen hatten. Bedeutete keine Polizei wirklich, Menschen gegeneinander kämpfen zu lassen? Waren die AktivistInnen einfach so überwältigt, dass sie aufgaben? Oder mussten sie ihrem Experiment irgendwo eine Grenze setzen, wobei sie entschieden, dass der Parkplatz außerhalb der Reichweite ihrer Ideale lag? Die Antwort war wahrscheinlich etwas von allen dreien. Ich hatte dafür Verständnis. Ich war auch nicht herbeigeeilt, um einzugreifen. Ich hätte es auch nicht gewollt. Ich wusste auch, dass die Polizei die Situation nicht besser gemacht hätte. Sie wäre eher schlechter geworden, insbesondere für zwei Afroamerikaner. Also, nein, es war nicht so, dass der Kampf gezeigt hätte, dass wir die Polizei brauchten, oder dass die Abolitionisten naive Idealisten waren - sie wollten nicht tausend Sheratons, sie wollten eine Welt, in der keine Sheratons notwendig waren - aber es zeigte doch, dass die Abolitionisten nicht wussten was sie tun sollten, wenn die Handlungen einiger das Wohlergehen anderer bedrohten."
The Atlantic (USA), 22.09.2020
 Wenn Donald Trump diese Wahlen gewinnt, ist die Qualitätspresse daran nicht unschuldig, meint James Fallows, der sich über die faule Vorstellung ärgert, es sei irgendwie "objektiv", Trumps Lügen als eine Seite der Medaille darzustellen oder in einen neuen Zusammenhang stellen, statt seine Lügen Lügen zu nennen. Hier eins der Beispiele aus dem Artikel: Vor einigen Wochen, "nachdem Jeffrey Goldberg in The Atlantic darüber berichtet hatte, dass Trump Kriegsveteranen 'Trottel' und 'Verlierer' genannt hatte, brachte die Washington Post einen Artikel darüber mit der Überschrift 'Trump sagte, die im Krieg verletzten und getöteten US-Soldaten seien 'Verlierer', berichtet ein Magazin'. Die New York Times fasste die Geschichte so zusammen, als ob Trumps Widerlegungen die Nachrichten wären: 'Trump dementiert wütend den Bericht, dass er gefallene Soldaten 'Verlierer' und 'Trottel' genannt habe.' Die Unterzeile war ebenfalls von Bedeutung: 'Der Bericht in The Atlantic könnte für den Präsidenten problematisch sein, da er für seine Wiederwahl mit der starken Unterstützung des Militärs rechnet.' Das heißt: Die Nachricht war, was die Auseinandersetzungen politisch bedeuten würden. Die Rahmung war eine Möglichkeit, den Anschein zu vermeiden, man ergreife Partei, während man tatsächlich Partei ergriff. (Die Times hat Überschrift und Unterzeile übrigens später verändert, ohne dass vermerkt zu haben.)"
Wenn Donald Trump diese Wahlen gewinnt, ist die Qualitätspresse daran nicht unschuldig, meint James Fallows, der sich über die faule Vorstellung ärgert, es sei irgendwie "objektiv", Trumps Lügen als eine Seite der Medaille darzustellen oder in einen neuen Zusammenhang stellen, statt seine Lügen Lügen zu nennen. Hier eins der Beispiele aus dem Artikel: Vor einigen Wochen, "nachdem Jeffrey Goldberg in The Atlantic darüber berichtet hatte, dass Trump Kriegsveteranen 'Trottel' und 'Verlierer' genannt hatte, brachte die Washington Post einen Artikel darüber mit der Überschrift 'Trump sagte, die im Krieg verletzten und getöteten US-Soldaten seien 'Verlierer', berichtet ein Magazin'. Die New York Times fasste die Geschichte so zusammen, als ob Trumps Widerlegungen die Nachrichten wären: 'Trump dementiert wütend den Bericht, dass er gefallene Soldaten 'Verlierer' und 'Trottel' genannt habe.' Die Unterzeile war ebenfalls von Bedeutung: 'Der Bericht in The Atlantic könnte für den Präsidenten problematisch sein, da er für seine Wiederwahl mit der starken Unterstützung des Militärs rechnet.' Das heißt: Die Nachricht war, was die Auseinandersetzungen politisch bedeuten würden. Die Rahmung war eine Möglichkeit, den Anschein zu vermeiden, man ergreife Partei, während man tatsächlich Partei ergriff. (Die Times hat Überschrift und Unterzeile übrigens später verändert, ohne dass vermerkt zu haben.)"Bloomberg Businessweek (USA), 22.09.2020
 Was für die Presse gilt, gilt noch mehr für die sozialen Medien. Besonders Facebook tut sich schwer damit, Lügen als Lügen zu bewerten und nicht als weitere Fakten, schreiben Sarah Frier und Kurt Wagner. Auf Mark Zuckerbergs Seite sehen sie dahinter reines geschäftliches Kalkül: Wenn Facebook nicht reguliert werden soll, verärgert man besser die Regierung nicht. Das hat Auswirkungen: "2019 stellte Facebook zum Beispiel Regeln auf, die falsche Informationen zur Stimmabgabe bei den Wahlen untersagten, aber dann erstarrte es, als Trump diese Politik tatsächlich auf die Probe stellte. Am 20. Mai behauptete der Präsident, dass Beamte in Michigan und Nevada illegal Briefwahlscheine verschickten, was nicht stimmte. Wenige Tage später, am 26. Mai, gab Trump bekannt, dass Kalifornien Wahlzettel an 'jeden' verschicke, 'der in dem Bundesstaat lebe', eine weitere Lüge. Die Postings blieben oben, und Zuckerberg kritisierte Twitter auf Fox News, weil es ähnliche Postings auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft hatte. Ein externer Prüfer kam später zu dem Schluss, dass Facebook in beiden Fällen seine eigenen Richtlinien nicht befolgt habe. Stattdessen entwickelte Zuckerberg etwas Neues - was er als 'die größte Informationskampagne zur Stimmabgabe in der Geschichte der USA' bezeichnete - einen Plan zur Registrierung von 4 Millionen Wählern. ... Aber die Links unter Trumps immer häufigeren Postings über Abstimmungen warnen die Facebook-Benutzer nicht, wenn die Informationen unwahr sind - sie werben einfach nur für ein Informationszentrum."
Was für die Presse gilt, gilt noch mehr für die sozialen Medien. Besonders Facebook tut sich schwer damit, Lügen als Lügen zu bewerten und nicht als weitere Fakten, schreiben Sarah Frier und Kurt Wagner. Auf Mark Zuckerbergs Seite sehen sie dahinter reines geschäftliches Kalkül: Wenn Facebook nicht reguliert werden soll, verärgert man besser die Regierung nicht. Das hat Auswirkungen: "2019 stellte Facebook zum Beispiel Regeln auf, die falsche Informationen zur Stimmabgabe bei den Wahlen untersagten, aber dann erstarrte es, als Trump diese Politik tatsächlich auf die Probe stellte. Am 20. Mai behauptete der Präsident, dass Beamte in Michigan und Nevada illegal Briefwahlscheine verschickten, was nicht stimmte. Wenige Tage später, am 26. Mai, gab Trump bekannt, dass Kalifornien Wahlzettel an 'jeden' verschicke, 'der in dem Bundesstaat lebe', eine weitere Lüge. Die Postings blieben oben, und Zuckerberg kritisierte Twitter auf Fox News, weil es ähnliche Postings auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft hatte. Ein externer Prüfer kam später zu dem Schluss, dass Facebook in beiden Fällen seine eigenen Richtlinien nicht befolgt habe. Stattdessen entwickelte Zuckerberg etwas Neues - was er als 'die größte Informationskampagne zur Stimmabgabe in der Geschichte der USA' bezeichnete - einen Plan zur Registrierung von 4 Millionen Wählern. ... Aber die Links unter Trumps immer häufigeren Postings über Abstimmungen warnen die Facebook-Benutzer nicht, wenn die Informationen unwahr sind - sie werben einfach nur für ein Informationszentrum."Pitchfork (USA), 22.09.2020
Für skeptischere Hörer mögen Enyas Balladen klingen wie verlangsamte, seifige Achtziger-Jahre-Balladen. Einem weiteren Publikum in Deutschland in Deutschland mag der pompöse Synthesizer-Ethnomythos-Jugendstil-Kitsch von "Orinoco Flow" bekannt sein.
Aber Enya ist ganz offenbar auch eine Musikerin für Musiker, eine, die sehr sehr viele heutige Popmusiker durch ihre Art der Studioarbeit beeinflusst hat, und zwar die allerunterschiedlichsten, erzählt Jenn Pelly. Sie hat mit einigen von ihnen gesprochen Zum Beispiel mit der großartige Melodikerin Weyes Blood, mit den Musikern der Death Metal Band Blood Incantation, die Enya so sehr verehren, dass sie sich ihren Namen auf ihre Joppe sticken. Und gar mit dem verrückten Avantgardisten Oneohtrix Point Never, alias Daniel Lopatin. "Enyas Studio-Innovationen standen nicht immer im Zentrum ihres Narrativs, aber sie sind zentral, wenn Lopatin sagt, dass er sie 'fast als eine Göttin' betrachtet. In den zehner Jahren stand Lopatin an der Spitze einiger Underground-Musiker, die Experimentelles, Elektronik, Noise und New Age verschmolzen. Im Alter von sechs Jahren, in den Achtzigern, sah er Enya zum ersten Mal im Fernsehen - sie spielte 'Boadicea', ihre Hände auf dem Roland Juno-6 keyboard - und er hatte eine Offenbarung: Den gleichen Synthesizer hatte sein Vater im Keller und benutzte ihn für seine Gigs. 'Aber als ich auf dem VH1-Video sah, wie sie ihn spielte, blitzte es in mir auf: Man kann mit diesem Instrument also auch zaubern', sagt Lopatin. 'Das ist der Ursprung meiner Kreativität.'"
Hier "Boadicea":
Und hier "The Station" von Oneohtrix Point Never:
Aber Enya ist ganz offenbar auch eine Musikerin für Musiker, eine, die sehr sehr viele heutige Popmusiker durch ihre Art der Studioarbeit beeinflusst hat, und zwar die allerunterschiedlichsten, erzählt Jenn Pelly. Sie hat mit einigen von ihnen gesprochen Zum Beispiel mit der großartige Melodikerin Weyes Blood, mit den Musikern der Death Metal Band Blood Incantation, die Enya so sehr verehren, dass sie sich ihren Namen auf ihre Joppe sticken. Und gar mit dem verrückten Avantgardisten Oneohtrix Point Never, alias Daniel Lopatin. "Enyas Studio-Innovationen standen nicht immer im Zentrum ihres Narrativs, aber sie sind zentral, wenn Lopatin sagt, dass er sie 'fast als eine Göttin' betrachtet. In den zehner Jahren stand Lopatin an der Spitze einiger Underground-Musiker, die Experimentelles, Elektronik, Noise und New Age verschmolzen. Im Alter von sechs Jahren, in den Achtzigern, sah er Enya zum ersten Mal im Fernsehen - sie spielte 'Boadicea', ihre Hände auf dem Roland Juno-6 keyboard - und er hatte eine Offenbarung: Den gleichen Synthesizer hatte sein Vater im Keller und benutzte ihn für seine Gigs. 'Aber als ich auf dem VH1-Video sah, wie sie ihn spielte, blitzte es in mir auf: Man kann mit diesem Instrument also auch zaubern', sagt Lopatin. 'Das ist der Ursprung meiner Kreativität.'"
Hier "Boadicea":
Und hier "The Station" von Oneohtrix Point Never:
Kommentieren












