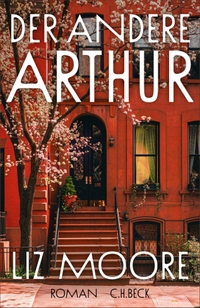Virtualienmarkt
Das Prinzip Search
Mathias Döpfner und die Zukunft des Journalismus. Von Robin Meyer-Lucht
26.07.2006. Mit seiner Rede "Der Journalismus lebt" über die Herausfoderung der Branche durch das Internet nähert sich Mathias Döpfner der Wahrheit. Nun muss er noch die Augen öffnen. Mathias Döpfner gehört zu jenen Menschen, über die man nicht schreiben kann, ohne über ihre höchst heterosuggestive Erscheinung zu sprechen. Als der Axel Springer-Chef kürzlich Angela Merkel über das Sommerfest der Bild geleitete, büßte er auch neben der Bundeskanzlerin nichts von seiner Führungsstatur ein. Aber so ist er, der große Vorsitzende: erhaben im Gestus, bestimmt in der Sache, souverän im Tonfall - das Zentrum. Als Döpfner kürzlich vom Focus gefragt wurde, ob er das Bildblog kenne, sagte er: "Bild bewegt. Auch Gegner. Eine solche Site gehört zu den Spielregeln einer Mediendemokratie."
Döpfner hat einen thesengewaltigen Essay über die Zukunft Journalismus geschrieben. "Der Journalismus lebt" erschien Anfang Mai in der Welt, aber die Auseinandersetzung mit seinen Thesen ist noch lange nicht vorbei. Es ist das Manuskript seiner lebhaft vorgetragenen und begeistert aufgenommenen Rede zur Verleihung des Axel Springer Preises für junge Journalisten. Der Springer-Chef geht hier in seiner Auseinandersetzung mit dem Medienwandel weiter als andere deutsche Medienkonzernlenker vor ihm. Das Internet ist für ihn "eine spektakuläre Erfolgsgeschichte" und "die größte Umverteilaktion in der jüngeren Geschichte". Er räumt unumwunden ein, dass meisten Online-Angebote von Zeitungen "weit hinter den technischen, kreativen Möglichkeiten des Internets" zurückblieben. Die Einbindung von Lesern als Reporter bei Ohmynews nennt er "vorbildlich".
Im Vergleich zu den häufig tief eingegrabenen Vertretern anderer Medienhäuser spricht Döpfner die anstehenden Fragen des Medienwandels offen an. Er liefert damit einen der ganz wenigen medien-reflektierenden Essays in diesem Land aus Verantwortung tragender Hand. Als Rede an die von "kollektiver Angst" geplagte Medienbranche ist Döpfners Essay allerdings in Teilen zu einer Apologie des Altbekannten geraten: "Es ändert sich weniger als wir denken" ruft er der verunsicherten Journalistenschaft zu. Sein Mut-Programm für die Medienbranche läuft auf die Formel heraus: Wir müssen uns nicht ändern, sondern nur besser bleiben. Der Zeitungsjournalismus, die Krone des differenzierten Journalismus, werde sich als "Kreativmedium" auch im digitalen Raum erhalten, legt Döpfner nahe. Statt die bröckelnden Fundamente, die er bestens kennt, noch weiter offen zu legen, schmückt er das Haus des Zeitungsjournalismus lieber noch einmal. Seine zentralen Thesen lauten:
1. Das Rieplsche Gesetz, wonach "der Medienfortschritt kumulativ, nicht substuierend" verläuft, gilt auch weiterhin.
Die Zeitung habe das Buch nicht ersetzt, das Radio nicht die Zeitung, das Fernsehen nicht das Radio. Der Wechsel von Schallplatte zu CD sei als Wechsel des Träger-, nicht des "Kreativmediums" zu interpretieren.
2. "Die Zukunft der Zeitung ist digital."
Fraglos werde die Zeitung demnächst nicht mehr gedruckt, sondern auf elektronischem Papier erscheinen. Unklar sei nur noch, ob dies "in fünf, zehn oder fünfundzwanzig Jahren" der Fall sein wird.
3. Die Zeitung ist mit ihrem Kernprinzip Führung funktional das Gegenteil vom Internet.
Das "Horizont-Medium" Zeitung biete selbstbewusst-autoritär ein Sortiment des Wissenswerten, wohingegen das Internet ein Suchmedium der Vertiefung sei. "Die Zeitung wirkt erweiternd, das Internet vertiefend."
4. Journalistische Führung bleibt das dominante Prinzip der Massenkommunikation.
Der Entwurf eines mündigen, beständig selbst auswählenden Medienkonsumenten sei eine "medientheoretisch schöne Utopie". In der Realität der Massenmärkte würden Leser jedoch "nicht ständig selbst entscheiden" wollen.
5. Der Zeitungsjournalismus wird überleben, wenn er sich auf seine Stärken "exklusive Neuigkeiten, eigenständige Meinung und begeisternde Sprache" besinnt.
Wenn sich Zeitungen und ihre Journalisten auf diese "drei Kompetenzkerne" konzentrieren, würden sie sich im Wettbewerb der Publikationen und der Mediengattungen sehr gut behaupten können.
Das "Rieplsche Gesetz" wird gerne für die Behauptung einer substitutionsfreien Medienentwicklung benutzt (These 1). Wolfgang Riepl schrieb 1913, dass einmal eingeführte Formen und Methoden der Nachrichtenübermittlung "auch von den vollkommensten und höchst entwickelten niemals wieder gänzlich und dauernd verdrängt werden können, sondern sich neben diesen erhalten, nur dass sie genötigt werden, andere Aufgaben und Verwendungsgebiete aufzusuchen." Riepl meint das Gesetz gefunden zu haben, dass im Zuge funktionaler Differenzierungen keine Mediengattung gänzlich verschwindet. Von einer verlustfreien Medienentwicklung spricht er nicht.
Selbstverständlich bringt die Medienentwicklung auch Verluste, also Substitution. So verloren die westdeutschen Kinos durch das Fernsehen innerhalb von 13 Jahren 79 Prozent ihrer Besucher. Die Zahl der verkauften Tickets ging von 818 Millionen 1956 auf 172 Millionen 1969 zurück (mehr hier). Allerdings gab es angesichts des fulminanten Wachstum der Medienmärkte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur wenig Platz für Verlierer. Dennoch: Riepl bietet keinen Trost bei Substitutionsängsten.
Döpfner unterscheidet in seiner Mediengattungsgeschichte Träger- und "Kreativmedium". Trägermedien könnten sich ändern, Kreativmedien (wie aufgenommene Musik oder Textjournalismus) würden bleiben. Dies ist jedoch nur ein geringer Trost für die Zeitungsbranche, deren Macht letztlich am Trägermedium Papier hängt. Döpfner erwartet den iPod der Zeitungsindustrie in fünf bis fünfundzwanzig Jahren (These 2). Mit dieser klaren Absage an die gedruckte Zeitung als Massenmedium entfernt sich der Chef dreier Druckereien weit vom Branchen-Mainstream. Mit dem E-Paper-iPod wird sich das Prinzip Zeitung jedoch nicht einfach ins Digitale übertragen lassen. Die Leser werden, befreit von allen Schranken des papierenen Distributionsoligopols, nicht vornehmlich auf klassische Zeitungsprodukte zugreifen wollen. Ein Kampf um die Zugangskontrolle zwischen Dienste-, Inhalte- und Endgerätehersteller wird auch hier ausbrechen. Die Omnipräsenz des Internets wird für einen hohen Anteil von Gratisinhalten sorgen. Im schlechtesten Fall hat die Zeitungsindustrie auf das Geschäft mit einem zukünftigen Zeitungs-iPod einen genauso geringen Einfluss wie die Musikindustrie auf den heutigen iPod.
Döpfner behauptet auch, die Zeitung sei als "Horizont-Medium" dem Suchmedium Internet überlegen (These 3). Aber er vergleicht hier Publikationsart mit Universalmedium. Tatsächlich ist alles, was Döpfner über Zeitungen sagt, Kern jeglicher journalistischer Publikation, sei es Print, Fernsehen oder Internet. Jede Nachrichtensite, jedes Radio-Magazin zieht solch einen Horizont des Wissenswerten. Neben Präsentation und Recherche ist Selektion der dritte große Pfeiler journalistischer Dienstleistung. Was Döpfner "Internet" nennt, ist tatsächlich das Prinzip Search. Online existieren die Filter-Paradigmen redaktionelle Selektion und Search parallel. Statt das Internet auf das Prinzip Search zu reduzieren, gilt es sich zu fragen, wie Search und redaktionelle Selektion online ineinander greifen - und was dies für Journalisten und Verlage bedeutet.
Döpfners skeptische Haltung gegenüber einer aktiven Nutzerschaft (These 4) mag die aktuelle Verfasstheit abbilden. Die Zeichen für ein zunehmend aktives Publikum jedoch mehren sich. Nach einer Nutzerbefragung bilanzierte das Traditionsunternehmen IBM (hier als pdf) kürzlich: "Der Medienkonsument in interaktiven Medien nutzt immer stärker seine Möglichkeiten zur Beeinflussung, Kontrolle und Mitwirkung im wachsenden Medienangebot." Die Adaptions- und Substitutionsgeschwindigkeit neuer Angebote habe sich "signifikant erhöht". Rupert Murdoch, der alte Pate der Massenkultur, hat es noch etwa süffisanter auf den Punkt gebracht: "The days of top-down, force-fed, one-size-fits-all media are over." Genau aus diesem Grund hat Murdoch eine Plattform gekauft, die allein auf Nutzerkreativität basierend zu den fünf größten Sites der USA gehört. Murdochs visionäre Rede über die Zukunft der Medien, auf die Döpfner in seiner Springer-Preis-Rede antwortet, gehört heute schon zu den klassischen Texten über das Netz.
Döpfners Beschwörung der klassischen Tugenden des Journalismus (These 5) hält angesichts der Herausforderungen, vor denen der Journalismus im digitalen Zeitalter steht, der Realität nicht stand. Zwei Beispiele: Sucht man bei Google das Wort "Bild", so verweisen die ersten beiden Treffer auf Bild.T-Online. Der dritte Treffer lautet Bildblog. Damit hat das gerade zwei Jahre alte Watchblog von Bild eine bessere Distribution als Auto-Bild, Sport-Bild oder Computer-Bild. Weil Google es so will. Die Hierarchien des Netzes durchkreuzen die klassischen Hierarchien.
Zum dritten Deutschlandbesuch von George Bush konnte man mittags auf Google News die Schlagzeile "Bush und Merkel betonen Gemeinsamkeiten" lesen. Es handelte sich um eine dpa-Meldung aus der Rhein-Neckar Zeitung. Wer wollte konnte die gleiche Meldung auch bei Esslinger Zeitung lesen. Oder bei ZDFheute.de oder manager-magazin.de oder "90 ähnlichen Artikeln" vorbeischauen.
Google News macht die Konkurrenz unter den journalistischen Angeboten und die Zulieferung durch die Agenturen hypertransparent. Der Journalismus verliert die Aura des Geheimnisvollen und Einzigartigen. An die Stelle tritt eine ganz neue Phase des Qualitäts- und Differenzierungswettbewerbs zwischen journalistischen, para- und nichtjournalistischen Anbietern. Dabei drohen journalistische Anbieter, deren Angebote nicht schon portalartig im Netz strahlen, zwischen spezialisierten Inhalte-Anbietern und Aggregatoren zerrieben zu werden (mehr hier).
Statt Leser mit schalem Durchschnitt, agenturschwangerer Massenware und Me-too-Journalismus zu konfrontierten, muss Journalismus online besser und spezieller werden als er es in der Zeitung häufig war. Es gilt, einen Übergang zu finden, von der autoritären Führung eines Journalismus mit Print-Oligopol zur charismatischen Führung eines Journalismus unter den Bedingungen frei flottierender Nutzer. Dabei ist der Journalismus, der heute in vielen Zeitungen zu besichtigen ist, ja keinesfalls schon perfekt. Er wird geplagt von Pathologien, wie Dramatisierung, Kurzatmigkeit, Simplifizierung, Halbwissen oder Personalisierung. Auch hier kann das neue Medium zur Linderung womöglich etwas beitragen.
Doch es kommt sogar noch schlimmer für den Journalismus: Er droht online seine angestammte Position als dominanter und profitabelster Modus der Massenkommunikation zu verlieren. Rupert Murdoch ist zu einer Ikone des digitalen Medienmanagements geworden, weil er nicht in Journalismus investiert hat. Er hat MySpace gekauft, weil man damit seiner Meinung nach mehr und zeitgemäßer Geld verdienen kann als mit Journalismus: "Können Zeitungen online Geld verdienen? Klar. Können sie soviel Geld verdienen, wie sie in Print verlieren? Im Moment, bei einem so neuen, wettbewerbsintensiven Internet, lautet die Antwort: nein." Hinter dem Kauf von MySpace steht auch Murdochs Eingeständnis, dass es bis heute kein schlagkräftiges Online-Geschäftsmodell für journalistische Inhalte jenseits der anzeigenfinanzierten Großanbieter gibt. Welt.de ist von einem funktionierenden Geschäftsmodell für aufwändige Print-Inhalte ebenso weit entfernt wie die Online-Töchter der überregionalen Konkurrenz.
In einer ersten Phase des Internet ging es für die Verlage darum, mit klassischem Journalismus online beträchtliche Reichweite aufzubauen. Das haben Spiegel Online, Focus Online und vielleicht auch Bild.T-Online gut hinbekommen. Nun aber zeichnet sich ab, dass diese journalistischen Angebote nur einen überschaubaren Teil der Online-Nutzung ausmachen. Daneben entstehen neue Filter-Mechanismen (Search), neue Kreativität (Blogs, Citizen Journalism), neue Werbeformen (Adsense). Die Verlage müssen sich fragen, was davon zu ihrem Geschäft gehört. Verkaufen sie nur Journalismus? Oder ist es ihr Geschäft, Inhalte und Plattformen anzubieten, die ein Massenpublikum anziehen, das dafür zahlt und für dessen Aufmerksamkeit gezahlt wird?
Mit dem Prinzip Search wird nicht nur prächtig Geld verdient (Google hat im vergangenen Jahr laut FAZ in Deutschland Online-Anzeigen im Wert von 400 Millionen Euro verkauft und dabei 160 Millionen Euro verdient), es attackiert auch einen Kernaspekt journalistischer Kompetenz: die besten Inhalte auszuwählen. Die New York Times träumt folgerichtig seit einiger Zeit von einem eigenen Google News. "Eigentlich müssten wir das auch können und die Ergebnisse dann mit unseren journalistischen Inhalten verbinden", sagte NYTimes.com-Leiter Martin Nisenholtz bereits vor einem Jahr. Für BBC News erklärte ihr Forschungsleiter Nic Newman kürzlich in Berlin: "Suche, Empfehlung und Bündelung sind Teil des journalistischen Mediengeschäfts. Wir können sie daher nicht allein den Suchmaschinen überlassen."
Es gibt also einiges zu erwägen und zu prüfen - jenseits der Formel "es wird sich weniger ändern, als wir denken." Döpfner weiß das. Die geplante Fusion mit ProSiebenSat1 begründete er vor einem Jahr gerade auch mit der Google-Herausforderung. Der Welt hat er bereits einen gemeinsamen Print-Online-Newsroom und die stärkste Online-Ausrichtung unter den überregionalen Tageszeitungen verordnet. Nicht schlecht. Da wünscht man sich eine Spur weniger Strukturkonservatismus und eine Spur mehr Schonungslosigkeit auch im öffentlichen Diskurs.
Döpfner hat einen thesengewaltigen Essay über die Zukunft Journalismus geschrieben. "Der Journalismus lebt" erschien Anfang Mai in der Welt, aber die Auseinandersetzung mit seinen Thesen ist noch lange nicht vorbei. Es ist das Manuskript seiner lebhaft vorgetragenen und begeistert aufgenommenen Rede zur Verleihung des Axel Springer Preises für junge Journalisten. Der Springer-Chef geht hier in seiner Auseinandersetzung mit dem Medienwandel weiter als andere deutsche Medienkonzernlenker vor ihm. Das Internet ist für ihn "eine spektakuläre Erfolgsgeschichte" und "die größte Umverteilaktion in der jüngeren Geschichte". Er räumt unumwunden ein, dass meisten Online-Angebote von Zeitungen "weit hinter den technischen, kreativen Möglichkeiten des Internets" zurückblieben. Die Einbindung von Lesern als Reporter bei Ohmynews nennt er "vorbildlich".
Im Vergleich zu den häufig tief eingegrabenen Vertretern anderer Medienhäuser spricht Döpfner die anstehenden Fragen des Medienwandels offen an. Er liefert damit einen der ganz wenigen medien-reflektierenden Essays in diesem Land aus Verantwortung tragender Hand. Als Rede an die von "kollektiver Angst" geplagte Medienbranche ist Döpfners Essay allerdings in Teilen zu einer Apologie des Altbekannten geraten: "Es ändert sich weniger als wir denken" ruft er der verunsicherten Journalistenschaft zu. Sein Mut-Programm für die Medienbranche läuft auf die Formel heraus: Wir müssen uns nicht ändern, sondern nur besser bleiben. Der Zeitungsjournalismus, die Krone des differenzierten Journalismus, werde sich als "Kreativmedium" auch im digitalen Raum erhalten, legt Döpfner nahe. Statt die bröckelnden Fundamente, die er bestens kennt, noch weiter offen zu legen, schmückt er das Haus des Zeitungsjournalismus lieber noch einmal. Seine zentralen Thesen lauten:
1. Das Rieplsche Gesetz, wonach "der Medienfortschritt kumulativ, nicht substuierend" verläuft, gilt auch weiterhin.
Die Zeitung habe das Buch nicht ersetzt, das Radio nicht die Zeitung, das Fernsehen nicht das Radio. Der Wechsel von Schallplatte zu CD sei als Wechsel des Träger-, nicht des "Kreativmediums" zu interpretieren.
2. "Die Zukunft der Zeitung ist digital."
Fraglos werde die Zeitung demnächst nicht mehr gedruckt, sondern auf elektronischem Papier erscheinen. Unklar sei nur noch, ob dies "in fünf, zehn oder fünfundzwanzig Jahren" der Fall sein wird.
3. Die Zeitung ist mit ihrem Kernprinzip Führung funktional das Gegenteil vom Internet.
Das "Horizont-Medium" Zeitung biete selbstbewusst-autoritär ein Sortiment des Wissenswerten, wohingegen das Internet ein Suchmedium der Vertiefung sei. "Die Zeitung wirkt erweiternd, das Internet vertiefend."
4. Journalistische Führung bleibt das dominante Prinzip der Massenkommunikation.
Der Entwurf eines mündigen, beständig selbst auswählenden Medienkonsumenten sei eine "medientheoretisch schöne Utopie". In der Realität der Massenmärkte würden Leser jedoch "nicht ständig selbst entscheiden" wollen.
5. Der Zeitungsjournalismus wird überleben, wenn er sich auf seine Stärken "exklusive Neuigkeiten, eigenständige Meinung und begeisternde Sprache" besinnt.
Wenn sich Zeitungen und ihre Journalisten auf diese "drei Kompetenzkerne" konzentrieren, würden sie sich im Wettbewerb der Publikationen und der Mediengattungen sehr gut behaupten können.
Das "Rieplsche Gesetz" wird gerne für die Behauptung einer substitutionsfreien Medienentwicklung benutzt (These 1). Wolfgang Riepl schrieb 1913, dass einmal eingeführte Formen und Methoden der Nachrichtenübermittlung "auch von den vollkommensten und höchst entwickelten niemals wieder gänzlich und dauernd verdrängt werden können, sondern sich neben diesen erhalten, nur dass sie genötigt werden, andere Aufgaben und Verwendungsgebiete aufzusuchen." Riepl meint das Gesetz gefunden zu haben, dass im Zuge funktionaler Differenzierungen keine Mediengattung gänzlich verschwindet. Von einer verlustfreien Medienentwicklung spricht er nicht.
Selbstverständlich bringt die Medienentwicklung auch Verluste, also Substitution. So verloren die westdeutschen Kinos durch das Fernsehen innerhalb von 13 Jahren 79 Prozent ihrer Besucher. Die Zahl der verkauften Tickets ging von 818 Millionen 1956 auf 172 Millionen 1969 zurück (mehr hier). Allerdings gab es angesichts des fulminanten Wachstum der Medienmärkte in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nur wenig Platz für Verlierer. Dennoch: Riepl bietet keinen Trost bei Substitutionsängsten.
Döpfner unterscheidet in seiner Mediengattungsgeschichte Träger- und "Kreativmedium". Trägermedien könnten sich ändern, Kreativmedien (wie aufgenommene Musik oder Textjournalismus) würden bleiben. Dies ist jedoch nur ein geringer Trost für die Zeitungsbranche, deren Macht letztlich am Trägermedium Papier hängt. Döpfner erwartet den iPod der Zeitungsindustrie in fünf bis fünfundzwanzig Jahren (These 2). Mit dieser klaren Absage an die gedruckte Zeitung als Massenmedium entfernt sich der Chef dreier Druckereien weit vom Branchen-Mainstream. Mit dem E-Paper-iPod wird sich das Prinzip Zeitung jedoch nicht einfach ins Digitale übertragen lassen. Die Leser werden, befreit von allen Schranken des papierenen Distributionsoligopols, nicht vornehmlich auf klassische Zeitungsprodukte zugreifen wollen. Ein Kampf um die Zugangskontrolle zwischen Dienste-, Inhalte- und Endgerätehersteller wird auch hier ausbrechen. Die Omnipräsenz des Internets wird für einen hohen Anteil von Gratisinhalten sorgen. Im schlechtesten Fall hat die Zeitungsindustrie auf das Geschäft mit einem zukünftigen Zeitungs-iPod einen genauso geringen Einfluss wie die Musikindustrie auf den heutigen iPod.
Döpfner behauptet auch, die Zeitung sei als "Horizont-Medium" dem Suchmedium Internet überlegen (These 3). Aber er vergleicht hier Publikationsart mit Universalmedium. Tatsächlich ist alles, was Döpfner über Zeitungen sagt, Kern jeglicher journalistischer Publikation, sei es Print, Fernsehen oder Internet. Jede Nachrichtensite, jedes Radio-Magazin zieht solch einen Horizont des Wissenswerten. Neben Präsentation und Recherche ist Selektion der dritte große Pfeiler journalistischer Dienstleistung. Was Döpfner "Internet" nennt, ist tatsächlich das Prinzip Search. Online existieren die Filter-Paradigmen redaktionelle Selektion und Search parallel. Statt das Internet auf das Prinzip Search zu reduzieren, gilt es sich zu fragen, wie Search und redaktionelle Selektion online ineinander greifen - und was dies für Journalisten und Verlage bedeutet.
Döpfners skeptische Haltung gegenüber einer aktiven Nutzerschaft (These 4) mag die aktuelle Verfasstheit abbilden. Die Zeichen für ein zunehmend aktives Publikum jedoch mehren sich. Nach einer Nutzerbefragung bilanzierte das Traditionsunternehmen IBM (hier als pdf) kürzlich: "Der Medienkonsument in interaktiven Medien nutzt immer stärker seine Möglichkeiten zur Beeinflussung, Kontrolle und Mitwirkung im wachsenden Medienangebot." Die Adaptions- und Substitutionsgeschwindigkeit neuer Angebote habe sich "signifikant erhöht". Rupert Murdoch, der alte Pate der Massenkultur, hat es noch etwa süffisanter auf den Punkt gebracht: "The days of top-down, force-fed, one-size-fits-all media are over." Genau aus diesem Grund hat Murdoch eine Plattform gekauft, die allein auf Nutzerkreativität basierend zu den fünf größten Sites der USA gehört. Murdochs visionäre Rede über die Zukunft der Medien, auf die Döpfner in seiner Springer-Preis-Rede antwortet, gehört heute schon zu den klassischen Texten über das Netz.
Döpfners Beschwörung der klassischen Tugenden des Journalismus (These 5) hält angesichts der Herausforderungen, vor denen der Journalismus im digitalen Zeitalter steht, der Realität nicht stand. Zwei Beispiele: Sucht man bei Google das Wort "Bild", so verweisen die ersten beiden Treffer auf Bild.T-Online. Der dritte Treffer lautet Bildblog. Damit hat das gerade zwei Jahre alte Watchblog von Bild eine bessere Distribution als Auto-Bild, Sport-Bild oder Computer-Bild. Weil Google es so will. Die Hierarchien des Netzes durchkreuzen die klassischen Hierarchien.
Zum dritten Deutschlandbesuch von George Bush konnte man mittags auf Google News die Schlagzeile "Bush und Merkel betonen Gemeinsamkeiten" lesen. Es handelte sich um eine dpa-Meldung aus der Rhein-Neckar Zeitung. Wer wollte konnte die gleiche Meldung auch bei Esslinger Zeitung lesen. Oder bei ZDFheute.de oder manager-magazin.de oder "90 ähnlichen Artikeln" vorbeischauen.
Google News macht die Konkurrenz unter den journalistischen Angeboten und die Zulieferung durch die Agenturen hypertransparent. Der Journalismus verliert die Aura des Geheimnisvollen und Einzigartigen. An die Stelle tritt eine ganz neue Phase des Qualitäts- und Differenzierungswettbewerbs zwischen journalistischen, para- und nichtjournalistischen Anbietern. Dabei drohen journalistische Anbieter, deren Angebote nicht schon portalartig im Netz strahlen, zwischen spezialisierten Inhalte-Anbietern und Aggregatoren zerrieben zu werden (mehr hier).
Statt Leser mit schalem Durchschnitt, agenturschwangerer Massenware und Me-too-Journalismus zu konfrontierten, muss Journalismus online besser und spezieller werden als er es in der Zeitung häufig war. Es gilt, einen Übergang zu finden, von der autoritären Führung eines Journalismus mit Print-Oligopol zur charismatischen Führung eines Journalismus unter den Bedingungen frei flottierender Nutzer. Dabei ist der Journalismus, der heute in vielen Zeitungen zu besichtigen ist, ja keinesfalls schon perfekt. Er wird geplagt von Pathologien, wie Dramatisierung, Kurzatmigkeit, Simplifizierung, Halbwissen oder Personalisierung. Auch hier kann das neue Medium zur Linderung womöglich etwas beitragen.
Doch es kommt sogar noch schlimmer für den Journalismus: Er droht online seine angestammte Position als dominanter und profitabelster Modus der Massenkommunikation zu verlieren. Rupert Murdoch ist zu einer Ikone des digitalen Medienmanagements geworden, weil er nicht in Journalismus investiert hat. Er hat MySpace gekauft, weil man damit seiner Meinung nach mehr und zeitgemäßer Geld verdienen kann als mit Journalismus: "Können Zeitungen online Geld verdienen? Klar. Können sie soviel Geld verdienen, wie sie in Print verlieren? Im Moment, bei einem so neuen, wettbewerbsintensiven Internet, lautet die Antwort: nein." Hinter dem Kauf von MySpace steht auch Murdochs Eingeständnis, dass es bis heute kein schlagkräftiges Online-Geschäftsmodell für journalistische Inhalte jenseits der anzeigenfinanzierten Großanbieter gibt. Welt.de ist von einem funktionierenden Geschäftsmodell für aufwändige Print-Inhalte ebenso weit entfernt wie die Online-Töchter der überregionalen Konkurrenz.
In einer ersten Phase des Internet ging es für die Verlage darum, mit klassischem Journalismus online beträchtliche Reichweite aufzubauen. Das haben Spiegel Online, Focus Online und vielleicht auch Bild.T-Online gut hinbekommen. Nun aber zeichnet sich ab, dass diese journalistischen Angebote nur einen überschaubaren Teil der Online-Nutzung ausmachen. Daneben entstehen neue Filter-Mechanismen (Search), neue Kreativität (Blogs, Citizen Journalism), neue Werbeformen (Adsense). Die Verlage müssen sich fragen, was davon zu ihrem Geschäft gehört. Verkaufen sie nur Journalismus? Oder ist es ihr Geschäft, Inhalte und Plattformen anzubieten, die ein Massenpublikum anziehen, das dafür zahlt und für dessen Aufmerksamkeit gezahlt wird?
Mit dem Prinzip Search wird nicht nur prächtig Geld verdient (Google hat im vergangenen Jahr laut FAZ in Deutschland Online-Anzeigen im Wert von 400 Millionen Euro verkauft und dabei 160 Millionen Euro verdient), es attackiert auch einen Kernaspekt journalistischer Kompetenz: die besten Inhalte auszuwählen. Die New York Times träumt folgerichtig seit einiger Zeit von einem eigenen Google News. "Eigentlich müssten wir das auch können und die Ergebnisse dann mit unseren journalistischen Inhalten verbinden", sagte NYTimes.com-Leiter Martin Nisenholtz bereits vor einem Jahr. Für BBC News erklärte ihr Forschungsleiter Nic Newman kürzlich in Berlin: "Suche, Empfehlung und Bündelung sind Teil des journalistischen Mediengeschäfts. Wir können sie daher nicht allein den Suchmaschinen überlassen."
Es gibt also einiges zu erwägen und zu prüfen - jenseits der Formel "es wird sich weniger ändern, als wir denken." Döpfner weiß das. Die geplante Fusion mit ProSiebenSat1 begründete er vor einem Jahr gerade auch mit der Google-Herausforderung. Der Welt hat er bereits einen gemeinsamen Print-Online-Newsroom und die stärkste Online-Ausrichtung unter den überregionalen Tageszeitungen verordnet. Nicht schlecht. Da wünscht man sich eine Spur weniger Strukturkonservatismus und eine Spur mehr Schonungslosigkeit auch im öffentlichen Diskurs.
Kommentieren