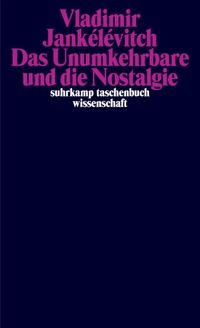Außer Atem: Das Berlinale Blog
Berlinale 4. Tag
Von Thekla Dannenberg, Ekkehard Knörer, Christoph Mayerl
11.02.2008. Ist Jose Padilhas "Tropa de Elite" ein Egoshooter-Film? Keineswegs. Aber er ist auch weit davon entfernt, das Gegenteil zu sein. Betulich: Dennis Lees "Fireflies in the Garden". Angenehme Überraschung: John Crowleys "Boy A". Lebt zwei Wahrheiten: Jose Padilhas "Tropa de Elite" (Wettbewerb)
 Ein Elite-Cop als Ich-Erzähler, die Knarre in der Hand, unterwegs in den Favelas von Rio de Janeiro: Ein Egoshooter-Film? Von wegen, alles andere als das. Aber, und das macht seine Intelligenz aus, er ist sogar weit davon entfernt, das Gegenteil zu sein. Dieser Film mutet einem mit voller Absicht einen Helden zu, dessen Verhalten durch nichts zu rechtfertigen ist. Er zwingt einen nicht nur, dessen Gewalttaten zu ertragen, beinahe nötigt er einen sogar, vieles von dem, was dieser Held tut, mit Sympathie zu betrachten. Beinahe, denn natürlich zwingt einen der Film nicht zuletzt, gegen diese Sympathie zu kämpfen und also nicht den Verstand zu verlieren inmitten einer sozialen Situation, die Regisseur Jose Padilha unter den herrschenden Zuständen so überzeugend wie konsequent als aussichtslos beschreibt.
Ein Elite-Cop als Ich-Erzähler, die Knarre in der Hand, unterwegs in den Favelas von Rio de Janeiro: Ein Egoshooter-Film? Von wegen, alles andere als das. Aber, und das macht seine Intelligenz aus, er ist sogar weit davon entfernt, das Gegenteil zu sein. Dieser Film mutet einem mit voller Absicht einen Helden zu, dessen Verhalten durch nichts zu rechtfertigen ist. Er zwingt einen nicht nur, dessen Gewalttaten zu ertragen, beinahe nötigt er einen sogar, vieles von dem, was dieser Held tut, mit Sympathie zu betrachten. Beinahe, denn natürlich zwingt einen der Film nicht zuletzt, gegen diese Sympathie zu kämpfen und also nicht den Verstand zu verlieren inmitten einer sozialen Situation, die Regisseur Jose Padilha unter den herrschenden Zuständen so überzeugend wie konsequent als aussichtslos beschreibt.
 Und damit ab ins juristische Foucault-Seminar. Mitglieder einer Bürgerkinder-NGO sitzen hier herum und diskutieren tatsächlich Michel Foucaults "Überwachen und Strafen" und sprechen über die Mikro-Wirkungen der Macht, denen auch der nicht einfach so entkommt, der sich gegen sie stemmt. Mitten unter den Studierenden sitzt, als einer, der um jeden Preis auf der richtigen Seite stehen will, Andre Matias, schwarz, intelligent - und Polizist. Das verrät er seinen Kommilitonen nicht und auch nicht der Kommilitonin Maria, die sich in ihn verliebt. Andre lebt in zwei Welten, er lebt zwei Wahrheiten bis zur Schizophrenie, er bekommt zu spüren, wie Kräfte an ihm zerren, zur einen Seiten wie zur anderen; auch vom Kampf um seine Seele erzählt nicht zuletzt dieser Film.
Und damit ab ins juristische Foucault-Seminar. Mitglieder einer Bürgerkinder-NGO sitzen hier herum und diskutieren tatsächlich Michel Foucaults "Überwachen und Strafen" und sprechen über die Mikro-Wirkungen der Macht, denen auch der nicht einfach so entkommt, der sich gegen sie stemmt. Mitten unter den Studierenden sitzt, als einer, der um jeden Preis auf der richtigen Seite stehen will, Andre Matias, schwarz, intelligent - und Polizist. Das verrät er seinen Kommilitonen nicht und auch nicht der Kommilitonin Maria, die sich in ihn verliebt. Andre lebt in zwei Welten, er lebt zwei Wahrheiten bis zur Schizophrenie, er bekommt zu spüren, wie Kräfte an ihm zerren, zur einen Seiten wie zur anderen; auch vom Kampf um seine Seele erzählt nicht zuletzt dieser Film.
"Tropa de Elite" schildert ein System aus vielen Systemen, die sehr viel häufiger durch Korruption als durch Recht und Gesetz miteinander verbunden sind. Der Film verschließt dabei, als wäre es ein Leichtes, nicht die Augen vor den Realitäten. Vor allem nicht vor der leicht dahin zu behauptenden, aber schwer zu ertragenden Realität, dass es keine einfachen Lösungen gibt. So ist die NGO, deren Mitglieder zum großen Teil die besten Absichten haben, in den Drogenhandel verstrickt. Schon weil niemand in die Favela kommt, den die Drogenbosse dort nicht haben wollen. Und erst recht ist die Polizei auf Weisen korrupt, die sich kein Drehbuchautor ausdenken kann: deshalb hat Jose Padilho sein Drehbuch auch gemeinsam mit einem der Elite-Polizisten der BOPE gemeinsam verfasst, von denen der Film handelt.
 Mit den Augen und Worten von Capitao Nascimento (Wagner Moura), dem Ich-Erzähler-Helden, lernen wir das System der Sondereinsatzpolizei von innen kennen. Nascimento, der gerade Vater wird, will lebend raus aus der Truppe und sucht deshalb einen Nachfolger. Andre Matias (Andre Ramiro), der Jura-Student und NGO-Mitarbeiter, kommt in Frage und sein bester Freund Neto auch. Der Film schildert ihren Weg vom Polizei-Anfänger zum Ausbildungscamp, viel mehr Plot braucht er schon nicht. Wie im Ausbildungslager die Aspiranten gedemütigt, erniedrigt, entmenscht werden, bekommen wir zu sehen. Wie sie gedrillt werden zu Mördern, die auf Rache sinnen und an die Notwendigkeit zu glauben lernen, das Töten aus Rache immer weiter fortzusetzen, Auge um Auge. Wie einer, der als Mensch begann, am Ende ein Mörder ist, das ist die Geschichte des Films. Damit konfrontiert er uns, immer aus Sicht des Elite-Cops, der sich zu glauben zwingt, er stehe auf der richtigen Seite. Mit dem letzten Bild erst, bevor er mit einer trostlosen Weißblende schließt, nimmt Jose Padilha eine radikale Perspektivumkehr vor: Das Gewehr ist auf den, der am Boden liegt, gerichtet. Und die Kamera blickt, im Moment, da das Böse triumphiert, aus der Perspektive des Opfers - das selbst ein vielfacher Mörder ist - in den Lauf des Gewehrs.
Mit den Augen und Worten von Capitao Nascimento (Wagner Moura), dem Ich-Erzähler-Helden, lernen wir das System der Sondereinsatzpolizei von innen kennen. Nascimento, der gerade Vater wird, will lebend raus aus der Truppe und sucht deshalb einen Nachfolger. Andre Matias (Andre Ramiro), der Jura-Student und NGO-Mitarbeiter, kommt in Frage und sein bester Freund Neto auch. Der Film schildert ihren Weg vom Polizei-Anfänger zum Ausbildungscamp, viel mehr Plot braucht er schon nicht. Wie im Ausbildungslager die Aspiranten gedemütigt, erniedrigt, entmenscht werden, bekommen wir zu sehen. Wie sie gedrillt werden zu Mördern, die auf Rache sinnen und an die Notwendigkeit zu glauben lernen, das Töten aus Rache immer weiter fortzusetzen, Auge um Auge. Wie einer, der als Mensch begann, am Ende ein Mörder ist, das ist die Geschichte des Films. Damit konfrontiert er uns, immer aus Sicht des Elite-Cops, der sich zu glauben zwingt, er stehe auf der richtigen Seite. Mit dem letzten Bild erst, bevor er mit einer trostlosen Weißblende schließt, nimmt Jose Padilha eine radikale Perspektivumkehr vor: Das Gewehr ist auf den, der am Boden liegt, gerichtet. Und die Kamera blickt, im Moment, da das Böse triumphiert, aus der Perspektive des Opfers - das selbst ein vielfacher Mörder ist - in den Lauf des Gewehrs.
Jose Padilha hat diese Geschichte, gegen alle Weltkinokonsensstilgewohnheiten, mitreißend verfilmt. Er reißt den Zuschauer mit, aber nicht in manipulativer Absicht zu schlichten Erklärungen, simplen Identifikationen oder wohlfeilen Lösungsvorschlägen. Er reißt ihn vielmehr mit ins Komplexe, mit in Szenen und Situationen, bei denen man sich auch als Zuschauer nicht einfach so auf die richtige Seite schlagen kann, und zwar deshalb, weil es eigentlich nur falsche Seiten gibt. Die Form des Erzählens ist die Quasi-Dokumentation. Nicht, wie der sehr artikulierte und intelligente Regisseur in der Pressekonferenz erklärt, das "fake and shake" unmotivierten Handkameragewackels mit seinen billigen Effekten. Sondern ein aus dem Regiekonzept entwickelter Dokumentarstil. Padilha hat keine einzige Szene nach den Regeln der Kunst aufgelöst: es gibt keine establishing shots, keine doppelten oder dreifachen Einstellungen einer Szene aus verschiedenen Kamerapositionen. Keine Vorschriften für die Darsteller, keine Marke auf dem Boden, an die sie sich halten mussten. Und keinen einzigen geschriebenen Dialog, die Schauspieler haben alles, im Rahmen von bloßen Beschreibungen ihrer Situation in der jeweiligen Szene, komplett improvisiert.
 Drei Monate nahm sich das Team Zeit für Proben vor dem Drehbeginn; die Darsteller der Cops haben sogar an einem tatsächlichen BOPE-Ausbildslehrgang teilgenommen. Das Resultat dieser Repräsentations-Strategien ist von naivem Authentizismus denkbar weit entfernt. Die Mischung aus mitreißendem Dokumentarstil und konsequenter Verfremdung durch die Wahl der Perspektive ist in ihren Wirkungen auf die erhellendste Weise desorientierend. Und zwar, indem sie den Zuschauer auf verdammt ungemütliche Weise aus allen bequemen Identifikationspositionen reißt. "Tropa de Elite" war in Brasilien ein Sensationserfolg, wurde erst auf illegalen DVDs und per Internet-Downloads millionenfach gesehen, war dann aber auch im Kino noch der erfolgreichste Film des Jahres. Es ist, wie beinahe zu erwarten, der Vorwurf lautgeworden, er sei Propaganda für die Elite-Truppe BOPE. In Wahrheit aber kann sich ein Film von den Vereinfachungen, die Propaganda ausmachen, nicht konsequenter entfernen, als "Tropa de Elite" dies tut.
Drei Monate nahm sich das Team Zeit für Proben vor dem Drehbeginn; die Darsteller der Cops haben sogar an einem tatsächlichen BOPE-Ausbildslehrgang teilgenommen. Das Resultat dieser Repräsentations-Strategien ist von naivem Authentizismus denkbar weit entfernt. Die Mischung aus mitreißendem Dokumentarstil und konsequenter Verfremdung durch die Wahl der Perspektive ist in ihren Wirkungen auf die erhellendste Weise desorientierend. Und zwar, indem sie den Zuschauer auf verdammt ungemütliche Weise aus allen bequemen Identifikationspositionen reißt. "Tropa de Elite" war in Brasilien ein Sensationserfolg, wurde erst auf illegalen DVDs und per Internet-Downloads millionenfach gesehen, war dann aber auch im Kino noch der erfolgreichste Film des Jahres. Es ist, wie beinahe zu erwarten, der Vorwurf lautgeworden, er sei Propaganda für die Elite-Truppe BOPE. In Wahrheit aber kann sich ein Film von den Vereinfachungen, die Propaganda ausmachen, nicht konsequenter entfernen, als "Tropa de Elite" dies tut.
Ekkehard Knörer
Jose Padilha: "Tropa de elite - The Elite Squad". Mit Wagner Moura, Caio Junqueira, Andre Ramiro. Brasilien, Argentinien 2007, 118 Minuten. (Alle Termine)
Betulich: Dennis Lees "Fireflies in the Garden" (Wettbewerb)
 Ganz schweres Unglück: Erst kommt Julia Roberts beim Autounfall ums Leben, und dann auch noch jemand auf die Idee, einen Film darüber zu machen. Wobei die dürftige Geschichte und die absolut unlogische Konstruktion noch das geringste Übel an diesem Melodram um Freud und Leid der Familie sind. Was man Dennis Lees "Fireflies in the Garden" nicht verzeiht, ist seine Altbackenheit. Im Mittelpunkt steht Michael, erfolgreicher Schund-Autor in New York, der zu einer Familienfeier in seine Heimatstadt zurückkehrt. Im Gepäck hat er sein neues Manuskript, einen Roman über seine Kindheit, in der er schrecklich von seinem Vater schikaniert wurde. Auf dem Weg zu dieser irgendwie grundlos angesetzten Familienfeier kommt Julia Roberts bei einem Autounfall ums Leben - es war ein sehr kurzer Auftritt der Hochschwangeren -, aber immerhin sind jetzt schon alle zusammen, um zu trauern und all die großen und kleinen Dramen miteinander durchzustehen, die eine durchschnittlich dysfunktionale Familie ereilen. Darf man Mama anlügen? Muss man essen, was auf den Tisch kommt? Sollte man Handschuhe beim Abwaschen tragen?
Ganz schweres Unglück: Erst kommt Julia Roberts beim Autounfall ums Leben, und dann auch noch jemand auf die Idee, einen Film darüber zu machen. Wobei die dürftige Geschichte und die absolut unlogische Konstruktion noch das geringste Übel an diesem Melodram um Freud und Leid der Familie sind. Was man Dennis Lees "Fireflies in the Garden" nicht verzeiht, ist seine Altbackenheit. Im Mittelpunkt steht Michael, erfolgreicher Schund-Autor in New York, der zu einer Familienfeier in seine Heimatstadt zurückkehrt. Im Gepäck hat er sein neues Manuskript, einen Roman über seine Kindheit, in der er schrecklich von seinem Vater schikaniert wurde. Auf dem Weg zu dieser irgendwie grundlos angesetzten Familienfeier kommt Julia Roberts bei einem Autounfall ums Leben - es war ein sehr kurzer Auftritt der Hochschwangeren -, aber immerhin sind jetzt schon alle zusammen, um zu trauern und all die großen und kleinen Dramen miteinander durchzustehen, die eine durchschnittlich dysfunktionale Familie ereilen. Darf man Mama anlügen? Muss man essen, was auf den Tisch kommt? Sollte man Handschuhe beim Abwaschen tragen?
Manchmal sind die Probleme auch gravierender, aber so richtig ernst dann doch wieder nicht. Michael kaputte Ehe etwa mit einer Alkoholikerin gerät durch Spontanheilung wieder ins rechte Lot, auf einmal ist die Frau nicht nur trocken, sondern auch schwanger. Aber meist bliebt es bei ungeheuer aufgeblasenen Belanglosigkeiten. Willem Dafoe muss als Haustyrann ständig Sätze von sich geben wie "Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt", Emily Watson spielt die betulichste Tante Jane seit Erfindung des Nudelholzes: "Was hab ich von Deiner Entschuldigung, davon geht der Fleck auch nicht weg". Und Michael liegt am liebsten auf dem Dach und sonnt sich in Selbstmitleid - auf die Idee, seinem Vater mal die Meinung zu sagen, kommt er nicht. Weil sich am Ende dieser gefühlten Fünfziger-Jahre-Schmonzette alle miteinander versöhnt haben, verbrennt Michael das Manuskript, das seinen Vater bloßgestellt hätte. Dummerweise ist eine Kopie in die Hände von Dennis Lee geraten.
Thekla Dannenberg
Dennis Lee: "Fireflies in the Garden". Mit Julia Roberts, Ryan Reynolds, Willem Dafoe, Emily Watson, Carrie-Anne Moss, Hayden Panettiere. USA 2008, 120 Minuten. (Alle Termine)
Angenehme Überraschung: John Crowleys "Boy A" (Panorama)
 Langsam wird es zur Tradition, dass die Briten bei jeder Berlinale einen neuen vielversprechenden Jungschauspieler präsentieren. 2006 probierte sich Cilian Murphy als Transvestit und Terrorist, 2007 tobte sich Jamie Bell als dächerkraxelnder Sonderling aus, und nun kommt Andrew Garfield und serviert uns einen 23-Jährigen, der als Zehnjähriger wegen Mordes verurteilt wurde und nun vorzeitig freigelassen wird.
Langsam wird es zur Tradition, dass die Briten bei jeder Berlinale einen neuen vielversprechenden Jungschauspieler präsentieren. 2006 probierte sich Cilian Murphy als Transvestit und Terrorist, 2007 tobte sich Jamie Bell als dächerkraxelnder Sonderling aus, und nun kommt Andrew Garfield und serviert uns einen 23-Jährigen, der als Zehnjähriger wegen Mordes verurteilt wurde und nun vorzeitig freigelassen wird.
In Manchester soll er mit einer neuen Identität - er wählt den Namen Jack - noch einmal von vorne anfangen können. Verdient so jemand wie Jack, der zumindest für die Boulevardzeitungen das Böse an sich darstellt, eine zweite Chance.
Der Zuschauer vergibt ihm schnell. Garfield, der nur ein Jahr älter ist als sein Charakter, stellt uns einen verwirrten, aber gutherzigen Jungen vor, der in manchen Momenten bis an die Grenze zum Autismus überfordert ist von der neuen Welt, die da auf ihn einstürmt. Sehr intensives Schauspiel, bei einer Drehzeit von nur fünf Wochen erstaunlich. Garfield war im Kino kürzlich in Robert Redfords "Lions and Lambs" als orientierungsloser Student zu sehen.
Es läuft sehr gut für Jack: Neuer Job, neue Freunde, dann auch noch eine Freundin. Doch niemand weiß von seiner Vergangenheit. Zu guter Letzt rettet Jack sogar noch ein Leben, eine Art Wiedergutmachung für sein Verbrechen. Doch die Geister von damals holen ihn schneller ein als erwartet.
Auch wenn "Boy A" ein wenig schematisch daherkommt mit dem guten Jack und seiner tollen neuen Existenz, die in jeder Beziehung so hundertprozentig das Gegenteil seiner total verkorksten Kindheit ist, dieser Film ist dennoch eine angenehme Überraschung. Tolle Schauspieler, interessante Konstellation, stimmige Umsetzung.
Die britische Filmförderung hat hier in nachahmenswerter Weise funktioniert. "Boy A" ist mit sehr kleinem Budget entstanden, weil eigentlich als Fernsehfilm für den Channel 4 der BBC gedacht. Dort lief er Ende November 2007, ist also brandneu. Im Guardian-Blog wird der Film lebhaft von den Zuschauern diskutiert. Bürger diskutieren in einem privaten Medium die kulturellen Leistungen, die mit ihren Steuergelder entstehen. Toll! Vielleicht könnte man auch in Deutschland über ein derart lebendiges Ineinandergreifen der Medien nachdenken. Dazu müsste sich aber erst eine deutsche Zeitung finden, die dem Internet so offen und souverän begegnet wie der Guardian. Noch ist keine in Sicht.
Ein Bravourstück von der Insel also. Von welcher, das war im Saal zunächst unklar. Bei der Vorführung wurde John Crowley als englischer Filmemacher angekündigt. Nichts kann falscher sein. Und so war das erste, was Crowley sagte, als er das Mikrofon bekam: "Ich bin Ire, nur um das festzuhalten."
Christoph Mayerl
John Crowley: "Boy A". Mit Andrew Garfield, Peter Mullan, Katie Lyons, Shaun Evans. Großbritannien 2007, 100 Minuten. (Alle Termine)
 Ein Elite-Cop als Ich-Erzähler, die Knarre in der Hand, unterwegs in den Favelas von Rio de Janeiro: Ein Egoshooter-Film? Von wegen, alles andere als das. Aber, und das macht seine Intelligenz aus, er ist sogar weit davon entfernt, das Gegenteil zu sein. Dieser Film mutet einem mit voller Absicht einen Helden zu, dessen Verhalten durch nichts zu rechtfertigen ist. Er zwingt einen nicht nur, dessen Gewalttaten zu ertragen, beinahe nötigt er einen sogar, vieles von dem, was dieser Held tut, mit Sympathie zu betrachten. Beinahe, denn natürlich zwingt einen der Film nicht zuletzt, gegen diese Sympathie zu kämpfen und also nicht den Verstand zu verlieren inmitten einer sozialen Situation, die Regisseur Jose Padilha unter den herrschenden Zuständen so überzeugend wie konsequent als aussichtslos beschreibt.
Ein Elite-Cop als Ich-Erzähler, die Knarre in der Hand, unterwegs in den Favelas von Rio de Janeiro: Ein Egoshooter-Film? Von wegen, alles andere als das. Aber, und das macht seine Intelligenz aus, er ist sogar weit davon entfernt, das Gegenteil zu sein. Dieser Film mutet einem mit voller Absicht einen Helden zu, dessen Verhalten durch nichts zu rechtfertigen ist. Er zwingt einen nicht nur, dessen Gewalttaten zu ertragen, beinahe nötigt er einen sogar, vieles von dem, was dieser Held tut, mit Sympathie zu betrachten. Beinahe, denn natürlich zwingt einen der Film nicht zuletzt, gegen diese Sympathie zu kämpfen und also nicht den Verstand zu verlieren inmitten einer sozialen Situation, die Regisseur Jose Padilha unter den herrschenden Zuständen so überzeugend wie konsequent als aussichtslos beschreibt. Und damit ab ins juristische Foucault-Seminar. Mitglieder einer Bürgerkinder-NGO sitzen hier herum und diskutieren tatsächlich Michel Foucaults "Überwachen und Strafen" und sprechen über die Mikro-Wirkungen der Macht, denen auch der nicht einfach so entkommt, der sich gegen sie stemmt. Mitten unter den Studierenden sitzt, als einer, der um jeden Preis auf der richtigen Seite stehen will, Andre Matias, schwarz, intelligent - und Polizist. Das verrät er seinen Kommilitonen nicht und auch nicht der Kommilitonin Maria, die sich in ihn verliebt. Andre lebt in zwei Welten, er lebt zwei Wahrheiten bis zur Schizophrenie, er bekommt zu spüren, wie Kräfte an ihm zerren, zur einen Seiten wie zur anderen; auch vom Kampf um seine Seele erzählt nicht zuletzt dieser Film.
Und damit ab ins juristische Foucault-Seminar. Mitglieder einer Bürgerkinder-NGO sitzen hier herum und diskutieren tatsächlich Michel Foucaults "Überwachen und Strafen" und sprechen über die Mikro-Wirkungen der Macht, denen auch der nicht einfach so entkommt, der sich gegen sie stemmt. Mitten unter den Studierenden sitzt, als einer, der um jeden Preis auf der richtigen Seite stehen will, Andre Matias, schwarz, intelligent - und Polizist. Das verrät er seinen Kommilitonen nicht und auch nicht der Kommilitonin Maria, die sich in ihn verliebt. Andre lebt in zwei Welten, er lebt zwei Wahrheiten bis zur Schizophrenie, er bekommt zu spüren, wie Kräfte an ihm zerren, zur einen Seiten wie zur anderen; auch vom Kampf um seine Seele erzählt nicht zuletzt dieser Film. "Tropa de Elite" schildert ein System aus vielen Systemen, die sehr viel häufiger durch Korruption als durch Recht und Gesetz miteinander verbunden sind. Der Film verschließt dabei, als wäre es ein Leichtes, nicht die Augen vor den Realitäten. Vor allem nicht vor der leicht dahin zu behauptenden, aber schwer zu ertragenden Realität, dass es keine einfachen Lösungen gibt. So ist die NGO, deren Mitglieder zum großen Teil die besten Absichten haben, in den Drogenhandel verstrickt. Schon weil niemand in die Favela kommt, den die Drogenbosse dort nicht haben wollen. Und erst recht ist die Polizei auf Weisen korrupt, die sich kein Drehbuchautor ausdenken kann: deshalb hat Jose Padilho sein Drehbuch auch gemeinsam mit einem der Elite-Polizisten der BOPE gemeinsam verfasst, von denen der Film handelt.
 Mit den Augen und Worten von Capitao Nascimento (Wagner Moura), dem Ich-Erzähler-Helden, lernen wir das System der Sondereinsatzpolizei von innen kennen. Nascimento, der gerade Vater wird, will lebend raus aus der Truppe und sucht deshalb einen Nachfolger. Andre Matias (Andre Ramiro), der Jura-Student und NGO-Mitarbeiter, kommt in Frage und sein bester Freund Neto auch. Der Film schildert ihren Weg vom Polizei-Anfänger zum Ausbildungscamp, viel mehr Plot braucht er schon nicht. Wie im Ausbildungslager die Aspiranten gedemütigt, erniedrigt, entmenscht werden, bekommen wir zu sehen. Wie sie gedrillt werden zu Mördern, die auf Rache sinnen und an die Notwendigkeit zu glauben lernen, das Töten aus Rache immer weiter fortzusetzen, Auge um Auge. Wie einer, der als Mensch begann, am Ende ein Mörder ist, das ist die Geschichte des Films. Damit konfrontiert er uns, immer aus Sicht des Elite-Cops, der sich zu glauben zwingt, er stehe auf der richtigen Seite. Mit dem letzten Bild erst, bevor er mit einer trostlosen Weißblende schließt, nimmt Jose Padilha eine radikale Perspektivumkehr vor: Das Gewehr ist auf den, der am Boden liegt, gerichtet. Und die Kamera blickt, im Moment, da das Böse triumphiert, aus der Perspektive des Opfers - das selbst ein vielfacher Mörder ist - in den Lauf des Gewehrs.
Mit den Augen und Worten von Capitao Nascimento (Wagner Moura), dem Ich-Erzähler-Helden, lernen wir das System der Sondereinsatzpolizei von innen kennen. Nascimento, der gerade Vater wird, will lebend raus aus der Truppe und sucht deshalb einen Nachfolger. Andre Matias (Andre Ramiro), der Jura-Student und NGO-Mitarbeiter, kommt in Frage und sein bester Freund Neto auch. Der Film schildert ihren Weg vom Polizei-Anfänger zum Ausbildungscamp, viel mehr Plot braucht er schon nicht. Wie im Ausbildungslager die Aspiranten gedemütigt, erniedrigt, entmenscht werden, bekommen wir zu sehen. Wie sie gedrillt werden zu Mördern, die auf Rache sinnen und an die Notwendigkeit zu glauben lernen, das Töten aus Rache immer weiter fortzusetzen, Auge um Auge. Wie einer, der als Mensch begann, am Ende ein Mörder ist, das ist die Geschichte des Films. Damit konfrontiert er uns, immer aus Sicht des Elite-Cops, der sich zu glauben zwingt, er stehe auf der richtigen Seite. Mit dem letzten Bild erst, bevor er mit einer trostlosen Weißblende schließt, nimmt Jose Padilha eine radikale Perspektivumkehr vor: Das Gewehr ist auf den, der am Boden liegt, gerichtet. Und die Kamera blickt, im Moment, da das Böse triumphiert, aus der Perspektive des Opfers - das selbst ein vielfacher Mörder ist - in den Lauf des Gewehrs.Jose Padilha hat diese Geschichte, gegen alle Weltkinokonsensstilgewohnheiten, mitreißend verfilmt. Er reißt den Zuschauer mit, aber nicht in manipulativer Absicht zu schlichten Erklärungen, simplen Identifikationen oder wohlfeilen Lösungsvorschlägen. Er reißt ihn vielmehr mit ins Komplexe, mit in Szenen und Situationen, bei denen man sich auch als Zuschauer nicht einfach so auf die richtige Seite schlagen kann, und zwar deshalb, weil es eigentlich nur falsche Seiten gibt. Die Form des Erzählens ist die Quasi-Dokumentation. Nicht, wie der sehr artikulierte und intelligente Regisseur in der Pressekonferenz erklärt, das "fake and shake" unmotivierten Handkameragewackels mit seinen billigen Effekten. Sondern ein aus dem Regiekonzept entwickelter Dokumentarstil. Padilha hat keine einzige Szene nach den Regeln der Kunst aufgelöst: es gibt keine establishing shots, keine doppelten oder dreifachen Einstellungen einer Szene aus verschiedenen Kamerapositionen. Keine Vorschriften für die Darsteller, keine Marke auf dem Boden, an die sie sich halten mussten. Und keinen einzigen geschriebenen Dialog, die Schauspieler haben alles, im Rahmen von bloßen Beschreibungen ihrer Situation in der jeweiligen Szene, komplett improvisiert.
 Drei Monate nahm sich das Team Zeit für Proben vor dem Drehbeginn; die Darsteller der Cops haben sogar an einem tatsächlichen BOPE-Ausbildslehrgang teilgenommen. Das Resultat dieser Repräsentations-Strategien ist von naivem Authentizismus denkbar weit entfernt. Die Mischung aus mitreißendem Dokumentarstil und konsequenter Verfremdung durch die Wahl der Perspektive ist in ihren Wirkungen auf die erhellendste Weise desorientierend. Und zwar, indem sie den Zuschauer auf verdammt ungemütliche Weise aus allen bequemen Identifikationspositionen reißt. "Tropa de Elite" war in Brasilien ein Sensationserfolg, wurde erst auf illegalen DVDs und per Internet-Downloads millionenfach gesehen, war dann aber auch im Kino noch der erfolgreichste Film des Jahres. Es ist, wie beinahe zu erwarten, der Vorwurf lautgeworden, er sei Propaganda für die Elite-Truppe BOPE. In Wahrheit aber kann sich ein Film von den Vereinfachungen, die Propaganda ausmachen, nicht konsequenter entfernen, als "Tropa de Elite" dies tut.
Drei Monate nahm sich das Team Zeit für Proben vor dem Drehbeginn; die Darsteller der Cops haben sogar an einem tatsächlichen BOPE-Ausbildslehrgang teilgenommen. Das Resultat dieser Repräsentations-Strategien ist von naivem Authentizismus denkbar weit entfernt. Die Mischung aus mitreißendem Dokumentarstil und konsequenter Verfremdung durch die Wahl der Perspektive ist in ihren Wirkungen auf die erhellendste Weise desorientierend. Und zwar, indem sie den Zuschauer auf verdammt ungemütliche Weise aus allen bequemen Identifikationspositionen reißt. "Tropa de Elite" war in Brasilien ein Sensationserfolg, wurde erst auf illegalen DVDs und per Internet-Downloads millionenfach gesehen, war dann aber auch im Kino noch der erfolgreichste Film des Jahres. Es ist, wie beinahe zu erwarten, der Vorwurf lautgeworden, er sei Propaganda für die Elite-Truppe BOPE. In Wahrheit aber kann sich ein Film von den Vereinfachungen, die Propaganda ausmachen, nicht konsequenter entfernen, als "Tropa de Elite" dies tut.Ekkehard Knörer
Jose Padilha: "Tropa de elite - The Elite Squad". Mit Wagner Moura, Caio Junqueira, Andre Ramiro. Brasilien, Argentinien 2007, 118 Minuten. (Alle Termine)
Betulich: Dennis Lees "Fireflies in the Garden" (Wettbewerb)
 Ganz schweres Unglück: Erst kommt Julia Roberts beim Autounfall ums Leben, und dann auch noch jemand auf die Idee, einen Film darüber zu machen. Wobei die dürftige Geschichte und die absolut unlogische Konstruktion noch das geringste Übel an diesem Melodram um Freud und Leid der Familie sind. Was man Dennis Lees "Fireflies in the Garden" nicht verzeiht, ist seine Altbackenheit. Im Mittelpunkt steht Michael, erfolgreicher Schund-Autor in New York, der zu einer Familienfeier in seine Heimatstadt zurückkehrt. Im Gepäck hat er sein neues Manuskript, einen Roman über seine Kindheit, in der er schrecklich von seinem Vater schikaniert wurde. Auf dem Weg zu dieser irgendwie grundlos angesetzten Familienfeier kommt Julia Roberts bei einem Autounfall ums Leben - es war ein sehr kurzer Auftritt der Hochschwangeren -, aber immerhin sind jetzt schon alle zusammen, um zu trauern und all die großen und kleinen Dramen miteinander durchzustehen, die eine durchschnittlich dysfunktionale Familie ereilen. Darf man Mama anlügen? Muss man essen, was auf den Tisch kommt? Sollte man Handschuhe beim Abwaschen tragen?
Ganz schweres Unglück: Erst kommt Julia Roberts beim Autounfall ums Leben, und dann auch noch jemand auf die Idee, einen Film darüber zu machen. Wobei die dürftige Geschichte und die absolut unlogische Konstruktion noch das geringste Übel an diesem Melodram um Freud und Leid der Familie sind. Was man Dennis Lees "Fireflies in the Garden" nicht verzeiht, ist seine Altbackenheit. Im Mittelpunkt steht Michael, erfolgreicher Schund-Autor in New York, der zu einer Familienfeier in seine Heimatstadt zurückkehrt. Im Gepäck hat er sein neues Manuskript, einen Roman über seine Kindheit, in der er schrecklich von seinem Vater schikaniert wurde. Auf dem Weg zu dieser irgendwie grundlos angesetzten Familienfeier kommt Julia Roberts bei einem Autounfall ums Leben - es war ein sehr kurzer Auftritt der Hochschwangeren -, aber immerhin sind jetzt schon alle zusammen, um zu trauern und all die großen und kleinen Dramen miteinander durchzustehen, die eine durchschnittlich dysfunktionale Familie ereilen. Darf man Mama anlügen? Muss man essen, was auf den Tisch kommt? Sollte man Handschuhe beim Abwaschen tragen?Manchmal sind die Probleme auch gravierender, aber so richtig ernst dann doch wieder nicht. Michael kaputte Ehe etwa mit einer Alkoholikerin gerät durch Spontanheilung wieder ins rechte Lot, auf einmal ist die Frau nicht nur trocken, sondern auch schwanger. Aber meist bliebt es bei ungeheuer aufgeblasenen Belanglosigkeiten. Willem Dafoe muss als Haustyrann ständig Sätze von sich geben wie "Hier wird gegessen, was auf den Tisch kommt", Emily Watson spielt die betulichste Tante Jane seit Erfindung des Nudelholzes: "Was hab ich von Deiner Entschuldigung, davon geht der Fleck auch nicht weg". Und Michael liegt am liebsten auf dem Dach und sonnt sich in Selbstmitleid - auf die Idee, seinem Vater mal die Meinung zu sagen, kommt er nicht. Weil sich am Ende dieser gefühlten Fünfziger-Jahre-Schmonzette alle miteinander versöhnt haben, verbrennt Michael das Manuskript, das seinen Vater bloßgestellt hätte. Dummerweise ist eine Kopie in die Hände von Dennis Lee geraten.
Thekla Dannenberg
Dennis Lee: "Fireflies in the Garden". Mit Julia Roberts, Ryan Reynolds, Willem Dafoe, Emily Watson, Carrie-Anne Moss, Hayden Panettiere. USA 2008, 120 Minuten. (Alle Termine)
Angenehme Überraschung: John Crowleys "Boy A" (Panorama)
 Langsam wird es zur Tradition, dass die Briten bei jeder Berlinale einen neuen vielversprechenden Jungschauspieler präsentieren. 2006 probierte sich Cilian Murphy als Transvestit und Terrorist, 2007 tobte sich Jamie Bell als dächerkraxelnder Sonderling aus, und nun kommt Andrew Garfield und serviert uns einen 23-Jährigen, der als Zehnjähriger wegen Mordes verurteilt wurde und nun vorzeitig freigelassen wird.
Langsam wird es zur Tradition, dass die Briten bei jeder Berlinale einen neuen vielversprechenden Jungschauspieler präsentieren. 2006 probierte sich Cilian Murphy als Transvestit und Terrorist, 2007 tobte sich Jamie Bell als dächerkraxelnder Sonderling aus, und nun kommt Andrew Garfield und serviert uns einen 23-Jährigen, der als Zehnjähriger wegen Mordes verurteilt wurde und nun vorzeitig freigelassen wird.In Manchester soll er mit einer neuen Identität - er wählt den Namen Jack - noch einmal von vorne anfangen können. Verdient so jemand wie Jack, der zumindest für die Boulevardzeitungen das Böse an sich darstellt, eine zweite Chance.
Der Zuschauer vergibt ihm schnell. Garfield, der nur ein Jahr älter ist als sein Charakter, stellt uns einen verwirrten, aber gutherzigen Jungen vor, der in manchen Momenten bis an die Grenze zum Autismus überfordert ist von der neuen Welt, die da auf ihn einstürmt. Sehr intensives Schauspiel, bei einer Drehzeit von nur fünf Wochen erstaunlich. Garfield war im Kino kürzlich in Robert Redfords "Lions and Lambs" als orientierungsloser Student zu sehen.
Es läuft sehr gut für Jack: Neuer Job, neue Freunde, dann auch noch eine Freundin. Doch niemand weiß von seiner Vergangenheit. Zu guter Letzt rettet Jack sogar noch ein Leben, eine Art Wiedergutmachung für sein Verbrechen. Doch die Geister von damals holen ihn schneller ein als erwartet.
Auch wenn "Boy A" ein wenig schematisch daherkommt mit dem guten Jack und seiner tollen neuen Existenz, die in jeder Beziehung so hundertprozentig das Gegenteil seiner total verkorksten Kindheit ist, dieser Film ist dennoch eine angenehme Überraschung. Tolle Schauspieler, interessante Konstellation, stimmige Umsetzung.
Die britische Filmförderung hat hier in nachahmenswerter Weise funktioniert. "Boy A" ist mit sehr kleinem Budget entstanden, weil eigentlich als Fernsehfilm für den Channel 4 der BBC gedacht. Dort lief er Ende November 2007, ist also brandneu. Im Guardian-Blog wird der Film lebhaft von den Zuschauern diskutiert. Bürger diskutieren in einem privaten Medium die kulturellen Leistungen, die mit ihren Steuergelder entstehen. Toll! Vielleicht könnte man auch in Deutschland über ein derart lebendiges Ineinandergreifen der Medien nachdenken. Dazu müsste sich aber erst eine deutsche Zeitung finden, die dem Internet so offen und souverän begegnet wie der Guardian. Noch ist keine in Sicht.
Ein Bravourstück von der Insel also. Von welcher, das war im Saal zunächst unklar. Bei der Vorführung wurde John Crowley als englischer Filmemacher angekündigt. Nichts kann falscher sein. Und so war das erste, was Crowley sagte, als er das Mikrofon bekam: "Ich bin Ire, nur um das festzuhalten."
Christoph Mayerl
John Crowley: "Boy A". Mit Andrew Garfield, Peter Mullan, Katie Lyons, Shaun Evans. Großbritannien 2007, 100 Minuten. (Alle Termine)