Romane | Erinnerungen, Briefe, Essays, Reportagen | politisches Buch | Sachbücher
Politisches Buch
 Zwei Dinge scheint der große Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler in seinem Buch mit dem leicht irreführenden Titel "Die neue Umverteilung" sehr klarzustellen: Erstens ist die Ungleichheit nicht neu, die Bundesrepublik war nie eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, weder Bildung noch Heirat haben die soziale Durchlässigkeit vergrößert, Aufstiege sind so selten wie Abstiege. Zweitens ist die soziale Ungleichheit nicht das Ergebnis einer freien Marktgesellschaft, sondern von Abschottung. Welt-Rezensent Ekkehard Fuhr findet diesen "bärbeißigen Zwischenruf aus Bielefeld" deshalb umso wichtiger, als er sich nicht der umfassenden Marx-Lektüre verdanke, sondern dem Studium der Bundesamtstatistiken. Die Zeit zeigt sich schockiert und fragt sich: "Wo bleibt der Aufschrei?" Es gibt aber auch Gegenstimmen: In der SZ moniert der frühere Grünen-Politiker Felix Ekardt das Fehlen neuer Arbeitskonzepte. In der FAZ lehnt Jasper von Altenbockum überhaupt dieses negative Denken ab: Deutschland gehe es so gut wie seit der Varusschlacht nicht mehr. Und auch DRadio Kultur ist von "diesem eindimensionalen Buch" nicht recht überzeugt. Hier eine
Zwei Dinge scheint der große Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler in seinem Buch mit dem leicht irreführenden Titel "Die neue Umverteilung" sehr klarzustellen: Erstens ist die Ungleichheit nicht neu, die Bundesrepublik war nie eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, weder Bildung noch Heirat haben die soziale Durchlässigkeit vergrößert, Aufstiege sind so selten wie Abstiege. Zweitens ist die soziale Ungleichheit nicht das Ergebnis einer freien Marktgesellschaft, sondern von Abschottung. Welt-Rezensent Ekkehard Fuhr findet diesen "bärbeißigen Zwischenruf aus Bielefeld" deshalb umso wichtiger, als er sich nicht der umfassenden Marx-Lektüre verdanke, sondern dem Studium der Bundesamtstatistiken. Die Zeit zeigt sich schockiert und fragt sich: "Wo bleibt der Aufschrei?" Es gibt aber auch Gegenstimmen: In der SZ moniert der frühere Grünen-Politiker Felix Ekardt das Fehlen neuer Arbeitskonzepte. In der FAZ lehnt Jasper von Altenbockum überhaupt dieses negative Denken ab: Deutschland gehe es so gut wie seit der Varusschlacht nicht mehr. Und auch DRadio Kultur ist von "diesem eindimensionalen Buch" nicht recht überzeugt. Hier eine
 Großes Aufsehen, nicht zuletzt wegen des bevorstehenden NSU-Prozesses, erregte Semiya Simseks Buch "Schmerzliche Heimat" in dem sie von der Einwandererkarriere ihres Vaters Enver Simsek erzählt, seiner Ermordung durch die NSU und die anschließenden unzulänglichen und für die Opferfamilie demütigenden Ermittlungen durch die Bundesbehörden. Fatma Aydemir zeigt sich in der taz erschüttert vom "redundantem Exotismus", mit dem die migrantischen Opfer von den Ermittlern behandelt wurden. Mariam Lau äußert in der Zeit den Wunsch, dass die Lebensleistung von eingewanderten Unternehmern künftig angemessen gewürdigt werden möge. Dieter Kassel sprach mit der mittlerweile in der Türkei lebenden Autorin im DRadio. In der Welt war Necla Kelek bewegt von der Erinnerung Simseks, das Nachwort der Anwälte Simseks kritisierte sie jedoch entschieden: Kritik am Islam dürfe man nicht mit Rassismus gleichstellen.
Großes Aufsehen, nicht zuletzt wegen des bevorstehenden NSU-Prozesses, erregte Semiya Simseks Buch "Schmerzliche Heimat" in dem sie von der Einwandererkarriere ihres Vaters Enver Simsek erzählt, seiner Ermordung durch die NSU und die anschließenden unzulänglichen und für die Opferfamilie demütigenden Ermittlungen durch die Bundesbehörden. Fatma Aydemir zeigt sich in der taz erschüttert vom "redundantem Exotismus", mit dem die migrantischen Opfer von den Ermittlern behandelt wurden. Mariam Lau äußert in der Zeit den Wunsch, dass die Lebensleistung von eingewanderten Unternehmern künftig angemessen gewürdigt werden möge. Dieter Kassel sprach mit der mittlerweile in der Türkei lebenden Autorin im DRadio. In der Welt war Necla Kelek bewegt von der Erinnerung Simseks, das Nachwort der Anwälte Simseks kritisierte sie jedoch entschieden: Kritik am Islam dürfe man nicht mit Rassismus gleichstellen.
 "Warum jeder jedem etwas schuldet und keiner jemals etwas zurückzahlt" - für John Lanchesters Crashkurs im Bankenwesen muss man einiges verkraften können, wenn wir den Rezensenten Glauben schenken: Jede Menge Wahnsinn, Ignoranz und sehr galligen Humor. Denn die Geschichte der immer noch nicht ausgestandenen Finanzkrise, wie der britische Autor und Journalist sie erzählt, ist nicht nur eine, in der faule Kredite zu Vermögenswerten umdeklariert werden, sondern auch eine des völligen Versagens bei Banken, Bankenaufsicht und in der Wirtschaftswissenschaft. Lanchester, weiß zum Beispiel ein begeisterter Hannes Hintermeier in der FAZ zu erzählen, hat das Bankgeschäft sozusagen von seinem Vater, einem Bankier in Hongkong, in die Wiege gelegt bekommen und weiß seitdem, dass er den Banken sein Geld leiht, wenn er es aufs Konto bringt - das verschiebt die Perspektive. In der SZ zeigt sich Franziska Augstein überzeugt. Und in der taz hebt Tim Caspar Boehme hervor, dass Lanchester das System nicht bloß kritisiert, sondern eine auch "für Laien allgemeinverständliche Beschreibung der Arbeitsweise von Banken" bietet. Hier eine
"Warum jeder jedem etwas schuldet und keiner jemals etwas zurückzahlt" - für John Lanchesters Crashkurs im Bankenwesen muss man einiges verkraften können, wenn wir den Rezensenten Glauben schenken: Jede Menge Wahnsinn, Ignoranz und sehr galligen Humor. Denn die Geschichte der immer noch nicht ausgestandenen Finanzkrise, wie der britische Autor und Journalist sie erzählt, ist nicht nur eine, in der faule Kredite zu Vermögenswerten umdeklariert werden, sondern auch eine des völligen Versagens bei Banken, Bankenaufsicht und in der Wirtschaftswissenschaft. Lanchester, weiß zum Beispiel ein begeisterter Hannes Hintermeier in der FAZ zu erzählen, hat das Bankgeschäft sozusagen von seinem Vater, einem Bankier in Hongkong, in die Wiege gelegt bekommen und weiß seitdem, dass er den Banken sein Geld leiht, wenn er es aufs Konto bringt - das verschiebt die Perspektive. In der SZ zeigt sich Franziska Augstein überzeugt. Und in der taz hebt Tim Caspar Boehme hervor, dass Lanchester das System nicht bloß kritisiert, sondern eine auch "für Laien allgemeinverständliche Beschreibung der Arbeitsweise von Banken" bietet. Hier eine

 In der andauernden Finanzkrise mehren sich die kritischen und skeptischen Stimmen. Eine luzide Beschreibung der Ursachen der Krise liefert Wolfgang Streeck in seinen im Band "Gekaufte Zeit" gesammelten Adorno-Vorlesungen. Die Zeit lobt seine "scharfen Analysen", DRadio nennt es ein "beeindruckendes Buch" und die taz findet findet es "faszinierend". In einem Interview mit der FR erläutert Streeck seine Kernthesen. Edward und Robert Skidelsky richten den Blick in die Zukunft und fragen in "Wie viel ist genug?" nach gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaftsmodellen. "Die Vision der Skidelskys zeigt, dass die Wirtschaftswissenschaften eine Frage der Moral sind", findet DRadio. Le Monde diplomatique bringt einen prägnanten Auszug, Elisabeth von Thadden sprach mit dem Autorenduo für die Zeit.
In der andauernden Finanzkrise mehren sich die kritischen und skeptischen Stimmen. Eine luzide Beschreibung der Ursachen der Krise liefert Wolfgang Streeck in seinen im Band "Gekaufte Zeit" gesammelten Adorno-Vorlesungen. Die Zeit lobt seine "scharfen Analysen", DRadio nennt es ein "beeindruckendes Buch" und die taz findet findet es "faszinierend". In einem Interview mit der FR erläutert Streeck seine Kernthesen. Edward und Robert Skidelsky richten den Blick in die Zukunft und fragen in "Wie viel ist genug?" nach gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaftsmodellen. "Die Vision der Skidelskys zeigt, dass die Wirtschaftswissenschaften eine Frage der Moral sind", findet DRadio. Le Monde diplomatique bringt einen prägnanten Auszug, Elisabeth von Thadden sprach mit dem Autorenduo für die Zeit.
 Fünf Jahre lang hat Shereen El Feki, Immunologin und Journalistin, für ihr Buch "Sex und die Zitadelle" Männern und Frauen in der arabischen Welt zum Thema Sex befragt: Was sie selbst tun, was sie nicht tun, was sie über Sexualität denken und warum. Für die Autorin ist die Sexualität ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse, die zwar von Kolonialismus, Diktaturen und einem repressiven Islam geprägt wurden, aber eben auch zur Arabellion führten. El Feki hofft, dass die politische auch zur sexuellen Revolution wird, wie sie in einem Interview in der FAZ erläutert: "Ich glaube, dass der persönliche Mensch den politischen beeinflusst und umgekehrt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie junge Menschen engagierte Bürger sein sollen, wenn sie weder die Freiheit noch die Möglichkeiten haben, auf Informationen über ihre Körper und ihre Sexualität zuzugreifen." In der taz hebt Alexandra Senfft hervor, dass El Feki bei allen beklemmenden Beschreibungen durchaus komische Situationen schildere, wenn sie etwa "im Dessousladen Hijab-tragende Frauen beim Einkauf heißer Höschen beobachtet". "Eine ungewöhnliche Frau, ein ungewöhnliches Buch. Eines, das Standards setzt", lobt DRadio. Hier eine
Fünf Jahre lang hat Shereen El Feki, Immunologin und Journalistin, für ihr Buch "Sex und die Zitadelle" Männern und Frauen in der arabischen Welt zum Thema Sex befragt: Was sie selbst tun, was sie nicht tun, was sie über Sexualität denken und warum. Für die Autorin ist die Sexualität ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse, die zwar von Kolonialismus, Diktaturen und einem repressiven Islam geprägt wurden, aber eben auch zur Arabellion führten. El Feki hofft, dass die politische auch zur sexuellen Revolution wird, wie sie in einem Interview in der FAZ erläutert: "Ich glaube, dass der persönliche Mensch den politischen beeinflusst und umgekehrt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie junge Menschen engagierte Bürger sein sollen, wenn sie weder die Freiheit noch die Möglichkeiten haben, auf Informationen über ihre Körper und ihre Sexualität zuzugreifen." In der taz hebt Alexandra Senfft hervor, dass El Feki bei allen beklemmenden Beschreibungen durchaus komische Situationen schildere, wenn sie etwa "im Dessousladen Hijab-tragende Frauen beim Einkauf heißer Höschen beobachtet". "Eine ungewöhnliche Frau, ein ungewöhnliches Buch. Eines, das Standards setzt", lobt DRadio. Hier eine
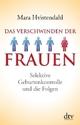
 In großen Teilen der Welt, in China, Indien und Teilen Osteuropas, gilt die Geburt eines Mädchens als Unglück für die Familie, wirtschaftliche und soziale Faktoren befeuern in diesen Ländern einen "weiblichen Fetizid", der ein wachsendes Ungleichgewicht des Geschlechterverhältnisses zur Folge hat: in China fehlen bereits so viele Frauen wie die USA Einwohnerinnen hat. Mara Hvistendahl beschreibt in ihrer Aufsehen erregenden, jetzt auf Deutsch erschienenen Studie "Das Verschwinden der Frauen" die Ursachen und Auswirkungen. "Faszinierend" findet Andreas Rinke im DRadio Hvistendahls Ansatz, das "informelle Tötungs-Komplott" als "Zusammenspiel von Eltern, Ärzten, Industrie, Demographen und dem Einsatz der Technik" zu zeigen. In der Welt hebt Marion Lühe positiv hervor, dass die Autorin die Probleme klar benenne, sich aber "vor einseitigen Schuldzuweisungen hütet". Eva Berendsen zeigt sich in der FAZ ebenfalls erschüttert, hätte sich für dieses Thema allerdings ein etwas besser strukturiertes Buch und eine etwas bessere Übersetzung gewünscht. Hingewiesen sei auch auf Katja Kraus' Geschichten von Erfolg und Scheitern, die die die ehemalige Fußballnationalspielerin und Managerin im Vorstand des HSV in ihrem Band "Macht" erzählt.
In großen Teilen der Welt, in China, Indien und Teilen Osteuropas, gilt die Geburt eines Mädchens als Unglück für die Familie, wirtschaftliche und soziale Faktoren befeuern in diesen Ländern einen "weiblichen Fetizid", der ein wachsendes Ungleichgewicht des Geschlechterverhältnisses zur Folge hat: in China fehlen bereits so viele Frauen wie die USA Einwohnerinnen hat. Mara Hvistendahl beschreibt in ihrer Aufsehen erregenden, jetzt auf Deutsch erschienenen Studie "Das Verschwinden der Frauen" die Ursachen und Auswirkungen. "Faszinierend" findet Andreas Rinke im DRadio Hvistendahls Ansatz, das "informelle Tötungs-Komplott" als "Zusammenspiel von Eltern, Ärzten, Industrie, Demographen und dem Einsatz der Technik" zu zeigen. In der Welt hebt Marion Lühe positiv hervor, dass die Autorin die Probleme klar benenne, sich aber "vor einseitigen Schuldzuweisungen hütet". Eva Berendsen zeigt sich in der FAZ ebenfalls erschüttert, hätte sich für dieses Thema allerdings ein etwas besser strukturiertes Buch und eine etwas bessere Übersetzung gewünscht. Hingewiesen sei auch auf Katja Kraus' Geschichten von Erfolg und Scheitern, die die die ehemalige Fußballnationalspielerin und Managerin im Vorstand des HSV in ihrem Band "Macht" erzählt.
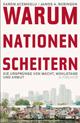
 Mit Interesse wurde die Untersuchung "Warum Nationen scheitern" der beiden politischen Ökonomen Daron Acemoglu und James A. Robinson aufgenommen. Die beiden wollen damit zeigen, dass Staaten dann erfolgreich sind, wenn sie die Rechte und Freiheiten ihrer Bürger nicht nur proklamieren, sondern in Institutionen festigen. Umgekehrt führe die Institutionalisierung von Macht und Eliten in die Sackgasse. In der Zeit fand Elisabeth von Thadden das Buch sehr lehrreich, aber in seiner Argumentation auch recht monokausal. Hier eineSehr genau gelesen wurde auch Peter Beinarts Buch "Die amerikanischen Juden und Israel" Beinart, der in amerikanischen Magazinen eine hitzige Debatte ausgelöst hat, geht darin scharf mit der Siedlungspolitik Benjamin Netanjahus ins Gericht sowie seiner Unterstützung durch jüdische Organisationen in den USA. In der Jüdischen Allgemeinen empfahl Micha Brumlik das Buch, in der Zeit Jörg Lau.
Mit Interesse wurde die Untersuchung "Warum Nationen scheitern" der beiden politischen Ökonomen Daron Acemoglu und James A. Robinson aufgenommen. Die beiden wollen damit zeigen, dass Staaten dann erfolgreich sind, wenn sie die Rechte und Freiheiten ihrer Bürger nicht nur proklamieren, sondern in Institutionen festigen. Umgekehrt führe die Institutionalisierung von Macht und Eliten in die Sackgasse. In der Zeit fand Elisabeth von Thadden das Buch sehr lehrreich, aber in seiner Argumentation auch recht monokausal. Hier eineSehr genau gelesen wurde auch Peter Beinarts Buch "Die amerikanischen Juden und Israel" Beinart, der in amerikanischen Magazinen eine hitzige Debatte ausgelöst hat, geht darin scharf mit der Siedlungspolitik Benjamin Netanjahus ins Gericht sowie seiner Unterstützung durch jüdische Organisationen in den USA. In der Jüdischen Allgemeinen empfahl Micha Brumlik das Buch, in der Zeit Jörg Lau.

 Schon im letzten Bücherbrief empfohlen: Wolfgang Kraushaars Studie über die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus, "Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?" und Götz Alys hervorragend besprochene Gesellschaftsgeschichte "Die Belasteten" ein Buch über die "Euthanasie" im Dritten Reich. Hier eine
Schon im letzten Bücherbrief empfohlen: Wolfgang Kraushaars Studie über die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus, "Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?" und Götz Alys hervorragend besprochene Gesellschaftsgeschichte "Die Belasteten" ein Buch über die "Euthanasie" im Dritten Reich. Hier eine
Romane | Erinnerungen, Briefe, Essays, Reportagen | politisches Buch | Sachbücher
Politisches Buch
 Zwei Dinge scheint der große Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler in seinem Buch mit dem leicht irreführenden Titel "Die neue Umverteilung" sehr klarzustellen: Erstens ist die Ungleichheit nicht neu, die Bundesrepublik war nie eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, weder Bildung noch Heirat haben die soziale Durchlässigkeit vergrößert, Aufstiege sind so selten wie Abstiege. Zweitens ist die soziale Ungleichheit nicht das Ergebnis einer freien Marktgesellschaft, sondern von Abschottung. Welt-Rezensent Ekkehard Fuhr findet diesen "bärbeißigen Zwischenruf aus Bielefeld" deshalb umso wichtiger, als er sich nicht der umfassenden Marx-Lektüre verdanke, sondern dem Studium der Bundesamtstatistiken. Die Zeit zeigt sich schockiert und fragt sich: "Wo bleibt der Aufschrei?" Es gibt aber auch Gegenstimmen: In der SZ moniert der frühere Grünen-Politiker Felix Ekardt das Fehlen neuer Arbeitskonzepte. In der FAZ lehnt Jasper von Altenbockum überhaupt dieses negative Denken ab: Deutschland gehe es so gut wie seit der Varusschlacht nicht mehr. Und auch DRadio Kultur ist von "diesem eindimensionalen Buch" nicht recht überzeugt. Hier eine
Zwei Dinge scheint der große Sozialhistoriker Hans-Ulrich Wehler in seinem Buch mit dem leicht irreführenden Titel "Die neue Umverteilung" sehr klarzustellen: Erstens ist die Ungleichheit nicht neu, die Bundesrepublik war nie eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft, weder Bildung noch Heirat haben die soziale Durchlässigkeit vergrößert, Aufstiege sind so selten wie Abstiege. Zweitens ist die soziale Ungleichheit nicht das Ergebnis einer freien Marktgesellschaft, sondern von Abschottung. Welt-Rezensent Ekkehard Fuhr findet diesen "bärbeißigen Zwischenruf aus Bielefeld" deshalb umso wichtiger, als er sich nicht der umfassenden Marx-Lektüre verdanke, sondern dem Studium der Bundesamtstatistiken. Die Zeit zeigt sich schockiert und fragt sich: "Wo bleibt der Aufschrei?" Es gibt aber auch Gegenstimmen: In der SZ moniert der frühere Grünen-Politiker Felix Ekardt das Fehlen neuer Arbeitskonzepte. In der FAZ lehnt Jasper von Altenbockum überhaupt dieses negative Denken ab: Deutschland gehe es so gut wie seit der Varusschlacht nicht mehr. Und auch DRadio Kultur ist von "diesem eindimensionalen Buch" nicht recht überzeugt. Hier eine Großes Aufsehen, nicht zuletzt wegen des bevorstehenden NSU-Prozesses, erregte Semiya Simseks Buch "Schmerzliche Heimat" in dem sie von der Einwandererkarriere ihres Vaters Enver Simsek erzählt, seiner Ermordung durch die NSU und die anschließenden unzulänglichen und für die Opferfamilie demütigenden Ermittlungen durch die Bundesbehörden. Fatma Aydemir zeigt sich in der taz erschüttert vom "redundantem Exotismus", mit dem die migrantischen Opfer von den Ermittlern behandelt wurden. Mariam Lau äußert in der Zeit den Wunsch, dass die Lebensleistung von eingewanderten Unternehmern künftig angemessen gewürdigt werden möge. Dieter Kassel sprach mit der mittlerweile in der Türkei lebenden Autorin im DRadio. In der Welt war Necla Kelek bewegt von der Erinnerung Simseks, das Nachwort der Anwälte Simseks kritisierte sie jedoch entschieden: Kritik am Islam dürfe man nicht mit Rassismus gleichstellen.
Großes Aufsehen, nicht zuletzt wegen des bevorstehenden NSU-Prozesses, erregte Semiya Simseks Buch "Schmerzliche Heimat" in dem sie von der Einwandererkarriere ihres Vaters Enver Simsek erzählt, seiner Ermordung durch die NSU und die anschließenden unzulänglichen und für die Opferfamilie demütigenden Ermittlungen durch die Bundesbehörden. Fatma Aydemir zeigt sich in der taz erschüttert vom "redundantem Exotismus", mit dem die migrantischen Opfer von den Ermittlern behandelt wurden. Mariam Lau äußert in der Zeit den Wunsch, dass die Lebensleistung von eingewanderten Unternehmern künftig angemessen gewürdigt werden möge. Dieter Kassel sprach mit der mittlerweile in der Türkei lebenden Autorin im DRadio. In der Welt war Necla Kelek bewegt von der Erinnerung Simseks, das Nachwort der Anwälte Simseks kritisierte sie jedoch entschieden: Kritik am Islam dürfe man nicht mit Rassismus gleichstellen. "Warum jeder jedem etwas schuldet und keiner jemals etwas zurückzahlt" - für John Lanchesters Crashkurs im Bankenwesen muss man einiges verkraften können, wenn wir den Rezensenten Glauben schenken: Jede Menge Wahnsinn, Ignoranz und sehr galligen Humor. Denn die Geschichte der immer noch nicht ausgestandenen Finanzkrise, wie der britische Autor und Journalist sie erzählt, ist nicht nur eine, in der faule Kredite zu Vermögenswerten umdeklariert werden, sondern auch eine des völligen Versagens bei Banken, Bankenaufsicht und in der Wirtschaftswissenschaft. Lanchester, weiß zum Beispiel ein begeisterter Hannes Hintermeier in der FAZ zu erzählen, hat das Bankgeschäft sozusagen von seinem Vater, einem Bankier in Hongkong, in die Wiege gelegt bekommen und weiß seitdem, dass er den Banken sein Geld leiht, wenn er es aufs Konto bringt - das verschiebt die Perspektive. In der SZ zeigt sich Franziska Augstein überzeugt. Und in der taz hebt Tim Caspar Boehme hervor, dass Lanchester das System nicht bloß kritisiert, sondern eine auch "für Laien allgemeinverständliche Beschreibung der Arbeitsweise von Banken" bietet. Hier eine
"Warum jeder jedem etwas schuldet und keiner jemals etwas zurückzahlt" - für John Lanchesters Crashkurs im Bankenwesen muss man einiges verkraften können, wenn wir den Rezensenten Glauben schenken: Jede Menge Wahnsinn, Ignoranz und sehr galligen Humor. Denn die Geschichte der immer noch nicht ausgestandenen Finanzkrise, wie der britische Autor und Journalist sie erzählt, ist nicht nur eine, in der faule Kredite zu Vermögenswerten umdeklariert werden, sondern auch eine des völligen Versagens bei Banken, Bankenaufsicht und in der Wirtschaftswissenschaft. Lanchester, weiß zum Beispiel ein begeisterter Hannes Hintermeier in der FAZ zu erzählen, hat das Bankgeschäft sozusagen von seinem Vater, einem Bankier in Hongkong, in die Wiege gelegt bekommen und weiß seitdem, dass er den Banken sein Geld leiht, wenn er es aufs Konto bringt - das verschiebt die Perspektive. In der SZ zeigt sich Franziska Augstein überzeugt. Und in der taz hebt Tim Caspar Boehme hervor, dass Lanchester das System nicht bloß kritisiert, sondern eine auch "für Laien allgemeinverständliche Beschreibung der Arbeitsweise von Banken" bietet. Hier eine
 In der andauernden Finanzkrise mehren sich die kritischen und skeptischen Stimmen. Eine luzide Beschreibung der Ursachen der Krise liefert Wolfgang Streeck in seinen im Band "Gekaufte Zeit" gesammelten Adorno-Vorlesungen. Die Zeit lobt seine "scharfen Analysen", DRadio nennt es ein "beeindruckendes Buch" und die taz findet findet es "faszinierend". In einem Interview mit der FR erläutert Streeck seine Kernthesen. Edward und Robert Skidelsky richten den Blick in die Zukunft und fragen in "Wie viel ist genug?" nach gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaftsmodellen. "Die Vision der Skidelskys zeigt, dass die Wirtschaftswissenschaften eine Frage der Moral sind", findet DRadio. Le Monde diplomatique bringt einen prägnanten Auszug, Elisabeth von Thadden sprach mit dem Autorenduo für die Zeit.
In der andauernden Finanzkrise mehren sich die kritischen und skeptischen Stimmen. Eine luzide Beschreibung der Ursachen der Krise liefert Wolfgang Streeck in seinen im Band "Gekaufte Zeit" gesammelten Adorno-Vorlesungen. Die Zeit lobt seine "scharfen Analysen", DRadio nennt es ein "beeindruckendes Buch" und die taz findet findet es "faszinierend". In einem Interview mit der FR erläutert Streeck seine Kernthesen. Edward und Robert Skidelsky richten den Blick in die Zukunft und fragen in "Wie viel ist genug?" nach gerechteren und nachhaltigeren Wirtschaftsmodellen. "Die Vision der Skidelskys zeigt, dass die Wirtschaftswissenschaften eine Frage der Moral sind", findet DRadio. Le Monde diplomatique bringt einen prägnanten Auszug, Elisabeth von Thadden sprach mit dem Autorenduo für die Zeit. Fünf Jahre lang hat Shereen El Feki, Immunologin und Journalistin, für ihr Buch "Sex und die Zitadelle" Männern und Frauen in der arabischen Welt zum Thema Sex befragt: Was sie selbst tun, was sie nicht tun, was sie über Sexualität denken und warum. Für die Autorin ist die Sexualität ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse, die zwar von Kolonialismus, Diktaturen und einem repressiven Islam geprägt wurden, aber eben auch zur Arabellion führten. El Feki hofft, dass die politische auch zur sexuellen Revolution wird, wie sie in einem Interview in der FAZ erläutert: "Ich glaube, dass der persönliche Mensch den politischen beeinflusst und umgekehrt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie junge Menschen engagierte Bürger sein sollen, wenn sie weder die Freiheit noch die Möglichkeiten haben, auf Informationen über ihre Körper und ihre Sexualität zuzugreifen." In der taz hebt Alexandra Senfft hervor, dass El Feki bei allen beklemmenden Beschreibungen durchaus komische Situationen schildere, wenn sie etwa "im Dessousladen Hijab-tragende Frauen beim Einkauf heißer Höschen beobachtet". "Eine ungewöhnliche Frau, ein ungewöhnliches Buch. Eines, das Standards setzt", lobt DRadio. Hier eine
Fünf Jahre lang hat Shereen El Feki, Immunologin und Journalistin, für ihr Buch "Sex und die Zitadelle" Männern und Frauen in der arabischen Welt zum Thema Sex befragt: Was sie selbst tun, was sie nicht tun, was sie über Sexualität denken und warum. Für die Autorin ist die Sexualität ein Spiegel der gesellschaftlichen Verhältnisse, die zwar von Kolonialismus, Diktaturen und einem repressiven Islam geprägt wurden, aber eben auch zur Arabellion führten. El Feki hofft, dass die politische auch zur sexuellen Revolution wird, wie sie in einem Interview in der FAZ erläutert: "Ich glaube, dass der persönliche Mensch den politischen beeinflusst und umgekehrt. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie junge Menschen engagierte Bürger sein sollen, wenn sie weder die Freiheit noch die Möglichkeiten haben, auf Informationen über ihre Körper und ihre Sexualität zuzugreifen." In der taz hebt Alexandra Senfft hervor, dass El Feki bei allen beklemmenden Beschreibungen durchaus komische Situationen schildere, wenn sie etwa "im Dessousladen Hijab-tragende Frauen beim Einkauf heißer Höschen beobachtet". "Eine ungewöhnliche Frau, ein ungewöhnliches Buch. Eines, das Standards setzt", lobt DRadio. Hier eine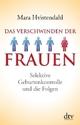
 In großen Teilen der Welt, in China, Indien und Teilen Osteuropas, gilt die Geburt eines Mädchens als Unglück für die Familie, wirtschaftliche und soziale Faktoren befeuern in diesen Ländern einen "weiblichen Fetizid", der ein wachsendes Ungleichgewicht des Geschlechterverhältnisses zur Folge hat: in China fehlen bereits so viele Frauen wie die USA Einwohnerinnen hat. Mara Hvistendahl beschreibt in ihrer Aufsehen erregenden, jetzt auf Deutsch erschienenen Studie "Das Verschwinden der Frauen" die Ursachen und Auswirkungen. "Faszinierend" findet Andreas Rinke im DRadio Hvistendahls Ansatz, das "informelle Tötungs-Komplott" als "Zusammenspiel von Eltern, Ärzten, Industrie, Demographen und dem Einsatz der Technik" zu zeigen. In der Welt hebt Marion Lühe positiv hervor, dass die Autorin die Probleme klar benenne, sich aber "vor einseitigen Schuldzuweisungen hütet". Eva Berendsen zeigt sich in der FAZ ebenfalls erschüttert, hätte sich für dieses Thema allerdings ein etwas besser strukturiertes Buch und eine etwas bessere Übersetzung gewünscht. Hingewiesen sei auch auf Katja Kraus' Geschichten von Erfolg und Scheitern, die die die ehemalige Fußballnationalspielerin und Managerin im Vorstand des HSV in ihrem Band "Macht" erzählt.
In großen Teilen der Welt, in China, Indien und Teilen Osteuropas, gilt die Geburt eines Mädchens als Unglück für die Familie, wirtschaftliche und soziale Faktoren befeuern in diesen Ländern einen "weiblichen Fetizid", der ein wachsendes Ungleichgewicht des Geschlechterverhältnisses zur Folge hat: in China fehlen bereits so viele Frauen wie die USA Einwohnerinnen hat. Mara Hvistendahl beschreibt in ihrer Aufsehen erregenden, jetzt auf Deutsch erschienenen Studie "Das Verschwinden der Frauen" die Ursachen und Auswirkungen. "Faszinierend" findet Andreas Rinke im DRadio Hvistendahls Ansatz, das "informelle Tötungs-Komplott" als "Zusammenspiel von Eltern, Ärzten, Industrie, Demographen und dem Einsatz der Technik" zu zeigen. In der Welt hebt Marion Lühe positiv hervor, dass die Autorin die Probleme klar benenne, sich aber "vor einseitigen Schuldzuweisungen hütet". Eva Berendsen zeigt sich in der FAZ ebenfalls erschüttert, hätte sich für dieses Thema allerdings ein etwas besser strukturiertes Buch und eine etwas bessere Übersetzung gewünscht. Hingewiesen sei auch auf Katja Kraus' Geschichten von Erfolg und Scheitern, die die die ehemalige Fußballnationalspielerin und Managerin im Vorstand des HSV in ihrem Band "Macht" erzählt.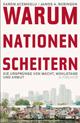
 Mit Interesse wurde die Untersuchung "Warum Nationen scheitern" der beiden politischen Ökonomen Daron Acemoglu und James A. Robinson aufgenommen. Die beiden wollen damit zeigen, dass Staaten dann erfolgreich sind, wenn sie die Rechte und Freiheiten ihrer Bürger nicht nur proklamieren, sondern in Institutionen festigen. Umgekehrt führe die Institutionalisierung von Macht und Eliten in die Sackgasse. In der Zeit fand Elisabeth von Thadden das Buch sehr lehrreich, aber in seiner Argumentation auch recht monokausal. Hier eineSehr genau gelesen wurde auch Peter Beinarts Buch "Die amerikanischen Juden und Israel" Beinart, der in amerikanischen Magazinen eine hitzige Debatte ausgelöst hat, geht darin scharf mit der Siedlungspolitik Benjamin Netanjahus ins Gericht sowie seiner Unterstützung durch jüdische Organisationen in den USA. In der Jüdischen Allgemeinen empfahl Micha Brumlik das Buch, in der Zeit Jörg Lau.
Mit Interesse wurde die Untersuchung "Warum Nationen scheitern" der beiden politischen Ökonomen Daron Acemoglu und James A. Robinson aufgenommen. Die beiden wollen damit zeigen, dass Staaten dann erfolgreich sind, wenn sie die Rechte und Freiheiten ihrer Bürger nicht nur proklamieren, sondern in Institutionen festigen. Umgekehrt führe die Institutionalisierung von Macht und Eliten in die Sackgasse. In der Zeit fand Elisabeth von Thadden das Buch sehr lehrreich, aber in seiner Argumentation auch recht monokausal. Hier eineSehr genau gelesen wurde auch Peter Beinarts Buch "Die amerikanischen Juden und Israel" Beinart, der in amerikanischen Magazinen eine hitzige Debatte ausgelöst hat, geht darin scharf mit der Siedlungspolitik Benjamin Netanjahus ins Gericht sowie seiner Unterstützung durch jüdische Organisationen in den USA. In der Jüdischen Allgemeinen empfahl Micha Brumlik das Buch, in der Zeit Jörg Lau.
 Schon im letzten Bücherbrief empfohlen: Wolfgang Kraushaars Studie über die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus, "Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?" und Götz Alys hervorragend besprochene Gesellschaftsgeschichte "Die Belasteten" ein Buch über die "Euthanasie" im Dritten Reich. Hier eine
Schon im letzten Bücherbrief empfohlen: Wolfgang Kraushaars Studie über die antisemitischen Wurzeln des deutschen Terrorismus, "Wann endlich beginnt bei Euch der Kampf gegen die heilige Kuh Israel?" und Götz Alys hervorragend besprochene Gesellschaftsgeschichte "Die Belasteten" ein Buch über die "Euthanasie" im Dritten Reich. Hier eineRomane | Erinnerungen, Briefe, Essays, Reportagen | politisches Buch | Sachbücher
Kommentieren








