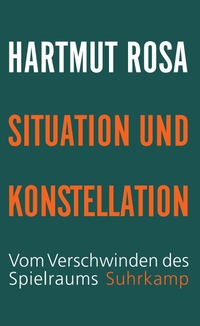Vom Nachttisch geräumt
Die Bücherkolumne. Von Arno Widmann
19.12.2002. Essays von Salman Rushdie, ein Band mit Texten von und über Heiner Goebbels, Abhandlungen von Francois Jullien, ein Gespräch zwischen Michael Ballhaus und Tom Tykwer und ein Bildband zur Architekturgeschichte Persiens. Grenzen
 Salman Rushdie ist ein phantastischer Erzähler und einer der besten lebenden Essayisten. "Step across this line" (Auszug) sammelt seine Aufsätze der vergangenen zehn Jahre. Der Titelessay ist ein Vortrag, den er im vergangenen Februar in Yale gehalten hat. Rushdie, der einige Erfahrungen hat, was Grenzüberschreitungen angeht, beginnt, begeisterter Mythenerzähler, der er ist, mit dem Augenblick, da ein Lebewesen den Ozean verließ, diese Grenze überschritt und entdeckte, dass es auf dem Land atmen konnte. Vor diesem Lebewesen muss es andere gegeben haben, die wieder zurücksprangen in ihr Element und viele, viele andere, die erstickten inmitten der Luft. Sie wussten nicht, wie ihr der Sauerstoff zu entnehmen war. Es gab vielleicht Millionen dieser in keiner Chronik aufgezeichneten Tode. Dann endlich versuchte es wieder einer, und der schaffte es. Warum tat er es? Warum schreckten ihn nicht die Spuren der Gescheiterten?
Salman Rushdie ist ein phantastischer Erzähler und einer der besten lebenden Essayisten. "Step across this line" (Auszug) sammelt seine Aufsätze der vergangenen zehn Jahre. Der Titelessay ist ein Vortrag, den er im vergangenen Februar in Yale gehalten hat. Rushdie, der einige Erfahrungen hat, was Grenzüberschreitungen angeht, beginnt, begeisterter Mythenerzähler, der er ist, mit dem Augenblick, da ein Lebewesen den Ozean verließ, diese Grenze überschritt und entdeckte, dass es auf dem Land atmen konnte. Vor diesem Lebewesen muss es andere gegeben haben, die wieder zurücksprangen in ihr Element und viele, viele andere, die erstickten inmitten der Luft. Sie wussten nicht, wie ihr der Sauerstoff zu entnehmen war. Es gab vielleicht Millionen dieser in keiner Chronik aufgezeichneten Tode. Dann endlich versuchte es wieder einer, und der schaffte es. Warum tat er es? Warum schreckten ihn nicht die Spuren der Gescheiterten?
Salman Rushdie stellt diese Fragen, und natürlich mokiert er sich über sie. Er weiß, dass diese frühen Wesen kein Motiv hatten, das Wasser zu verlassen. Das Wasser missfiel ihnen nicht. Sie trieb keine Sehnsucht in ein Land Utopia. Rushdie weiß aber auch, und genau darauf will er uns hinweisen, dass die Motive, denen wir zu folgen glauben, Rationalisierungen viel grundsätzlicherer Antriebe sind, über die wir so wenig wissen wie jene ersten Lebewesen, die hinaus aus dem Wasser aufs Land traten, über die ihren. Wenige Seiten später spricht Rushdie von der Grenze zwischen USA und Mexiko, von der Wut, mit der die USA sie verteidigen und von der beharrlichen Ausdauer, mit der sie von Mexikanern überschritten wird. Der Umschlag der amerikanischen Ausgabe zeigt einen rennenden Mann, der versucht, sie zu überqueren, während ein Auto auf ihn zurast. Die englische Ausgabe zeigt einen Bleistift, der in Wahrheit ein Zündholz ist. Den amerikanischen Umschlag mag man als eine einfache Illustration des Buchtitels "Step across this line" auffassen, aber das Photo ist von Sebastiao Salgado, also an Eindrücklichkeit nicht zu übertreffen. Alles andere als eine Illustration. Der englische Umschlag dagegen ist ein kunstgewerbliches Geblinzel unter Kennern. Peinlich. Ein Autor, der auf dem Umschlag seines Buches behauptet, mit etwas so Unschuldigem wie einem Buch ein wenig gezündelt zu haben.
Rushdie ist mit Urdu aufgewachsen. Nicht nur in dem Sinne, dass seine Eltern es mit ihm gesprochen haben, sondern auch der erste Dichter, den er kennenlernte, war ein Urdu-Dichter, Faiz Ahmed Faiz, ein Freund einer seiner Tanten. Der Autor bekam Ärger mit seinen muslimischen Glaubensgenossen und Rushdies Tante musste ihn eine Zeitlang vor dem gar zu glaubensfanatischen Mob verstecken. Keine Geschichte ist die erste Geschichte. Die Teilung Indiens in Pakistan und Indien teilte auch die Familie Rushdies. Die einen lebten in Bombay, die anderen in Karachi. Mit den Jahren entwickelten sich nicht nur die Länder in ganz unterschiedliche Richtungen, auch die beiden Städte wurden immer gegensätzlicher. Bombay wurde zu einer der schillerndsten, wildesten Städte der Welt, Karachi erstickte an seiner Strenge und am Militär. Man weiß, dass das nicht nur Ergebnis der religiösen Unterschiede war, sondern auch das Resultat einer bewusst betriebenen Politik. Francis Fukuyama zum Beispiel hatte sich, lange vor dem Weltruhm seines Buches vom "Ende der Geschichte", darum bemüht, Pakistan vom sowjetisch beeinflussten Indien weg zu orientieren. Pakistan sollte sich mit den streng islamischen Golfstaaten zusammentun. Das war seine Vorstellung und die seiner Auftraggeber in der amerikanischen Regierung. Die Lösungen von heute, sind die Probleme von morgen.
Salman Rushdie, "Step Across This Line, Random House", New York, 2002, 404 Seiten, 27,75 Euro. Bestellen.
Lesen
 Heiner Goebbels ist einer der bekanntesten unbekannten Komponisten unserer Zeit. Zu seinem 50. Geburtstag erschien dieses Jahr, herausgegeben von Wolfgang Sandner, ein Band mit Texten von und über Goebbels. Dazu viele Fotos von Inszenierungen, für die Goebbels die Musik komponierte. Das Buch ist an vielen Stellen gar zu sehr nur Freundesgabe. Aber es gibt andere Beiträge darin, die einen nicht nur einstimmen wollen in den Chor der Begeisterten, sondern die einem auch Augen und Ohren öffnen, die einen klüger machen. Fast alle Beiträge des Geburtstagskindes sind dieser Art. Aus seinem schönsten will ich zitieren: "Bei der Arbeit an dem szenischen Konzert 'Der Mann im Fahrstuhl' zum Beispiel wurde ich, erst als die englische Übersetzung dieses Heiner-Müller-Textes kopfüber vor mir auf dem Schreibtisch lag, auf die vielen großen 'I' aufmerksam ('Ich' als Satzanfang), die im kleingeschriebenen englischen Schriftbild auf besondere Weise herausfielen. Das hat mich dazu angeregt, in meiner Komposition diese charakteristischen Satzanfänge auch musikalisch sequenziert hervorzuheben. Im deutschen Original war mein Blick auf diese augenfällige Reihung durch die erzählte Geschichte zu verstellt gewesen."
Heiner Goebbels ist einer der bekanntesten unbekannten Komponisten unserer Zeit. Zu seinem 50. Geburtstag erschien dieses Jahr, herausgegeben von Wolfgang Sandner, ein Band mit Texten von und über Goebbels. Dazu viele Fotos von Inszenierungen, für die Goebbels die Musik komponierte. Das Buch ist an vielen Stellen gar zu sehr nur Freundesgabe. Aber es gibt andere Beiträge darin, die einen nicht nur einstimmen wollen in den Chor der Begeisterten, sondern die einem auch Augen und Ohren öffnen, die einen klüger machen. Fast alle Beiträge des Geburtstagskindes sind dieser Art. Aus seinem schönsten will ich zitieren: "Bei der Arbeit an dem szenischen Konzert 'Der Mann im Fahrstuhl' zum Beispiel wurde ich, erst als die englische Übersetzung dieses Heiner-Müller-Textes kopfüber vor mir auf dem Schreibtisch lag, auf die vielen großen 'I' aufmerksam ('Ich' als Satzanfang), die im kleingeschriebenen englischen Schriftbild auf besondere Weise herausfielen. Das hat mich dazu angeregt, in meiner Komposition diese charakteristischen Satzanfänge auch musikalisch sequenziert hervorzuheben. Im deutschen Original war mein Blick auf diese augenfällige Reihung durch die erzählte Geschichte zu verstellt gewesen."
Heiner Goebbels erzählt diese Geschichte ganz nebenbei, aber er ist sich ihrer Tragweite sehr bewusst. Der Inhalt versperrt den Blick nicht etwa auf die Form, sondern auch auf sich selbst. Das 'I' ist ja nicht einfach ein Buchstabe, sondern das 'Ich' der Geschichte, also ihr Zentrum. Goebbels' Beispiel zeigt, wie Abstraktion mitten in den Kern der Sache führt. So dialektisch geht es auch in seiner Musik zu.
Wolfgang Sandner: "Heiner Goebbels - Komposition als Inszenierung", Henschel Verlag 2002, 240 Seiten, 29,90 Euro. Bestellen.
Arbeit
 Er ist heute einer bedeutendsten Sinologen. Aber er studierte nicht chinesisch, weil er in den Osten verliebt war, weil er fasziniert war von der chinesischen Geschichte, sondern weil er wissen wollte, was Europa ist und um das zu begreifen, bedurfte es eines - so war seine Überlegung - starken Kontrastmittels, eines Gesellschaftsentwurfs also, der nichts mit Europa zu tun hatte, bei dem keine gegenseitigen Einflüsse vorlagen. Auf deutsch liegen inzwischen fünf Veröffentlichungen des 1951 geborenen Francois Jullien vor. Sie sind alle lesenswert. Vor allem die Abhandlung "Über das Fade - eine Eloge". Wer sich schnell einen Einblick in Julliens Denken verschaffen, wer nachvollziehen möchte, was ihn reizt an der chinesischen Welt, für den sind die unter dem Titel "Der Umweg über China" erschienenen Texte von, mit und über ihn die richtige Einstiegsdroge.
Er ist heute einer bedeutendsten Sinologen. Aber er studierte nicht chinesisch, weil er in den Osten verliebt war, weil er fasziniert war von der chinesischen Geschichte, sondern weil er wissen wollte, was Europa ist und um das zu begreifen, bedurfte es eines - so war seine Überlegung - starken Kontrastmittels, eines Gesellschaftsentwurfs also, der nichts mit Europa zu tun hatte, bei dem keine gegenseitigen Einflüsse vorlagen. Auf deutsch liegen inzwischen fünf Veröffentlichungen des 1951 geborenen Francois Jullien vor. Sie sind alle lesenswert. Vor allem die Abhandlung "Über das Fade - eine Eloge". Wer sich schnell einen Einblick in Julliens Denken verschaffen, wer nachvollziehen möchte, was ihn reizt an der chinesischen Welt, für den sind die unter dem Titel "Der Umweg über China" erschienenen Texte von, mit und über ihn die richtige Einstiegsdroge.
Er mag die Geschichten, mittels derer in China philosophiert wird und eine seiner Lieblingsgeschichten stammt von Menzius: "Ein Bauer aus Song kommt abends müde heim und sagt zu seinen Kindern: 'Heute habe ich gut gearbeitet, ich habe alle Schößlinge meines Feldes in die Höhe gezogen.' Daraufhin laufen die Kinder zum Feld, um das Ergebnis zu sehen, und entdecken natürlich ein verwüstetes Feld, auf dem alle Schößlinge dabei sind zu vertrocknen. Und Menzius zieht daraus den Schluss: Es gibt zwei Irrtümer in der Welt, der eine besteht darin, die Wirkung (zheng) unmittelbar erzielen zu wollen, als ob die Wirksamkeit nur eine Frage des Zielens und des Willens wäre - eine Frage sowohl des Projekts, der Mittel und der Anstrengung; der andere besteht darin, nichts zu tun und sein Feld zu vernachlässigen. Aber wenn man weder direkt an den Schößlingen ziehen darf, noch darauf verzichten darf, einzugreifen, was muss man dann laut Menzius tun? Jeder Bauer weiß das: Man muss am Fuß der Pflanze hacken und jäten. Das scheint unbedeutend zu sein, aber man berührt hier einen der subtilsten Züge des chinesischen Denkens: Wie es ihm gelungen ist, das Künstliche und das Natürliche so zu verbinden, dass sie übereinstimmen; oder wie man dem, was ohnehin von selbst kommt, nachhelfen soll." Wer weiterliest, der begreift, dass es nicht nur um das Künstliche und das Natürliche geht. Es geht darum, dass Denken und Handeln stets ihre Bedingungen mitreflektieren müssen, sonst werden nicht nur die Felder verwüstet.
Francois Jullien, "Der Umweg über China - Ein Ortswechsel des Denkens", übersetzt von Mira Köller, Merve-Verlag, 2002, 194 Seiten, 13,60 Euro. Bestellen.
Tricks
 Tom Tykwer ist klug. Ich bin dumm genug, das erst bei der Lektüre seiner Gespräche mit Michael Ballhaus gemerkt zu haben. Wenn der Kameramann Ballhaus zum Beispiel über seine Arbeit mit Meryl Streep in "Postcards from the Edge" sagt: "Sie hatte damals so viel Macht, dass sie entscheiden konnte, welche Takes man genommen hat und welche nicht. Wenn sie nicht gut aussah, dann war natürlich ich der Buhmann. Sie hat sich praktisch selbst inszeniert." Dann nickt Tom Tykwer nicht und gibt ein paar seiner Erfahrungen mit dominierenden Frauen weiter, sondern er meint: "Das ist insofern interessant, als sie genau diese Rolle auch im Film selbst spielt. Vielleicht hat Meryl Streep Sie dazu benutzt, konstanter in ihrer Rolle zu bleiben." Da spricht der Regisseur, einer, der weiß, wieviel Arbeit es Schauspieler kostet, für die paar Sekunden eines Takes, einer Einstellung, genau jenen Ausdruck zu bringen, der in jenem Augenblick nötig ist für den Film, der ja erst am Schneidetisch einer wird.
Tom Tykwer ist klug. Ich bin dumm genug, das erst bei der Lektüre seiner Gespräche mit Michael Ballhaus gemerkt zu haben. Wenn der Kameramann Ballhaus zum Beispiel über seine Arbeit mit Meryl Streep in "Postcards from the Edge" sagt: "Sie hatte damals so viel Macht, dass sie entscheiden konnte, welche Takes man genommen hat und welche nicht. Wenn sie nicht gut aussah, dann war natürlich ich der Buhmann. Sie hat sich praktisch selbst inszeniert." Dann nickt Tom Tykwer nicht und gibt ein paar seiner Erfahrungen mit dominierenden Frauen weiter, sondern er meint: "Das ist insofern interessant, als sie genau diese Rolle auch im Film selbst spielt. Vielleicht hat Meryl Streep Sie dazu benutzt, konstanter in ihrer Rolle zu bleiben." Da spricht der Regisseur, einer, der weiß, wieviel Arbeit es Schauspieler kostet, für die paar Sekunden eines Takes, einer Einstellung, genau jenen Ausdruck zu bringen, der in jenem Augenblick nötig ist für den Film, der ja erst am Schneidetisch einer wird.
Die Gespräche zwischen Michael Ballhaus und Tom Tykwer stecken voller solcher kleinen Beobachtungen. Beide lieben Details und wir, die Leser, haben den Nutzen davon. In den "Fabulous Baker Boys" gibt es eine nächtliche Fensterszene mit Michelle Pfeiffer und Jeff Bridges, da sieht man hinter dem Paar den funkelnden Sternenhimmel. "Wie haben Sie's gemacht?" fragt Tykwer und Ballhaus klärt ihn und uns auf: "Wir haben einen klassischen Studiosternenhimmel mit kleinen Birnchen als Sternen dekoriert, dann aber eine schwarze Gaze davor gehängt und langsam bewegt, dadurch verändert sich natürlich das durchfallende Licht, und so hat man das Gefühl von funkelnden Sternen." Der Band hat viele sehr schöner Fotos. Meine Lieblingsaufnahme findet sich auf Seite 103. Acht Menschen sind drauf. Es ist Dunkel, die Straße ist nass. Scorsese - das Foto entstand bei den Dreharbeiten zu "After Hours" - sitzt am rechten Rand mit zusammengepressten Oberschenkeln - eine Hand wärmend dazwischen geschoben - auf einem Höckerchen. Michael Ballhaus spricht mit ihm, die anderen schauen zu den beiden, bis auf einen Mann und eine Frau, die auf dem Boden knien und versuchen einen Geldschein so hinzulegen, dass die Kamera ihn optimal erfasst. Man bekommt eine Ahnung, dass Kino die Oper des zwanzigsten Jahrhunderts war, also der Versuch, eine ganze Industrie einzusetzen, um Kunst zu produzieren. Michael Ballhaus erzählt von seiner Arbeit an Fassbinders "Martha", an Paul Newmans "The Glass Menagerie", an Coppolas "Bram Stoker's Dracula" und den Scorsese-Filmen "The Color of Money", "The Age of Innocence" und "The Gangs of New York". Es ist nicht zuletzt dank der Fragearbeit Tom Tykwers eines der schönsten Filmbücher der letzten Jahre geworden.
Beim Lektorat wäre ein ruhigeres Auge erforderlich gewesen. Dann hätte Michael Ballhaus nicht erzählt, wie seine Westberliner Studenten 1968 eine rote Fahne vom Roten Rathaus heruntergerollt hatten. Das wäre eine wirkliche Weltsensation gewesen. Aber so war es nur das Schöneberger Rathaus. Peinlich für ein Buch aus dem "Berlin-Verlag".
"Das fliegende Auge - Michael Ballhaus, Director of Photography, im Gespräch mit Tom Tykwer", bearbeitet von Thomas Binotto, Berlin Verlag, 262 Seiten, über 300 s/w und farbige Aufnahmen, 22 Euro. Bestellen.
Der persische Stil
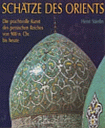 Der 1928 in Alexandria geborene Henri Stierlin ist Autor zahlreicher prächtiger Bildbände zur Architektur- und Kunstgeschichte. Sein neuestes Buch "Schätze des Orients" versucht eine These zu entwickeln und zu belegen, dass nämlich in der gesamten islamischen Welt vom 10. bis zum frühen 19. Jahrhundert ein Stil geherrscht haben soll, den Stierlin den "persischen" nennt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ganz unabhängig davon, blättert man die mehr als 300 Seiten gerne durch. Die Aufnahmen aus Isfahan und Fatehpur Sikri, aus Delhi und Samarkand sind so großartig, dass man bedauert, mit dem Buch allein zu sein. Man würde diese Pracht gerne jemandem zeigen. Da ist zum Beispiel die Innenansicht des Saals für Privataudienzen, "Diwan-I Khas", im indischen Fatehpur Sikri. In diesem Raum fanden in den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts Talk-Shows statt, bei denen Vertreter verschiedener Religionen miteinander diskutierten. Unter der Kuppel gibt es eine Galerie, von der aus diagonale Stege zu einer zentralen Plattform führten, auf der Akbar der Große zu stehen pflegte, um von dort aus den Auseinandersetzungen zuzuhören. Stierlin hat diesen Raum so fotografiert, dass seine Intimität auf der einen, seine Weltoffenheit - die großen, offenen, aber überdachten Fenster - deutlich wird. Die Aufklärung geht auch in der islamischen Welt viele Umwege. Das Blau und Grün der Moscheen und Paläste Samarkands, Isfahans und Bucharas hat Stierlin so verführerisch eingefangen, dass die Reiselust in einem erwacht. Man wünscht sich, diese Pracht selbst zu sehen. Sekundenlang wächst Sehnsucht in einem.
Der 1928 in Alexandria geborene Henri Stierlin ist Autor zahlreicher prächtiger Bildbände zur Architektur- und Kunstgeschichte. Sein neuestes Buch "Schätze des Orients" versucht eine These zu entwickeln und zu belegen, dass nämlich in der gesamten islamischen Welt vom 10. bis zum frühen 19. Jahrhundert ein Stil geherrscht haben soll, den Stierlin den "persischen" nennt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ganz unabhängig davon, blättert man die mehr als 300 Seiten gerne durch. Die Aufnahmen aus Isfahan und Fatehpur Sikri, aus Delhi und Samarkand sind so großartig, dass man bedauert, mit dem Buch allein zu sein. Man würde diese Pracht gerne jemandem zeigen. Da ist zum Beispiel die Innenansicht des Saals für Privataudienzen, "Diwan-I Khas", im indischen Fatehpur Sikri. In diesem Raum fanden in den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts Talk-Shows statt, bei denen Vertreter verschiedener Religionen miteinander diskutierten. Unter der Kuppel gibt es eine Galerie, von der aus diagonale Stege zu einer zentralen Plattform führten, auf der Akbar der Große zu stehen pflegte, um von dort aus den Auseinandersetzungen zuzuhören. Stierlin hat diesen Raum so fotografiert, dass seine Intimität auf der einen, seine Weltoffenheit - die großen, offenen, aber überdachten Fenster - deutlich wird. Die Aufklärung geht auch in der islamischen Welt viele Umwege. Das Blau und Grün der Moscheen und Paläste Samarkands, Isfahans und Bucharas hat Stierlin so verführerisch eingefangen, dass die Reiselust in einem erwacht. Man wünscht sich, diese Pracht selbst zu sehen. Sekundenlang wächst Sehnsucht in einem.
Dann macht man sich klar: So schön wie Stierlin die Bauwerke fotografiert hat, so schön sieht man sie nicht. Er sucht sich das Licht aus, in dem sie am blendendsten glänzen. Er hat die Objektive, um ein Ornament hoch in der Kuppel herunterzuzoomen und es uns sichtbar zu machen, wie nach den Handwerkern vor hunderten von Jahren es niemand mehr gesehen hat. Die Fotografie ist eine lügenmächtige, gewaltige Verführerin. Aber sie erfindet nicht. Sie organisiert nur. Wie aus Steinkanten bei richtiger Beleuchtung ein berückendes Ornament entsteht, das kann man hier sehen. Henri Stierlin sieht und macht sichtbar. Das ist seine Kunst. Vielleicht ist auch das "persischer Stil".
Henri Stierlin, "Schätze des Orients - Die prachtvolle Kunst des persischen Reiches von 900 n. Chr. bis heute", 320 Seiten, mit zahlreichen farbigen Abbildungen, im Schuber, übersetzt von Werner Kügler, Verlag Frederking & Thaler, 70 Euro. Bestellen.
 Salman Rushdie ist ein phantastischer Erzähler und einer der besten lebenden Essayisten. "Step across this line" (Auszug) sammelt seine Aufsätze der vergangenen zehn Jahre. Der Titelessay ist ein Vortrag, den er im vergangenen Februar in Yale gehalten hat. Rushdie, der einige Erfahrungen hat, was Grenzüberschreitungen angeht, beginnt, begeisterter Mythenerzähler, der er ist, mit dem Augenblick, da ein Lebewesen den Ozean verließ, diese Grenze überschritt und entdeckte, dass es auf dem Land atmen konnte. Vor diesem Lebewesen muss es andere gegeben haben, die wieder zurücksprangen in ihr Element und viele, viele andere, die erstickten inmitten der Luft. Sie wussten nicht, wie ihr der Sauerstoff zu entnehmen war. Es gab vielleicht Millionen dieser in keiner Chronik aufgezeichneten Tode. Dann endlich versuchte es wieder einer, und der schaffte es. Warum tat er es? Warum schreckten ihn nicht die Spuren der Gescheiterten?
Salman Rushdie ist ein phantastischer Erzähler und einer der besten lebenden Essayisten. "Step across this line" (Auszug) sammelt seine Aufsätze der vergangenen zehn Jahre. Der Titelessay ist ein Vortrag, den er im vergangenen Februar in Yale gehalten hat. Rushdie, der einige Erfahrungen hat, was Grenzüberschreitungen angeht, beginnt, begeisterter Mythenerzähler, der er ist, mit dem Augenblick, da ein Lebewesen den Ozean verließ, diese Grenze überschritt und entdeckte, dass es auf dem Land atmen konnte. Vor diesem Lebewesen muss es andere gegeben haben, die wieder zurücksprangen in ihr Element und viele, viele andere, die erstickten inmitten der Luft. Sie wussten nicht, wie ihr der Sauerstoff zu entnehmen war. Es gab vielleicht Millionen dieser in keiner Chronik aufgezeichneten Tode. Dann endlich versuchte es wieder einer, und der schaffte es. Warum tat er es? Warum schreckten ihn nicht die Spuren der Gescheiterten?Salman Rushdie stellt diese Fragen, und natürlich mokiert er sich über sie. Er weiß, dass diese frühen Wesen kein Motiv hatten, das Wasser zu verlassen. Das Wasser missfiel ihnen nicht. Sie trieb keine Sehnsucht in ein Land Utopia. Rushdie weiß aber auch, und genau darauf will er uns hinweisen, dass die Motive, denen wir zu folgen glauben, Rationalisierungen viel grundsätzlicherer Antriebe sind, über die wir so wenig wissen wie jene ersten Lebewesen, die hinaus aus dem Wasser aufs Land traten, über die ihren. Wenige Seiten später spricht Rushdie von der Grenze zwischen USA und Mexiko, von der Wut, mit der die USA sie verteidigen und von der beharrlichen Ausdauer, mit der sie von Mexikanern überschritten wird. Der Umschlag der amerikanischen Ausgabe zeigt einen rennenden Mann, der versucht, sie zu überqueren, während ein Auto auf ihn zurast. Die englische Ausgabe zeigt einen Bleistift, der in Wahrheit ein Zündholz ist. Den amerikanischen Umschlag mag man als eine einfache Illustration des Buchtitels "Step across this line" auffassen, aber das Photo ist von Sebastiao Salgado, also an Eindrücklichkeit nicht zu übertreffen. Alles andere als eine Illustration. Der englische Umschlag dagegen ist ein kunstgewerbliches Geblinzel unter Kennern. Peinlich. Ein Autor, der auf dem Umschlag seines Buches behauptet, mit etwas so Unschuldigem wie einem Buch ein wenig gezündelt zu haben.
Rushdie ist mit Urdu aufgewachsen. Nicht nur in dem Sinne, dass seine Eltern es mit ihm gesprochen haben, sondern auch der erste Dichter, den er kennenlernte, war ein Urdu-Dichter, Faiz Ahmed Faiz, ein Freund einer seiner Tanten. Der Autor bekam Ärger mit seinen muslimischen Glaubensgenossen und Rushdies Tante musste ihn eine Zeitlang vor dem gar zu glaubensfanatischen Mob verstecken. Keine Geschichte ist die erste Geschichte. Die Teilung Indiens in Pakistan und Indien teilte auch die Familie Rushdies. Die einen lebten in Bombay, die anderen in Karachi. Mit den Jahren entwickelten sich nicht nur die Länder in ganz unterschiedliche Richtungen, auch die beiden Städte wurden immer gegensätzlicher. Bombay wurde zu einer der schillerndsten, wildesten Städte der Welt, Karachi erstickte an seiner Strenge und am Militär. Man weiß, dass das nicht nur Ergebnis der religiösen Unterschiede war, sondern auch das Resultat einer bewusst betriebenen Politik. Francis Fukuyama zum Beispiel hatte sich, lange vor dem Weltruhm seines Buches vom "Ende der Geschichte", darum bemüht, Pakistan vom sowjetisch beeinflussten Indien weg zu orientieren. Pakistan sollte sich mit den streng islamischen Golfstaaten zusammentun. Das war seine Vorstellung und die seiner Auftraggeber in der amerikanischen Regierung. Die Lösungen von heute, sind die Probleme von morgen.
Salman Rushdie, "Step Across This Line, Random House", New York, 2002, 404 Seiten, 27,75 Euro. Bestellen.
Lesen
 Heiner Goebbels ist einer der bekanntesten unbekannten Komponisten unserer Zeit. Zu seinem 50. Geburtstag erschien dieses Jahr, herausgegeben von Wolfgang Sandner, ein Band mit Texten von und über Goebbels. Dazu viele Fotos von Inszenierungen, für die Goebbels die Musik komponierte. Das Buch ist an vielen Stellen gar zu sehr nur Freundesgabe. Aber es gibt andere Beiträge darin, die einen nicht nur einstimmen wollen in den Chor der Begeisterten, sondern die einem auch Augen und Ohren öffnen, die einen klüger machen. Fast alle Beiträge des Geburtstagskindes sind dieser Art. Aus seinem schönsten will ich zitieren: "Bei der Arbeit an dem szenischen Konzert 'Der Mann im Fahrstuhl' zum Beispiel wurde ich, erst als die englische Übersetzung dieses Heiner-Müller-Textes kopfüber vor mir auf dem Schreibtisch lag, auf die vielen großen 'I' aufmerksam ('Ich' als Satzanfang), die im kleingeschriebenen englischen Schriftbild auf besondere Weise herausfielen. Das hat mich dazu angeregt, in meiner Komposition diese charakteristischen Satzanfänge auch musikalisch sequenziert hervorzuheben. Im deutschen Original war mein Blick auf diese augenfällige Reihung durch die erzählte Geschichte zu verstellt gewesen."
Heiner Goebbels ist einer der bekanntesten unbekannten Komponisten unserer Zeit. Zu seinem 50. Geburtstag erschien dieses Jahr, herausgegeben von Wolfgang Sandner, ein Band mit Texten von und über Goebbels. Dazu viele Fotos von Inszenierungen, für die Goebbels die Musik komponierte. Das Buch ist an vielen Stellen gar zu sehr nur Freundesgabe. Aber es gibt andere Beiträge darin, die einen nicht nur einstimmen wollen in den Chor der Begeisterten, sondern die einem auch Augen und Ohren öffnen, die einen klüger machen. Fast alle Beiträge des Geburtstagskindes sind dieser Art. Aus seinem schönsten will ich zitieren: "Bei der Arbeit an dem szenischen Konzert 'Der Mann im Fahrstuhl' zum Beispiel wurde ich, erst als die englische Übersetzung dieses Heiner-Müller-Textes kopfüber vor mir auf dem Schreibtisch lag, auf die vielen großen 'I' aufmerksam ('Ich' als Satzanfang), die im kleingeschriebenen englischen Schriftbild auf besondere Weise herausfielen. Das hat mich dazu angeregt, in meiner Komposition diese charakteristischen Satzanfänge auch musikalisch sequenziert hervorzuheben. Im deutschen Original war mein Blick auf diese augenfällige Reihung durch die erzählte Geschichte zu verstellt gewesen."Heiner Goebbels erzählt diese Geschichte ganz nebenbei, aber er ist sich ihrer Tragweite sehr bewusst. Der Inhalt versperrt den Blick nicht etwa auf die Form, sondern auch auf sich selbst. Das 'I' ist ja nicht einfach ein Buchstabe, sondern das 'Ich' der Geschichte, also ihr Zentrum. Goebbels' Beispiel zeigt, wie Abstraktion mitten in den Kern der Sache führt. So dialektisch geht es auch in seiner Musik zu.
Wolfgang Sandner: "Heiner Goebbels - Komposition als Inszenierung", Henschel Verlag 2002, 240 Seiten, 29,90 Euro. Bestellen.
Arbeit
 Er ist heute einer bedeutendsten Sinologen. Aber er studierte nicht chinesisch, weil er in den Osten verliebt war, weil er fasziniert war von der chinesischen Geschichte, sondern weil er wissen wollte, was Europa ist und um das zu begreifen, bedurfte es eines - so war seine Überlegung - starken Kontrastmittels, eines Gesellschaftsentwurfs also, der nichts mit Europa zu tun hatte, bei dem keine gegenseitigen Einflüsse vorlagen. Auf deutsch liegen inzwischen fünf Veröffentlichungen des 1951 geborenen Francois Jullien vor. Sie sind alle lesenswert. Vor allem die Abhandlung "Über das Fade - eine Eloge". Wer sich schnell einen Einblick in Julliens Denken verschaffen, wer nachvollziehen möchte, was ihn reizt an der chinesischen Welt, für den sind die unter dem Titel "Der Umweg über China" erschienenen Texte von, mit und über ihn die richtige Einstiegsdroge.
Er ist heute einer bedeutendsten Sinologen. Aber er studierte nicht chinesisch, weil er in den Osten verliebt war, weil er fasziniert war von der chinesischen Geschichte, sondern weil er wissen wollte, was Europa ist und um das zu begreifen, bedurfte es eines - so war seine Überlegung - starken Kontrastmittels, eines Gesellschaftsentwurfs also, der nichts mit Europa zu tun hatte, bei dem keine gegenseitigen Einflüsse vorlagen. Auf deutsch liegen inzwischen fünf Veröffentlichungen des 1951 geborenen Francois Jullien vor. Sie sind alle lesenswert. Vor allem die Abhandlung "Über das Fade - eine Eloge". Wer sich schnell einen Einblick in Julliens Denken verschaffen, wer nachvollziehen möchte, was ihn reizt an der chinesischen Welt, für den sind die unter dem Titel "Der Umweg über China" erschienenen Texte von, mit und über ihn die richtige Einstiegsdroge.Er mag die Geschichten, mittels derer in China philosophiert wird und eine seiner Lieblingsgeschichten stammt von Menzius: "Ein Bauer aus Song kommt abends müde heim und sagt zu seinen Kindern: 'Heute habe ich gut gearbeitet, ich habe alle Schößlinge meines Feldes in die Höhe gezogen.' Daraufhin laufen die Kinder zum Feld, um das Ergebnis zu sehen, und entdecken natürlich ein verwüstetes Feld, auf dem alle Schößlinge dabei sind zu vertrocknen. Und Menzius zieht daraus den Schluss: Es gibt zwei Irrtümer in der Welt, der eine besteht darin, die Wirkung (zheng) unmittelbar erzielen zu wollen, als ob die Wirksamkeit nur eine Frage des Zielens und des Willens wäre - eine Frage sowohl des Projekts, der Mittel und der Anstrengung; der andere besteht darin, nichts zu tun und sein Feld zu vernachlässigen. Aber wenn man weder direkt an den Schößlingen ziehen darf, noch darauf verzichten darf, einzugreifen, was muss man dann laut Menzius tun? Jeder Bauer weiß das: Man muss am Fuß der Pflanze hacken und jäten. Das scheint unbedeutend zu sein, aber man berührt hier einen der subtilsten Züge des chinesischen Denkens: Wie es ihm gelungen ist, das Künstliche und das Natürliche so zu verbinden, dass sie übereinstimmen; oder wie man dem, was ohnehin von selbst kommt, nachhelfen soll." Wer weiterliest, der begreift, dass es nicht nur um das Künstliche und das Natürliche geht. Es geht darum, dass Denken und Handeln stets ihre Bedingungen mitreflektieren müssen, sonst werden nicht nur die Felder verwüstet.
Francois Jullien, "Der Umweg über China - Ein Ortswechsel des Denkens", übersetzt von Mira Köller, Merve-Verlag, 2002, 194 Seiten, 13,60 Euro. Bestellen.
Tricks
 Tom Tykwer ist klug. Ich bin dumm genug, das erst bei der Lektüre seiner Gespräche mit Michael Ballhaus gemerkt zu haben. Wenn der Kameramann Ballhaus zum Beispiel über seine Arbeit mit Meryl Streep in "Postcards from the Edge" sagt: "Sie hatte damals so viel Macht, dass sie entscheiden konnte, welche Takes man genommen hat und welche nicht. Wenn sie nicht gut aussah, dann war natürlich ich der Buhmann. Sie hat sich praktisch selbst inszeniert." Dann nickt Tom Tykwer nicht und gibt ein paar seiner Erfahrungen mit dominierenden Frauen weiter, sondern er meint: "Das ist insofern interessant, als sie genau diese Rolle auch im Film selbst spielt. Vielleicht hat Meryl Streep Sie dazu benutzt, konstanter in ihrer Rolle zu bleiben." Da spricht der Regisseur, einer, der weiß, wieviel Arbeit es Schauspieler kostet, für die paar Sekunden eines Takes, einer Einstellung, genau jenen Ausdruck zu bringen, der in jenem Augenblick nötig ist für den Film, der ja erst am Schneidetisch einer wird.
Tom Tykwer ist klug. Ich bin dumm genug, das erst bei der Lektüre seiner Gespräche mit Michael Ballhaus gemerkt zu haben. Wenn der Kameramann Ballhaus zum Beispiel über seine Arbeit mit Meryl Streep in "Postcards from the Edge" sagt: "Sie hatte damals so viel Macht, dass sie entscheiden konnte, welche Takes man genommen hat und welche nicht. Wenn sie nicht gut aussah, dann war natürlich ich der Buhmann. Sie hat sich praktisch selbst inszeniert." Dann nickt Tom Tykwer nicht und gibt ein paar seiner Erfahrungen mit dominierenden Frauen weiter, sondern er meint: "Das ist insofern interessant, als sie genau diese Rolle auch im Film selbst spielt. Vielleicht hat Meryl Streep Sie dazu benutzt, konstanter in ihrer Rolle zu bleiben." Da spricht der Regisseur, einer, der weiß, wieviel Arbeit es Schauspieler kostet, für die paar Sekunden eines Takes, einer Einstellung, genau jenen Ausdruck zu bringen, der in jenem Augenblick nötig ist für den Film, der ja erst am Schneidetisch einer wird.Die Gespräche zwischen Michael Ballhaus und Tom Tykwer stecken voller solcher kleinen Beobachtungen. Beide lieben Details und wir, die Leser, haben den Nutzen davon. In den "Fabulous Baker Boys" gibt es eine nächtliche Fensterszene mit Michelle Pfeiffer und Jeff Bridges, da sieht man hinter dem Paar den funkelnden Sternenhimmel. "Wie haben Sie's gemacht?" fragt Tykwer und Ballhaus klärt ihn und uns auf: "Wir haben einen klassischen Studiosternenhimmel mit kleinen Birnchen als Sternen dekoriert, dann aber eine schwarze Gaze davor gehängt und langsam bewegt, dadurch verändert sich natürlich das durchfallende Licht, und so hat man das Gefühl von funkelnden Sternen." Der Band hat viele sehr schöner Fotos. Meine Lieblingsaufnahme findet sich auf Seite 103. Acht Menschen sind drauf. Es ist Dunkel, die Straße ist nass. Scorsese - das Foto entstand bei den Dreharbeiten zu "After Hours" - sitzt am rechten Rand mit zusammengepressten Oberschenkeln - eine Hand wärmend dazwischen geschoben - auf einem Höckerchen. Michael Ballhaus spricht mit ihm, die anderen schauen zu den beiden, bis auf einen Mann und eine Frau, die auf dem Boden knien und versuchen einen Geldschein so hinzulegen, dass die Kamera ihn optimal erfasst. Man bekommt eine Ahnung, dass Kino die Oper des zwanzigsten Jahrhunderts war, also der Versuch, eine ganze Industrie einzusetzen, um Kunst zu produzieren. Michael Ballhaus erzählt von seiner Arbeit an Fassbinders "Martha", an Paul Newmans "The Glass Menagerie", an Coppolas "Bram Stoker's Dracula" und den Scorsese-Filmen "The Color of Money", "The Age of Innocence" und "The Gangs of New York". Es ist nicht zuletzt dank der Fragearbeit Tom Tykwers eines der schönsten Filmbücher der letzten Jahre geworden.
Beim Lektorat wäre ein ruhigeres Auge erforderlich gewesen. Dann hätte Michael Ballhaus nicht erzählt, wie seine Westberliner Studenten 1968 eine rote Fahne vom Roten Rathaus heruntergerollt hatten. Das wäre eine wirkliche Weltsensation gewesen. Aber so war es nur das Schöneberger Rathaus. Peinlich für ein Buch aus dem "Berlin-Verlag".
"Das fliegende Auge - Michael Ballhaus, Director of Photography, im Gespräch mit Tom Tykwer", bearbeitet von Thomas Binotto, Berlin Verlag, 262 Seiten, über 300 s/w und farbige Aufnahmen, 22 Euro. Bestellen.
Der persische Stil
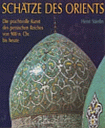 Der 1928 in Alexandria geborene Henri Stierlin ist Autor zahlreicher prächtiger Bildbände zur Architektur- und Kunstgeschichte. Sein neuestes Buch "Schätze des Orients" versucht eine These zu entwickeln und zu belegen, dass nämlich in der gesamten islamischen Welt vom 10. bis zum frühen 19. Jahrhundert ein Stil geherrscht haben soll, den Stierlin den "persischen" nennt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ganz unabhängig davon, blättert man die mehr als 300 Seiten gerne durch. Die Aufnahmen aus Isfahan und Fatehpur Sikri, aus Delhi und Samarkand sind so großartig, dass man bedauert, mit dem Buch allein zu sein. Man würde diese Pracht gerne jemandem zeigen. Da ist zum Beispiel die Innenansicht des Saals für Privataudienzen, "Diwan-I Khas", im indischen Fatehpur Sikri. In diesem Raum fanden in den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts Talk-Shows statt, bei denen Vertreter verschiedener Religionen miteinander diskutierten. Unter der Kuppel gibt es eine Galerie, von der aus diagonale Stege zu einer zentralen Plattform führten, auf der Akbar der Große zu stehen pflegte, um von dort aus den Auseinandersetzungen zuzuhören. Stierlin hat diesen Raum so fotografiert, dass seine Intimität auf der einen, seine Weltoffenheit - die großen, offenen, aber überdachten Fenster - deutlich wird. Die Aufklärung geht auch in der islamischen Welt viele Umwege. Das Blau und Grün der Moscheen und Paläste Samarkands, Isfahans und Bucharas hat Stierlin so verführerisch eingefangen, dass die Reiselust in einem erwacht. Man wünscht sich, diese Pracht selbst zu sehen. Sekundenlang wächst Sehnsucht in einem.
Der 1928 in Alexandria geborene Henri Stierlin ist Autor zahlreicher prächtiger Bildbände zur Architektur- und Kunstgeschichte. Sein neuestes Buch "Schätze des Orients" versucht eine These zu entwickeln und zu belegen, dass nämlich in der gesamten islamischen Welt vom 10. bis zum frühen 19. Jahrhundert ein Stil geherrscht haben soll, den Stierlin den "persischen" nennt. Ob das stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Aber ganz unabhängig davon, blättert man die mehr als 300 Seiten gerne durch. Die Aufnahmen aus Isfahan und Fatehpur Sikri, aus Delhi und Samarkand sind so großartig, dass man bedauert, mit dem Buch allein zu sein. Man würde diese Pracht gerne jemandem zeigen. Da ist zum Beispiel die Innenansicht des Saals für Privataudienzen, "Diwan-I Khas", im indischen Fatehpur Sikri. In diesem Raum fanden in den siebziger Jahren des 16. Jahrhunderts Talk-Shows statt, bei denen Vertreter verschiedener Religionen miteinander diskutierten. Unter der Kuppel gibt es eine Galerie, von der aus diagonale Stege zu einer zentralen Plattform führten, auf der Akbar der Große zu stehen pflegte, um von dort aus den Auseinandersetzungen zuzuhören. Stierlin hat diesen Raum so fotografiert, dass seine Intimität auf der einen, seine Weltoffenheit - die großen, offenen, aber überdachten Fenster - deutlich wird. Die Aufklärung geht auch in der islamischen Welt viele Umwege. Das Blau und Grün der Moscheen und Paläste Samarkands, Isfahans und Bucharas hat Stierlin so verführerisch eingefangen, dass die Reiselust in einem erwacht. Man wünscht sich, diese Pracht selbst zu sehen. Sekundenlang wächst Sehnsucht in einem.Dann macht man sich klar: So schön wie Stierlin die Bauwerke fotografiert hat, so schön sieht man sie nicht. Er sucht sich das Licht aus, in dem sie am blendendsten glänzen. Er hat die Objektive, um ein Ornament hoch in der Kuppel herunterzuzoomen und es uns sichtbar zu machen, wie nach den Handwerkern vor hunderten von Jahren es niemand mehr gesehen hat. Die Fotografie ist eine lügenmächtige, gewaltige Verführerin. Aber sie erfindet nicht. Sie organisiert nur. Wie aus Steinkanten bei richtiger Beleuchtung ein berückendes Ornament entsteht, das kann man hier sehen. Henri Stierlin sieht und macht sichtbar. Das ist seine Kunst. Vielleicht ist auch das "persischer Stil".
Henri Stierlin, "Schätze des Orients - Die prachtvolle Kunst des persischen Reiches von 900 n. Chr. bis heute", 320 Seiten, mit zahlreichen farbigen Abbildungen, im Schuber, übersetzt von Werner Kügler, Verlag Frederking & Thaler, 70 Euro. Bestellen.