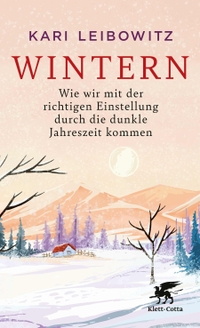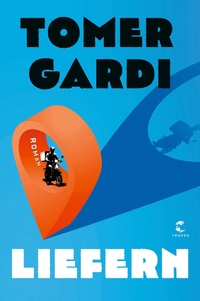Vom Nachttisch geräumt
Sprechblasen
Von Arno Widmann
14.10.2015. Die eine Schönheit sieht die andere Schönheit nicht: Giorgio Vasaris "Das Leben des Taddeo Gaddi…" Die im Verlag Klaus Wagenbach erscheinende deutsche Ausgabe der "Lebensbeschreibungen der berühmten Maler, Bildhauer und Architekten" des Malers und Schriftstellers Giorgio Vasari (1511-1574) ist ein monumentales Vergnügen nicht nur für Leser, sondern auch für Genießer, für Menschen also, die in einem Buch sich erst einmal die Bilder anschauen. Die von einem Team um den Direktor des Deutschen Kunsthistorischen Institutes in Florenz Alessandro Nova betreute Ausgabe bringt nicht nur die Texte Vasaris, nicht nur Erläuterungen dazu, sondern erklärt auch, was die heutige Forschung über die von Vasari vor 450 Jahren beschriebenen Künstler herausbekommen hat. Dazu werden - soweit möglich - alle von Vasari erwähnten Kunstwerke gezeigt. Es gibt weltweit keine bessere Ausgabe von Vasaris Klassiker. Im September wird sie abgeschlossen sein. 45 broschierte Bände und ein Supplementband mit insgesamt 8800 Seiten. Bis zum 31.12. 2015 gilt ein Subskriptionspreis von 598 Euro
Die im Verlag Klaus Wagenbach erscheinende deutsche Ausgabe der "Lebensbeschreibungen der berühmten Maler, Bildhauer und Architekten" des Malers und Schriftstellers Giorgio Vasari (1511-1574) ist ein monumentales Vergnügen nicht nur für Leser, sondern auch für Genießer, für Menschen also, die in einem Buch sich erst einmal die Bilder anschauen. Die von einem Team um den Direktor des Deutschen Kunsthistorischen Institutes in Florenz Alessandro Nova betreute Ausgabe bringt nicht nur die Texte Vasaris, nicht nur Erläuterungen dazu, sondern erklärt auch, was die heutige Forschung über die von Vasari vor 450 Jahren beschriebenen Künstler herausbekommen hat. Dazu werden - soweit möglich - alle von Vasari erwähnten Kunstwerke gezeigt. Es gibt weltweit keine bessere Ausgabe von Vasaris Klassiker. Im September wird sie abgeschlossen sein. 45 broschierte Bände und ein Supplementband mit insgesamt 8800 Seiten. Bis zum 31.12. 2015 gilt ein Subskriptionspreis von 598 Euro Jetzt sei nur auf eine Kleinigkeit in dem gerade erschienenen Band der Vasari-Ausgabe hingewiesen.
Vasari schreibt darin über den Florentiner Maler Buonamico Christofano, genannt Buffalmacco (1262 - 1340). Der Maler gehörte zu den Berühmtheiten seiner Heimatstadt. Boccaccio läßt ihn in seinem Dekameron durch Witz und Schlagfertigkeit glänzen. Vasari erzählt, dass der Maler Bruno di Giovanni, ein Kompagnon Buffalmaccos, ein großes Gemälde geschaffen hatte, auf dem der Heiligen Ursula eine große weibliche Figur gegenüber steht, die die Stadt Pisa symbolisieren sollte. Bruno di Giovanni war enttäuscht, dass seine Figuren nicht so lebendig wirkten wie die Buffalmaccos. Der lachte und machte ihm den Vorschlag, den beiden Figuren "ein paar Worte aus dem Mund kommen zu lassen". So könnten die Figuren sogar sprechen und das würde sie doch sehr lebendig machen. Die Mängel der malerischen Fähigkeiten Giovannis würden so durch Texte wettgemacht.
Vasari wettert gegen dieses Verfahren. Er erzählt diese Geschichte - erfunden oder wahr -, um denen, die ihre Bilder mit Sprechblasen verunstalten, deutlich zu machen, dass sie einem Spaßvogel auf den Leim gehen. Buffalmacco hatte die Sprechblasen nicht ernst gemeint. Er hatte sich lustig gemacht über Giovannis Unvermögen. Vasari zeigt Temperament: "Dies war eine Sache, die Bruno und den anderen Einfaltspinseln jener Zeit gefiel und genauso gefällt sie auch heute noch gewissen Grobianen, die dafür die Dienste von Künstlern in Anspruch nehmen, die ebenso vulgär sind wie sie."
So wetterten 400 Jahre nach Vasari Lehrer in der frühen Bundesrepublik gegen amerikanische Comics. Das hinderte Kinder und Jugendliche damals nicht daran, sie zu lesen, sie zu zeichnen. Sie entdeckten die Schönheit der Verbindung von Bild und Wort. Der Purist Vasari erkannte sie nicht. In der asiatischen Kunst sind textlose Bilder eher selten. Dort gab es immer wieder Maler, die auch Dichter waren, die ihre Gedichte zu Teilen ihrer Gemälde machten. Es gab auch dort, wenn ich mich nicht irre, keine Sprechblasen. Aber es gab Rollen, auf denen zu den abgebildeten Personen geschrieben war, was sie sagten. Gab es in China, in Japan oder Korea jemals - wie hier bei Vasari - eine Debatte über die Zulässigkeit von Sprechblasen? Dass die Künste auseinanderstreben, dass jede für sich selbst schön sein möchte, ist wahr. Aber ebenso wahr ist, dass sie immer wieder zusammenkommen wollen oder zusammengebracht werden sollen. Brunos Sprechblasen waren nicht nur eine geschriebene Ergänzung, sondern sie sollten auch gesprochen werden. Es ging also nicht nur um die Präzisierung der Bedeutung, sondern auch um die Herstellung eines Klanges. Der Hang zum Gesamtkunstwerk.
Giorgio Vasari: Das Leben des Taddeo Gaddi, Agnolo Gaddi, Buffalmacco, Orcagna, Spinello Aretino und Lorenzo Monaco, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin 2015, 354 Seiten, mehr als 50 s/w und farbigen Abbildungen, 22,90 Euro.
Kommentieren