Bücher der Saison
Frühjahr 2018: Sachbuch
Eine Auswahl der interessantesten, umstrittensten und meist besprochenen Bücher der Saison.
12.04.2018.Literatur / Sach- und politische Bücher
Debatten und Ideen
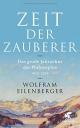
 Die besten Bestseller sind immer die, mit denen man nicht gerechnet hat. Wolfram Eilenberger hat mit "Zeit der Zauberer" in dieser Saison so einen Bestseller vorgelegt - wieder mal ein Buch über die zwanziger Jahre in dem sich schlaglichthaft die geistige Situation einer entscheidenden Periode spiegelt: Es geht um die Gleichzeitigkeit von Heidegger, Benjamin, Arendt, Cassirer, Wittgenstein. Der Medienwissenschaflter Bernhard Poerksen nahm dieses Buch in Dlf Kultur zum Anlass für einen beschämten Blick auf die verkümmerte Debattenkultur in den Geisteswissenschaften heutzutage: "Die Beschwörung des existenziellen Philosophierens ist eine kaum verhüllte Anklage." Mit Bedauern konstatiert Pörksen die Vertreibung der Zauberer aus den Unis. Micha Brumlik und Jörg Magenau haben Eilenbergers tour d'horizon in taz und SZ dringend empfohlen. Nicht zuletzt, weil es außerordentlich aktuell sei: Schließlich, so Brumlik, waren die Zwanziger geprägt von ungeheuren, "weltverändernden" technischen Erfindungen - genau wie die zehner Jahre des 21. Jahrhunderts. Skeptischer war Lorenz Jäger in der FAZ, der Eilenbergers Darstellung zu verspielt fand. Bernhard Pörksen selbst widerspricht im übrigen dem von ihm beschriebenen Drittmittel-Akademiker, der sich in der Öffentlichkeit nicht positioniert: Er hat mit "Die große Gereiztheit" einen Essay über den Zustand der Debatte im Zeitalter von Facebook vorgelegt - erstaunlich, dass es in den von uns ausgewerteten Zeitungen wenig besprochen wurde. Pörksen sieht die sozialen Netze als Hauptfaktor der hysterisierten Öffentlichkeiten. Charlotte Voss kann im NDR nur zustimmen.
Die besten Bestseller sind immer die, mit denen man nicht gerechnet hat. Wolfram Eilenberger hat mit "Zeit der Zauberer" in dieser Saison so einen Bestseller vorgelegt - wieder mal ein Buch über die zwanziger Jahre in dem sich schlaglichthaft die geistige Situation einer entscheidenden Periode spiegelt: Es geht um die Gleichzeitigkeit von Heidegger, Benjamin, Arendt, Cassirer, Wittgenstein. Der Medienwissenschaflter Bernhard Poerksen nahm dieses Buch in Dlf Kultur zum Anlass für einen beschämten Blick auf die verkümmerte Debattenkultur in den Geisteswissenschaften heutzutage: "Die Beschwörung des existenziellen Philosophierens ist eine kaum verhüllte Anklage." Mit Bedauern konstatiert Pörksen die Vertreibung der Zauberer aus den Unis. Micha Brumlik und Jörg Magenau haben Eilenbergers tour d'horizon in taz und SZ dringend empfohlen. Nicht zuletzt, weil es außerordentlich aktuell sei: Schließlich, so Brumlik, waren die Zwanziger geprägt von ungeheuren, "weltverändernden" technischen Erfindungen - genau wie die zehner Jahre des 21. Jahrhunderts. Skeptischer war Lorenz Jäger in der FAZ, der Eilenbergers Darstellung zu verspielt fand. Bernhard Pörksen selbst widerspricht im übrigen dem von ihm beschriebenen Drittmittel-Akademiker, der sich in der Öffentlichkeit nicht positioniert: Er hat mit "Die große Gereiztheit" einen Essay über den Zustand der Debatte im Zeitalter von Facebook vorgelegt - erstaunlich, dass es in den von uns ausgewerteten Zeitungen wenig besprochen wurde. Pörksen sieht die sozialen Netze als Hauptfaktor der hysterisierten Öffentlichkeiten. Charlotte Voss kann im NDR nur zustimmen. Sklaverei und Rassismus
 Dass Sklaverei und Rassismus in Zusammenhängen vorkommen, in denen sie eher selten diskutiert werden, zeigte ein Interview neulich in der taz. Der französische Historiker Biram Dah Abeid erinnerte daran, dass Sklaverei in Mauretanien nach wie vor gängig ist. Auch dort betrachten sich die "Besitzer" als "weiß", und sie rechtfertigen die Sklaverei mit Koran-Stellen. Der Kölner Historiker Michael Zeuske erzählt in dem Buch "Sklaverei" eine Universalgeschichte der Sklaverei. Allerdings fasst er den Begriff laut Michael Zeuske in der NZZ so weit, dass Kriterienverlust droht. Für Wolfgang Schneider ist das neue an diesem Buch "dezidiert 'menschheitsgeschichtliche' Perspektive ... Dabei zeigt sich auf geradezu erschütternde Weise, dass die Sklaverei von der Frühgeschichte bis in die Gegenwart keine (kriminelle) Ausnahmepraxis war, sondern der Regelfall - durch alle Epochen und Reiche und auf allen Kontinenten, sei es bei den Ägyptern oder Römern, bei den Mayas oder Azteken, bei den Chinesen oder Mongolen", schreibt er im Dlf Kultur. Als Mahnung, dass nicht eine Kultur im Spiel der Weltgeschichte als die exklusiv zuständige und schuldige zu betrachten ist, taugt das Buch also in jedem Fall.
Dass Sklaverei und Rassismus in Zusammenhängen vorkommen, in denen sie eher selten diskutiert werden, zeigte ein Interview neulich in der taz. Der französische Historiker Biram Dah Abeid erinnerte daran, dass Sklaverei in Mauretanien nach wie vor gängig ist. Auch dort betrachten sich die "Besitzer" als "weiß", und sie rechtfertigen die Sklaverei mit Koran-Stellen. Der Kölner Historiker Michael Zeuske erzählt in dem Buch "Sklaverei" eine Universalgeschichte der Sklaverei. Allerdings fasst er den Begriff laut Michael Zeuske in der NZZ so weit, dass Kriterienverlust droht. Für Wolfgang Schneider ist das neue an diesem Buch "dezidiert 'menschheitsgeschichtliche' Perspektive ... Dabei zeigt sich auf geradezu erschütternde Weise, dass die Sklaverei von der Frühgeschichte bis in die Gegenwart keine (kriminelle) Ausnahmepraxis war, sondern der Regelfall - durch alle Epochen und Reiche und auf allen Kontinenten, sei es bei den Ägyptern oder Römern, bei den Mayas oder Azteken, bei den Chinesen oder Mongolen", schreibt er im Dlf Kultur. Als Mahnung, dass nicht eine Kultur im Spiel der Weltgeschichte als die exklusiv zuständige und schuldige zu betrachten ist, taugt das Buch also in jedem Fall. Rassismus und Sklaverei gehören eindeutig zu den Themen der Saison. Der heißeste intellektuelle Anführer moderner Rassismustheorie ist wohl Ta-Nehisi Coates, einer der bekanntesten Essayisten Amerikas, dessen Anklage "We were eight years in power" jetzt auf Deutsch erschienen ist. Coates' Grundthese ist, dass es allein der Rassismus gewesen ist, der nach Obama eben Donald Trump ins Weiße Haus gebracht habe (und nicht die Verarmung der weißen Mittelschichten), erläutert der begeisterte Rezensent Tobias Rüther in der Sonntags-FAZ. Auch dass die USA noch immer nicht "die Bedeutung von Rasse" erkannt hätten, lernt Rüther aus diesem Band. Als würde in der amerikanischen Linken und in den Geisteswissenschaften über irgendetwas anderes als solche Differenzen diskutiert! Alle Kritiker der vom Perlentaucher ausgewerteten Zeitungen waren positiv. Den Kontext zur radikalen "Black Power"-Bewegung, aus deren Aristokratie Coates stammt, hat Johannes Kuhn in der SZ analysiert, der sich kritischer äußert als die Rezensenten: "Coates' Monokausalität, sein Fatalismus in der Analyse machen seine rhetorische Stärke aus. Doch der Preis dafür ist die Schwäche des Arguments."
Rassismus und Sklaverei gehören eindeutig zu den Themen der Saison. Der heißeste intellektuelle Anführer moderner Rassismustheorie ist wohl Ta-Nehisi Coates, einer der bekanntesten Essayisten Amerikas, dessen Anklage "We were eight years in power" jetzt auf Deutsch erschienen ist. Coates' Grundthese ist, dass es allein der Rassismus gewesen ist, der nach Obama eben Donald Trump ins Weiße Haus gebracht habe (und nicht die Verarmung der weißen Mittelschichten), erläutert der begeisterte Rezensent Tobias Rüther in der Sonntags-FAZ. Auch dass die USA noch immer nicht "die Bedeutung von Rasse" erkannt hätten, lernt Rüther aus diesem Band. Als würde in der amerikanischen Linken und in den Geisteswissenschaften über irgendetwas anderes als solche Differenzen diskutiert! Alle Kritiker der vom Perlentaucher ausgewerteten Zeitungen waren positiv. Den Kontext zur radikalen "Black Power"-Bewegung, aus deren Aristokratie Coates stammt, hat Johannes Kuhn in der SZ analysiert, der sich kritischer äußert als die Rezensenten: "Coates' Monokausalität, sein Fatalismus in der Analyse machen seine rhetorische Stärke aus. Doch der Preis dafür ist die Schwäche des Arguments."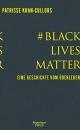

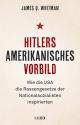 Fünfzig Jahre nach dem Tod Martin Luther Kings wird heute vielfach die "Black Lives Matter"-Bewegung als Nachfahrin des Kampfs um die Bürgerrechte genannt. Mit Patrisse Khan-Cullors erzählt eine Mitbegründerin der Bewegung in seinem bei KiWi erschienen Buch "#BlackLivesMatter" ihre Geschichte - das Buch wurde als authentische Zeugnis einer schwarzen Leidenserfahrung in Zeit und taz besprochen. Dass in der deutschen Fassung "People of Colour" mit "farbig" und "race" mit "Rasse" übersetzt wurde, wurde allerdings als unpassend bemängelt. Im Kontext zu nennen wären noch der antikolonialistische Klassiker "Über den Kolonialismus" von Aimé Césaire und James Q. Whitmans Studie "Hitlers amerikanisches Vorbild" die behauptet, dass sich Hitlers Rasse-Gesetze an amerikanischen Vorbildern orientiert hätten und das widersprüchlich aufgenommen wurde, recht positiv von Alan Posener in der Welt, mit einer vernichtenden Kritk von Götz Aly in der Zeit.
Fünfzig Jahre nach dem Tod Martin Luther Kings wird heute vielfach die "Black Lives Matter"-Bewegung als Nachfahrin des Kampfs um die Bürgerrechte genannt. Mit Patrisse Khan-Cullors erzählt eine Mitbegründerin der Bewegung in seinem bei KiWi erschienen Buch "#BlackLivesMatter" ihre Geschichte - das Buch wurde als authentische Zeugnis einer schwarzen Leidenserfahrung in Zeit und taz besprochen. Dass in der deutschen Fassung "People of Colour" mit "farbig" und "race" mit "Rasse" übersetzt wurde, wurde allerdings als unpassend bemängelt. Im Kontext zu nennen wären noch der antikolonialistische Klassiker "Über den Kolonialismus" von Aimé Césaire und James Q. Whitmans Studie "Hitlers amerikanisches Vorbild" die behauptet, dass sich Hitlers Rasse-Gesetze an amerikanischen Vorbildern orientiert hätten und das widersprüchlich aufgenommen wurde, recht positiv von Alan Posener in der Welt, mit einer vernichtenden Kritk von Götz Aly in der Zeit.Politik heute
 Eigentlich gibt es ja im Moment kaum etwas Faszinierenderes, wenn auch zugleich Beängstigenderes als das Bröckeln der für so solide gehaltenen Demokratien. Aber zum Stichwort "Populismus", der einer der Treiber und zugleich Profiteure dieses Bröckelns ist, gibt es in dieser Saison kaum Bücher. Einzig Yascha Mounk, einst Juso in Schwaben und heute Politologe in Harvard, wie Ralph Bollmann in der FAS informiert, versucht in "Der Zerfall der Demokratie" eine Tour d'horizon. Mit Trump und Putin, Erdogan und Orban komme die Demokratie an ihr Ende, so Mounk laut Bollmann. Und in den anderen Ländern, etwa Deutschland, bemühen sich die übriggebliebenen Demokraten ums Hochhalten der Fassade. Keine besonders vergnügliche Diagnose. Zumal dem Ex-Sozi am Ende offenbar nur ein Appell für eine aktivere Wohnungsbau-Politik einfällt. Anders als noch Jan Werner Müller in seinem Essay "Was ist Populismus?" vor anderthalb Jahren erkennt Mounk die demokratische Kraft an, die im Populismus eben auch liegt, wenn die Eliten sich von der Bevölkerung abkoppeln, meint Stephan Detjen im Dlf Kultur. Mounk hofft, "das Monster zum Nutzvieh der guten Sache machen zu können", Detjen ist sich da nicht ganz sicher. Im Interview mit dem Dlf und mit Spiegel online kann Mounk seine Thesen noch näher erläutern.
Eigentlich gibt es ja im Moment kaum etwas Faszinierenderes, wenn auch zugleich Beängstigenderes als das Bröckeln der für so solide gehaltenen Demokratien. Aber zum Stichwort "Populismus", der einer der Treiber und zugleich Profiteure dieses Bröckelns ist, gibt es in dieser Saison kaum Bücher. Einzig Yascha Mounk, einst Juso in Schwaben und heute Politologe in Harvard, wie Ralph Bollmann in der FAS informiert, versucht in "Der Zerfall der Demokratie" eine Tour d'horizon. Mit Trump und Putin, Erdogan und Orban komme die Demokratie an ihr Ende, so Mounk laut Bollmann. Und in den anderen Ländern, etwa Deutschland, bemühen sich die übriggebliebenen Demokraten ums Hochhalten der Fassade. Keine besonders vergnügliche Diagnose. Zumal dem Ex-Sozi am Ende offenbar nur ein Appell für eine aktivere Wohnungsbau-Politik einfällt. Anders als noch Jan Werner Müller in seinem Essay "Was ist Populismus?" vor anderthalb Jahren erkennt Mounk die demokratische Kraft an, die im Populismus eben auch liegt, wenn die Eliten sich von der Bevölkerung abkoppeln, meint Stephan Detjen im Dlf Kultur. Mounk hofft, "das Monster zum Nutzvieh der guten Sache machen zu können", Detjen ist sich da nicht ganz sicher. Im Interview mit dem Dlf und mit Spiegel online kann Mounk seine Thesen noch näher erläutern. Viel häufiger besprochen wurde natürlich der Knaller der Saison, Michael Wolffs "Feuer und Zorn - Im Weißen Haus von Donald Trump" Aber die Rezensenten legen es zur Seite, als hätten sie eine Portion Pommes mit Mayo zuviel verschlungen. Wer wäre nicht interessiert an den saftigen Insider-Details? Aber das Skandalöse ist längst eine Umdrehung weiter, meint Christian Schlüter in der FR, das Buch sei schon jetzt hoffnungslos veraltet. Tagespolitisch nutzlos und in Sachen Innenperspektive aus dem Weißen Haus für den Rezensenten auch eher enttäuschend, kann der Band Schlüter auch bei den politischen Einschätzungen nicht überzeugen. Also, bitte warten, bis es verramscht wird!
Viel häufiger besprochen wurde natürlich der Knaller der Saison, Michael Wolffs "Feuer und Zorn - Im Weißen Haus von Donald Trump" Aber die Rezensenten legen es zur Seite, als hätten sie eine Portion Pommes mit Mayo zuviel verschlungen. Wer wäre nicht interessiert an den saftigen Insider-Details? Aber das Skandalöse ist längst eine Umdrehung weiter, meint Christian Schlüter in der FR, das Buch sei schon jetzt hoffnungslos veraltet. Tagespolitisch nutzlos und in Sachen Innenperspektive aus dem Weißen Haus für den Rezensenten auch eher enttäuschend, kann der Band Schlüter auch bei den politischen Einschätzungen nicht überzeugen. Also, bitte warten, bis es verramscht wird!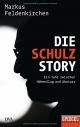
 Und ist nicht auch "Die Schulz-Story" bereits ein Fall fürs moderne Antiquariat? Das Buch beruht auf Markus Feldenkirchens Spiegel-Reportage über den Wahlkampf Martin Schulz', der jetzt schon so gründlich vergessen scheint. Seine Geschichte von der der Hundertprozent-Wahl zum SPD-Vorsitzenden bis zum traurigen und ruhmlosen Abgang, nachdem er auch den Außenminister-Posten nicht mehr übernehmen konnte, ist beispielhaft für den Verschleiß von Politikern in völlig verunsicherten Mainstream-Parteien. Das Buch beruht auf einer Reportage, die noch vor den unendlichen Traktationen erschien, die dann zur Neuauflage einer schwachbrüstigen neuen "Groko" führten. Taz-Redakteurin und Politiker-Tochter Bettina Gaus urteilte schon bei Erscheinen des Textes im Spiegel streng: Eine Grenze der Vertraulichkeit sei hier überschritten. Aber Robin Alexander lobt das Buch in der Welt als einzigartigen intimen Blick in die Berliner Politik. Flankierend zu lesen wären die Anmerkungen eines weiteren erfolglosen Kanzlerkandidaten der SPD, Peer Steinbrück, über "Das Elend der Sozialdemokratie" die in den Zeitungen eine große Resonanz und erstaunliche Anerkennung erfahren haben. Hans-Werner Kilz etwa, ehemals Chefredakteur der SZ, lobt, dass Steinbrück nicht nur inhaltlich argumentiert, sondern auch die Verknöcherung der Institution SPD geißelt. Auch die FAZ findet Steinbrücks strukturelle Kritik bemerkenswert.
Und ist nicht auch "Die Schulz-Story" bereits ein Fall fürs moderne Antiquariat? Das Buch beruht auf Markus Feldenkirchens Spiegel-Reportage über den Wahlkampf Martin Schulz', der jetzt schon so gründlich vergessen scheint. Seine Geschichte von der der Hundertprozent-Wahl zum SPD-Vorsitzenden bis zum traurigen und ruhmlosen Abgang, nachdem er auch den Außenminister-Posten nicht mehr übernehmen konnte, ist beispielhaft für den Verschleiß von Politikern in völlig verunsicherten Mainstream-Parteien. Das Buch beruht auf einer Reportage, die noch vor den unendlichen Traktationen erschien, die dann zur Neuauflage einer schwachbrüstigen neuen "Groko" führten. Taz-Redakteurin und Politiker-Tochter Bettina Gaus urteilte schon bei Erscheinen des Textes im Spiegel streng: Eine Grenze der Vertraulichkeit sei hier überschritten. Aber Robin Alexander lobt das Buch in der Welt als einzigartigen intimen Blick in die Berliner Politik. Flankierend zu lesen wären die Anmerkungen eines weiteren erfolglosen Kanzlerkandidaten der SPD, Peer Steinbrück, über "Das Elend der Sozialdemokratie" die in den Zeitungen eine große Resonanz und erstaunliche Anerkennung erfahren haben. Hans-Werner Kilz etwa, ehemals Chefredakteur der SZ, lobt, dass Steinbrück nicht nur inhaltlich argumentiert, sondern auch die Verknöcherung der Institution SPD geißelt. Auch die FAZ findet Steinbrücks strukturelle Kritik bemerkenswert.Ökologie
 Da die Zeitungen nicht so große Kapazitäten haben wie einst und nicht mehr so viele Bücher besprechen können wie noch vor zwanzig Jahren, fallen die Bücher kleinerer Verlage noch leichter durch das Raster der Literaturbeilagen - Literaturbeilagen sind Anzeigenbeilagen, und die kleineren Verlage hatten es da schon immer schwerer. Um so bemerkenswerter, wie weithin Anna Lowenhaupt Tsings bei Matthes und Seitz erschienenes Buch "Der Pilz am Ende der Welt" aufgenommen wurde. Das Thema ist eine fantastische Trouvaille, wie schon ein Zitat aus dem Klappentext zeigt: "Das erste neue Leben, das sich nach der nuklearen Katastrophe in Hiroshima wieder regte, war ein Pilz. Ein Matsutake, der auf den verseuchten Trümmern der Stadt wuchs - einer der wertvollsten Speisepilze Asiens, der nicht nur in Japan, wo er Spitzenpreise aufruft, vorkommt, sondern auf der gesamten Nordhalbkugel verbreitet ist. Dieser stark riechende Pilz wächst bevorzugt auf von der Industrialisierung verwüsteten und ruinierten Böden und ist nicht kultivierbar." Die Rezensenten sind begeistert. Man lernt nicht nur, wie der Pilz riecht und wie man ihn brät (ohne Fett!). Für Eberhard Rathgeb in der FAS gelingt es Lowenhaupt Tsing auf erstaunliche Art und Weise, am Beispiel des robusten Pilzes zu zeigen, wie ein soziales Leben in den zukünftigen "Ruinen des Kapitalismus" auch für den Menschen gelingen könnte. Dass das Buch allerdings auch durchaus modische Emotionen in Bezug auf Ökologie und Apokalypse mobilisiert, hat manchen Rezensenten auch missfallen.
Da die Zeitungen nicht so große Kapazitäten haben wie einst und nicht mehr so viele Bücher besprechen können wie noch vor zwanzig Jahren, fallen die Bücher kleinerer Verlage noch leichter durch das Raster der Literaturbeilagen - Literaturbeilagen sind Anzeigenbeilagen, und die kleineren Verlage hatten es da schon immer schwerer. Um so bemerkenswerter, wie weithin Anna Lowenhaupt Tsings bei Matthes und Seitz erschienenes Buch "Der Pilz am Ende der Welt" aufgenommen wurde. Das Thema ist eine fantastische Trouvaille, wie schon ein Zitat aus dem Klappentext zeigt: "Das erste neue Leben, das sich nach der nuklearen Katastrophe in Hiroshima wieder regte, war ein Pilz. Ein Matsutake, der auf den verseuchten Trümmern der Stadt wuchs - einer der wertvollsten Speisepilze Asiens, der nicht nur in Japan, wo er Spitzenpreise aufruft, vorkommt, sondern auf der gesamten Nordhalbkugel verbreitet ist. Dieser stark riechende Pilz wächst bevorzugt auf von der Industrialisierung verwüsteten und ruinierten Böden und ist nicht kultivierbar." Die Rezensenten sind begeistert. Man lernt nicht nur, wie der Pilz riecht und wie man ihn brät (ohne Fett!). Für Eberhard Rathgeb in der FAS gelingt es Lowenhaupt Tsing auf erstaunliche Art und Weise, am Beispiel des robusten Pilzes zu zeigen, wie ein soziales Leben in den zukünftigen "Ruinen des Kapitalismus" auch für den Menschen gelingen könnte. Dass das Buch allerdings auch durchaus modische Emotionen in Bezug auf Ökologie und Apokalypse mobilisiert, hat manchen Rezensenten auch missfallen.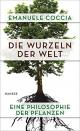 Sehr gut besprochen wurde auch Emanuele Coccias "Die Wurzeln der Welt" Der in Paris lehrende italienische Philosophiehistoriker versucht sich in seinem Buch an einer Philosophie der Pflanzen. Zeit-Rezensent Fritz Habekuss wird von Emanuele Coccias Buch "Die Wurzeln der Welt" vehement daran erinnert, dass Pflanzen die heutige Form der Welt bestimmt haben und dass alles Leben auf diesem Planeten, auch das menschliche, von ihnen abhängt. Besonders charmant findet der Rezensent, wie der italienische Philosoph Fragen über die Natur aufgreift, die sich jeder schon mal gestellt hat (beispielsweise, ob Pflanzen über ein alternatives Bewusstsein verfügen). In der SZ hebt Burkhard Müller die umgedrehte Perspektive vor, die er als äußerst erfrischend lobt: Die Welt ist für Coccia im Wesentlichen Atmosphäre. Der eine atmet ein, was der andere ausatmet. Leben wird so zu etwas, in das die Welt eindringt, ohne es zu zerstören, und der Ursprung des Ganzen sind die Blätter. Sehr lesenswert, meint Müller und versichert noch, dass Coccia mit billiger Mystik nichts am Hut hat.
Sehr gut besprochen wurde auch Emanuele Coccias "Die Wurzeln der Welt" Der in Paris lehrende italienische Philosophiehistoriker versucht sich in seinem Buch an einer Philosophie der Pflanzen. Zeit-Rezensent Fritz Habekuss wird von Emanuele Coccias Buch "Die Wurzeln der Welt" vehement daran erinnert, dass Pflanzen die heutige Form der Welt bestimmt haben und dass alles Leben auf diesem Planeten, auch das menschliche, von ihnen abhängt. Besonders charmant findet der Rezensent, wie der italienische Philosoph Fragen über die Natur aufgreift, die sich jeder schon mal gestellt hat (beispielsweise, ob Pflanzen über ein alternatives Bewusstsein verfügen). In der SZ hebt Burkhard Müller die umgedrehte Perspektive vor, die er als äußerst erfrischend lobt: Die Welt ist für Coccia im Wesentlichen Atmosphäre. Der eine atmet ein, was der andere ausatmet. Leben wird so zu etwas, in das die Welt eindringt, ohne es zu zerstören, und der Ursprung des Ganzen sind die Blätter. Sehr lesenswert, meint Müller und versichert noch, dass Coccia mit billiger Mystik nichts am Hut hat.Sexismus

 Dies war natürlich auch die Sasion von #MeToo. Das unmittelbare Thema ist sicher noch zu neu für den Buchmarkt, aber einige Neuerscheinungen bewegen sich bereits im Schwingungsfeld dieser Debatte, etwa Mary Beards vielbesprochenes Manifest "Frauen und Macht" Nun ist Beard außer Feministin eigentlich Althistorikerin und das "Manifest", das so glänzend in die tagesaktuelle Debatte passte, beruht auf zwei Vorträgen der umstrittenen Autorin. Die Kritiker haben sich prächtig unterhalten: SZ-Redakteurin Susan Vahabzadeh etwa folgt Beard gern auf ihren Streifzügen durch antike Mythen und Literatur und liest, egal ob bei Homer oder Shakespeare, wie Frauen immer wieder zum Schweigen gebracht wurden. Besonders merkt die Kritikerin bei einem Punkt auf: Wenn Frauen öffentlich reden, schreibt Beard, dann als Märtyrerinnen. Vahabzadeh denkt sofort an #MeToo, schluckt ein wenig, ist dann aber umso überzeugter von diesem "wunderbar zugespitzten, feministischem Text". Mit ihrem nüchternen und trotzdem optimistischen Buch tut Beard einen großen Schritt in die richtige Richtung, meint in der Zeit Susanne Mayer, die das Buch ebenso empfiehlt wie in der taz Heide Oestreich und die FAZ-Kritikerin Elena Witzeck. Komplizierter ist sicher Nora Amins "Weiblichkeit im Aufbruch" denn Amin, die auch Tänzerin und Performancekünstlerin ist, beschreibt ihre Körpererfahrung in Kairo, einer Stadt, die berüchtigt ist für das Ausmaß sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit, aber zugleich kulturell nicht in das Muster der #MeToo-Bewegung passt. Es gab nur eine leicht irritierte Besprechung in der Zeit.
Dies war natürlich auch die Sasion von #MeToo. Das unmittelbare Thema ist sicher noch zu neu für den Buchmarkt, aber einige Neuerscheinungen bewegen sich bereits im Schwingungsfeld dieser Debatte, etwa Mary Beards vielbesprochenes Manifest "Frauen und Macht" Nun ist Beard außer Feministin eigentlich Althistorikerin und das "Manifest", das so glänzend in die tagesaktuelle Debatte passte, beruht auf zwei Vorträgen der umstrittenen Autorin. Die Kritiker haben sich prächtig unterhalten: SZ-Redakteurin Susan Vahabzadeh etwa folgt Beard gern auf ihren Streifzügen durch antike Mythen und Literatur und liest, egal ob bei Homer oder Shakespeare, wie Frauen immer wieder zum Schweigen gebracht wurden. Besonders merkt die Kritikerin bei einem Punkt auf: Wenn Frauen öffentlich reden, schreibt Beard, dann als Märtyrerinnen. Vahabzadeh denkt sofort an #MeToo, schluckt ein wenig, ist dann aber umso überzeugter von diesem "wunderbar zugespitzten, feministischem Text". Mit ihrem nüchternen und trotzdem optimistischen Buch tut Beard einen großen Schritt in die richtige Richtung, meint in der Zeit Susanne Mayer, die das Buch ebenso empfiehlt wie in der taz Heide Oestreich und die FAZ-Kritikerin Elena Witzeck. Komplizierter ist sicher Nora Amins "Weiblichkeit im Aufbruch" denn Amin, die auch Tänzerin und Performancekünstlerin ist, beschreibt ihre Körpererfahrung in Kairo, einer Stadt, die berüchtigt ist für das Ausmaß sexueller Belästigung in der Öffentlichkeit, aber zugleich kulturell nicht in das Muster der #MeToo-Bewegung passt. Es gab nur eine leicht irritierte Besprechung in der Zeit. 1968
 Fünfzig Jahre nach 1968 erscheint eine weitere Flut zu diesem Rätseljahr, wie schon vor zehn, zwanzig, 25, dreißig und vierzig Jahren. Arno Widmann griff im Perlentaucher Heinz Budes "Adorno für Ruinenkinder" als "das klügste Buch" zum Thema auf. Weil Bude es laut Widmann schafft, die atmosphärische Verschiebung von den Fünfzigern zu den Sechzigern in Gesprächen mit Zeitgenossen am besten zu protokollieren: "Die Geschwindigkeit, mit der im Laufe weniger Jahre die Koordinatensysteme, in die man sich eingespannt erfuhr - Klassengesellschaft, Patriarchat, Ökologie -, einander ablösten, war nicht nur das Ergebnis immer neu sich artikulierender, immer umfassender werdender Veränderungswünsche. Sie hing auch damit zusammen, dass der bis dahin herrschende Wertekanon brüchig geworden war." Die übrigen Rezensenten waren distanzierter, auch weil es sich um einen "Remix" von Budes Habil-Schrift von 1995 handelt.
Fünfzig Jahre nach 1968 erscheint eine weitere Flut zu diesem Rätseljahr, wie schon vor zehn, zwanzig, 25, dreißig und vierzig Jahren. Arno Widmann griff im Perlentaucher Heinz Budes "Adorno für Ruinenkinder" als "das klügste Buch" zum Thema auf. Weil Bude es laut Widmann schafft, die atmosphärische Verschiebung von den Fünfzigern zu den Sechzigern in Gesprächen mit Zeitgenossen am besten zu protokollieren: "Die Geschwindigkeit, mit der im Laufe weniger Jahre die Koordinatensysteme, in die man sich eingespannt erfuhr - Klassengesellschaft, Patriarchat, Ökologie -, einander ablösten, war nicht nur das Ergebnis immer neu sich artikulierender, immer umfassender werdender Veränderungswünsche. Sie hing auch damit zusammen, dass der bis dahin herrschende Wertekanon brüchig geworden war." Die übrigen Rezensenten waren distanzierter, auch weil es sich um einen "Remix" von Budes Habil-Schrift von 1995 handelt.

 Viel registriert wurde auch Christina von Hodenbergs "Das andere Achtundsechzig" Hodenberg wirft laut Verlag einen neuen Blick: "68 war auch weiblich, es spielte ebenso abseits der großen Metropolen, die NS-Vergangenheit war nicht die zentrale Antriebskraft und die Eltern hatten viel mehr Verständnis für die Anliegen ihrer Kinder, als es im Rückblick scheint." Dadurch dass sie den Blick über den üblichen Kreis der Akteure auf die Gesellschaft insgesamt wirft, gelingt Hodenberg diese Akzentverschiebung, schreibt Wolfgang Hellmich in der NZZ. Offenbar recht lesenswert ist auch Wilfried Loths "Fast eine Revolution" das laut Ulrich Lappenküper in der FAZ und Claus Leggewie in der SZ einer interessante Formel für die Internationalität der Bewegung findet, die zugleich - etwa in Frankreich - eine ganz entschieden nationale, ja privinzielle Seite hatte. Schließlich sind da noch Gretchen Dutschkes Erinnerungen an "1968" und Alexander Sedlmaier Studie "Konsum und Gewalt - Radikaler Protest in der Bundesrepublik" Auf einen anderen sehr interessanten Blick auf den Pariser Mai 68 in den Romanischen Studien verlinkten wir neulich in unserer Magazinrundschau.
Viel registriert wurde auch Christina von Hodenbergs "Das andere Achtundsechzig" Hodenberg wirft laut Verlag einen neuen Blick: "68 war auch weiblich, es spielte ebenso abseits der großen Metropolen, die NS-Vergangenheit war nicht die zentrale Antriebskraft und die Eltern hatten viel mehr Verständnis für die Anliegen ihrer Kinder, als es im Rückblick scheint." Dadurch dass sie den Blick über den üblichen Kreis der Akteure auf die Gesellschaft insgesamt wirft, gelingt Hodenberg diese Akzentverschiebung, schreibt Wolfgang Hellmich in der NZZ. Offenbar recht lesenswert ist auch Wilfried Loths "Fast eine Revolution" das laut Ulrich Lappenküper in der FAZ und Claus Leggewie in der SZ einer interessante Formel für die Internationalität der Bewegung findet, die zugleich - etwa in Frankreich - eine ganz entschieden nationale, ja privinzielle Seite hatte. Schließlich sind da noch Gretchen Dutschkes Erinnerungen an "1968" und Alexander Sedlmaier Studie "Konsum und Gewalt - Radikaler Protest in der Bundesrepublik" Auf einen anderen sehr interessanten Blick auf den Pariser Mai 68 in den Romanischen Studien verlinkten wir neulich in unserer Magazinrundschau.Literatur / Sach- und politische Bücher
Kommentieren








