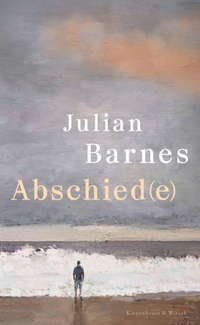 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)Aus dem Englischen von Gertraude Krueger. Julian Barnes wird im Januar 2026 achtzig Jahre alt. Er weiß, dass die längste Zeit seines Lebens hinter ihm liegt, und er möchte…

 Erinnerungen, autobiografisches Erzählen, autofiktionales Schreiben - das können nicht nur Norweger. Die amerikanische Autorin Lucia Berlin (1936-2004) ist zwischen Alaska und Mexiko achtzehnmal umgezogen, als Alleinerziehende mit vier Kindern. In dem Band "Welcome Home" sind ihre autobiografischen Skizzen versammelt, die von einer prekären Existenz vor allem in den 50er und 60er Jahren erzählen. In ihren Erinnerungen an die Orte, die Brotjobs, den Alkohol und die falschen Männer, zeigt sich die Meisterschaft der Autorin in der kurzen Form, lobt im Dlf Kultur Manuela Reichart, die vor allem die Briefe unsentimental, berührend und komisch findet. NZZ-Kritikerin Angela Schader Reichart hat diesen Band zusammen mit Lucia Berlin autobiografischen Erzählungen in "Abend im Paradies" gelesen. Beide passen sehr gut zusammen und stehen sich in Punkto Tempo und Genauigkeit in nichts nach, lobt sie. Auch Antonia Baum empfiehlt beide Bände in der Zeit als sprachlich ungeheuer lohnende Lektüre. Nur die Aufmachung mit den Großaufnahmen von Berlin missfällt ihr.
Erinnerungen, autobiografisches Erzählen, autofiktionales Schreiben - das können nicht nur Norweger. Die amerikanische Autorin Lucia Berlin (1936-2004) ist zwischen Alaska und Mexiko achtzehnmal umgezogen, als Alleinerziehende mit vier Kindern. In dem Band "Welcome Home" sind ihre autobiografischen Skizzen versammelt, die von einer prekären Existenz vor allem in den 50er und 60er Jahren erzählen. In ihren Erinnerungen an die Orte, die Brotjobs, den Alkohol und die falschen Männer, zeigt sich die Meisterschaft der Autorin in der kurzen Form, lobt im Dlf Kultur Manuela Reichart, die vor allem die Briefe unsentimental, berührend und komisch findet. NZZ-Kritikerin Angela Schader Reichart hat diesen Band zusammen mit Lucia Berlin autobiografischen Erzählungen in "Abend im Paradies" gelesen. Beide passen sehr gut zusammen und stehen sich in Punkto Tempo und Genauigkeit in nichts nach, lobt sie. Auch Antonia Baum empfiehlt beide Bände in der Zeit als sprachlich ungeheuer lohnende Lektüre. Nur die Aufmachung mit den Großaufnahmen von Berlin missfällt ihr. 
 Der schottische Dichter John Burnside widmet sich in seinem autobiografischen Band "Über Liebe und Magie" der Liebe und der Liebesunfähigkeit. Wenn er sich anhand von Erinnerungsbruchstücken wie Songs, Begriffen und Fotos zurück in die Gefühlswelt seiner Kindheit und Jugend fantasiert, ergibt das für den FAZ-Kritiker Hubert Spiegel mehr als ein Memoir. Beschreibung einer Erziehung des Herzens trifft es für den Rezensenten besser. Burnsides bekenntnisartige Reflexionen über Herkunft, Sprach- und Gefühllosigkeit, Drogenkonsum, Liebesunfähigkeit, Psychiatrie sind zwar klar aus männlicher Sicht geschrieben, erklärt Verena Auffermann hat im Dlf Kultur, die "schizophrenen Verhaltensmuster" eines Einsamen vermittelt ihr aber keiner so erbarmungslos wie dieser Autor. Ganz anders geht Ilma Rakusa vor, die ihr "autobiografisches Inventar" in "Mein Alphabet" aufdröselt. Was die Autorin und Literaturvermittlerin hier einsortiert - Lebenserinnerungen, Gedichte, Reiseeindrücke, Kollegenporträts, Vorstellung von Gewohnheiten, Essayistisches, Selbstgespräche - vermittelt Zeit-Kritikerin Julia Schröder die ganze Neugier, die Leidenschaft und Freiheit der Autorin. Ganz nebenbei lernt man auch eine "inklusive europäische Perspektive", freut sich im Dlf Kultur Paul Stoop.
Der schottische Dichter John Burnside widmet sich in seinem autobiografischen Band "Über Liebe und Magie" der Liebe und der Liebesunfähigkeit. Wenn er sich anhand von Erinnerungsbruchstücken wie Songs, Begriffen und Fotos zurück in die Gefühlswelt seiner Kindheit und Jugend fantasiert, ergibt das für den FAZ-Kritiker Hubert Spiegel mehr als ein Memoir. Beschreibung einer Erziehung des Herzens trifft es für den Rezensenten besser. Burnsides bekenntnisartige Reflexionen über Herkunft, Sprach- und Gefühllosigkeit, Drogenkonsum, Liebesunfähigkeit, Psychiatrie sind zwar klar aus männlicher Sicht geschrieben, erklärt Verena Auffermann hat im Dlf Kultur, die "schizophrenen Verhaltensmuster" eines Einsamen vermittelt ihr aber keiner so erbarmungslos wie dieser Autor. Ganz anders geht Ilma Rakusa vor, die ihr "autobiografisches Inventar" in "Mein Alphabet" aufdröselt. Was die Autorin und Literaturvermittlerin hier einsortiert - Lebenserinnerungen, Gedichte, Reiseeindrücke, Kollegenporträts, Vorstellung von Gewohnheiten, Essayistisches, Selbstgespräche - vermittelt Zeit-Kritikerin Julia Schröder die ganze Neugier, die Leidenschaft und Freiheit der Autorin. Ganz nebenbei lernt man auch eine "inklusive europäische Perspektive", freut sich im Dlf Kultur Paul Stoop.  Die nächsten drei Bücher sind zwar auch autobiografisch, widmen sie dabei aber einem bestimmten Thema. In Rachel Cusks "Lebenswerk" geht es ums Mutterwerden - als nicht immer glückliche Erfahrung und durchaus schwieriger Prozess. Auf Welt-Kritikerin Anne Waak wirkt das im Original bereits 2001 erschienene Buch wie ein Verhütungsmittel. Die Qualen der Mutterschaft hat sie selten so plastisch und plausibel beschrieben bekommen wie hier. Dass die Autorin ihr Kind liebt, ist für Waak übrigens völlig unzweifelhaft, nur schreibt Cusk darüber ohne jede "Gefühlsduselei", meint sie. Seltene Einsichten zum Thema Mutter und Kind und die Ambivalenz des Mutterseins gewinnt auch NZZ-Kritikerin Andrea Köhler aus dem Buch. Und Meredith Haaf ist in der SZ gleich völlig hin und weg: Cuskis Text dokumentiert für sie dramaturgisch perfekt die anrührenden Beschreibungen des Alltags mit dem Kind wie auch die scharfsinnigen philosophischen Gedanken über die Wandlungsprozesse, die eine Frau nach der Geburt ihres Kindes durchmacht. Und dabei auch noch voller Humor. Unbedingt lesen, empfiehlt Haaf.
Die nächsten drei Bücher sind zwar auch autobiografisch, widmen sie dabei aber einem bestimmten Thema. In Rachel Cusks "Lebenswerk" geht es ums Mutterwerden - als nicht immer glückliche Erfahrung und durchaus schwieriger Prozess. Auf Welt-Kritikerin Anne Waak wirkt das im Original bereits 2001 erschienene Buch wie ein Verhütungsmittel. Die Qualen der Mutterschaft hat sie selten so plastisch und plausibel beschrieben bekommen wie hier. Dass die Autorin ihr Kind liebt, ist für Waak übrigens völlig unzweifelhaft, nur schreibt Cusk darüber ohne jede "Gefühlsduselei", meint sie. Seltene Einsichten zum Thema Mutter und Kind und die Ambivalenz des Mutterseins gewinnt auch NZZ-Kritikerin Andrea Köhler aus dem Buch. Und Meredith Haaf ist in der SZ gleich völlig hin und weg: Cuskis Text dokumentiert für sie dramaturgisch perfekt die anrührenden Beschreibungen des Alltags mit dem Kind wie auch die scharfsinnigen philosophischen Gedanken über die Wandlungsprozesse, die eine Frau nach der Geburt ihres Kindes durchmacht. Und dabei auch noch voller Humor. Unbedingt lesen, empfiehlt Haaf.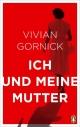
 Vivian Gornicks im Original 1987 erschienenes Buch "Ich und meine Mutter" erzählt von New York, dem Schreiben, dem Feminismus, aber eben vor allem eine Mutter-Tochter-Geschichte, die es in sich hat, verspricht Anna Vollmer in der FAZ. Konflikte und Unerbittlichkeit, aber auch Liebe und Lebhaftigkeit inklusive. Gornicks feministische Auseinandersetzung mit der Vollzeithausfrau, die sie aufgezogen hat, ist auch heute noch äußerst lesenswert ist, meint auch taz-Rezensentin Carola Ebeling. Denn die Beziehungsmuster, die Gornick aus dem Verhältnis zwischen ihren Eltern extrahiert, bestehen noch heute, erkennt sie. Ein Klassiker des Feminismus, sind sich die Kritikerinnen einig. Dieses Buch ist ein "kleines Wunder", jubelt ein gänzlich hingerissener Rezensent Joseph Hanimann über Helene Cixous' Buch "Meine Homère ist tot..." trotz des traurigen Themas, denn Cixous begleitet drei Jahre lang Verfall und Tod ihrer Mutter: Schonungslos, zärtlich, und ohne je in einen exhibitionistischen Leidensbericht abzugleiten, erzähle sie hier vom Sterben, so Hanimann. Barbara Vinken bewundert in der Welt den hohen Ton der Autorin, die mythische Epen wie die "Ilias" oder die "Odyssee" durch die Geschichte der Mutter neu erzählt und transzendiert. Besonders bemerkenswert findet Tobias Lehmkuhl im Dlf, wie Cixous in Dialogen auch nach dem Tod der Mutter weiter mit dieser spricht. Und auch er bewundert den "leichten und gesanglichen" Erzählton Cixous', den Claudia Simma bravourös ins Deutsche übertragen habe.
Vivian Gornicks im Original 1987 erschienenes Buch "Ich und meine Mutter" erzählt von New York, dem Schreiben, dem Feminismus, aber eben vor allem eine Mutter-Tochter-Geschichte, die es in sich hat, verspricht Anna Vollmer in der FAZ. Konflikte und Unerbittlichkeit, aber auch Liebe und Lebhaftigkeit inklusive. Gornicks feministische Auseinandersetzung mit der Vollzeithausfrau, die sie aufgezogen hat, ist auch heute noch äußerst lesenswert ist, meint auch taz-Rezensentin Carola Ebeling. Denn die Beziehungsmuster, die Gornick aus dem Verhältnis zwischen ihren Eltern extrahiert, bestehen noch heute, erkennt sie. Ein Klassiker des Feminismus, sind sich die Kritikerinnen einig. Dieses Buch ist ein "kleines Wunder", jubelt ein gänzlich hingerissener Rezensent Joseph Hanimann über Helene Cixous' Buch "Meine Homère ist tot..." trotz des traurigen Themas, denn Cixous begleitet drei Jahre lang Verfall und Tod ihrer Mutter: Schonungslos, zärtlich, und ohne je in einen exhibitionistischen Leidensbericht abzugleiten, erzähle sie hier vom Sterben, so Hanimann. Barbara Vinken bewundert in der Welt den hohen Ton der Autorin, die mythische Epen wie die "Ilias" oder die "Odyssee" durch die Geschichte der Mutter neu erzählt und transzendiert. Besonders bemerkenswert findet Tobias Lehmkuhl im Dlf, wie Cixous in Dialogen auch nach dem Tod der Mutter weiter mit dieser spricht. Und auch er bewundert den "leichten und gesanglichen" Erzählton Cixous', den Claudia Simma bravourös ins Deutsche übertragen habe.