Jacques Derrida
Politik der Freundschaft
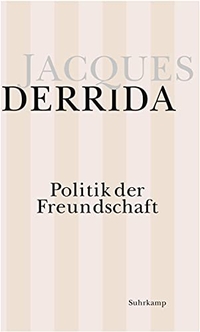
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main 2000
ISBN 9783518582848
Gebunden, 491 Seiten, 44,99 EUR
ISBN 9783518582848
Gebunden, 491 Seiten, 44,99 EUR
Klappentext
Aus dem Französischen von Stefan Lorenzer. "O Freunde, es gibt keinen Freund" findet sich in Montaignes berühmtem Essay "Über die Freundschaft" ebenso wie bei Aristoteles, Friedrich Nietzsche und Carl Schmitt, aber auch bei Kant, Bataille und Blanchot. Dieser enigmatische Satz eröffnet jeweils eine Theorie der Freund- und Feindschaft, deren politische wie philosophische Implikationen Derrida herausarbeitet. In unserer Tradition, so lautet die Hypothese des Buchs, ist die Genealogie des Politischen mit dem Paar Bruder-Freund verbunden. "Politik der Freundschaft" zielt auf einen neuen Begriff des Politischen, auf eine künftige Theorie der Demokratie.
Rezensionsnotiz zu Frankfurter Rundschau, 26.08.2000
In einer recht verschwurbelten Rezension, die für ein normales Lesepublikum einer Tageszeitung denkbar unangemessen erscheint versucht Michael Mayer Derridas Vorstellungen von Freundschaft und Brüderlichkeit auf die Spur zu kommen. Da Derrida häufig als "dekonstruktivistisch" bezeichnet wird, hält es Mayer für angebracht darauf hinzuweisen, dass der Philosoph sich hier keineswegs auf die "philosophiegeschichtlichen Subtilitäten einer antimonisch strukturierten Wendung und ihrer lang wirkenden Folgen" kapriziere, nachdem er, Mayer, zunächst die Folgen des Aristoteles zugeschriebenem Satz "O meine Freunde, es gibt keinen Freund" erläutert hat. Stattdessen habe Derrida gezeigt, wie der Begriff von Politik einst mit Vorstellungen von Freundschaft bzw. "Brüderlichkeit" geprägt war. Anschließend zitiert Mayer Passagen über die Beziehungen von Demokratie, Singularität und Alterität bei Derrida, um anschließend selbst frei über diese Stichworte zu assoziieren. Als er schließlich bei dem Ergebnis "Eine Brüderlichkeit jenseits der Verbrüderung, eine Gemeinschaft ohne (natürliche, naturnotwendige) Gemeinschaft" angekommen ist, fragt er den Leser doch tatsächlich, ob "es das (ist), was Derrida verspricht?"
Rezensionsnotiz zu Süddeutsche Zeitung, 19.08.2000
"Was für ein Buch!", ruft Hans-Dieter Gondek zu Beginn seiner Rezension und empfiehlt zum zwei-, ja dreimaligen Lesen des Werks, das er in seiner Komplexität zutiefst bewundert. Er stellt zunächst klar, dass es sich hier nicht um eine "chronologische Geschichte" der Freundschaft oder ihres Begriffs handele, auch wenn von Aristoteles bis Blanchot die ganze Zeitreihe abgeschritten wird. Eher stellt es sich in Gondeks Rezension als eine ausgreifende, vieles streifende Assoziation dar. Als gewichtigsten Gegner, an dem sich Derrida dabei abarbeitet, nennt der Rezensent Carl Schmitt und seinen politischer Begriff von Freund- und Feindschaft. Wie andere Rezensenten vor ihm betont Gondek, dass Derridas Buch dadurch zu einer Parteinahme "für das Politische, ja die Demokratie, genauer für eine zukünftige, im Kommen begriffene Demokratie" werde. Gondek lobt auch Stefan Lorenzers "genaue" Übersetzung.
Rezensionsnotiz zu Neue Zürcher Zeitung, 15.07.2000
Uwe Justus Wenzel erfreut sich an den "mäandrierenden, die Klarheit dennoch nicht scheuenden Reflexionen" Derridas über die Freundschaft und zeichnet nach, wie Derrida mit dem Aristoteles zugeschriebenen Ausspruch "O meine Freunde, es gibt keinen Freund" eine Genealogie des Begriffs über Philosophen wie Diogenes Laertius, Montaigne, Nietzsche bis zu sich selbst konstruiert. Dabei findet Wenzel es besonders interessant, wie Derrida diesem Satz durch unterschiedliche Übersetzungen aus dem Griechischen unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten gibt und wie er über den doppelten Ausschluss der Frauen aus dem Satz nachdenkt - weder war bei den Philosophen eine Freundschaft unter Frauen noch zwischen Frau und Mann vorgesehen. Nach Wenzel hält Derrida dennoch am Begriff der Brüderlichkeit fest, den er mit dem der Demokratie als eines nie eingelösten Versprechens verbinde.
Rezensionsnotiz zu Die Tageszeitung, 09.06.2000
Ein kleiner Seufzer - "gehörte der Essay nicht einmal zu den kürzeren Prosaformen?" - aber dann macht sich Friedrich Balke doch recht beschwingt an eine ganzseitige Besprechung von Derridas "monströser Fußnote" zum `griechischen Kanon der Freundschaft` quer durch die abendländische Philosophiegeschichte. Derridas Ausgangspunkt ist ein Satz, der Aristioteles zugeschrieben wird: `O meine Freunde, es gibt keinen Freund`. Derrida lese den Satz "symptomatologisch", so Balke, er drücke für ihn ein unbehagliches Bewußtsein aus, dass mit der - gerade bei Aristoteles - vielbeschworenen Freundschaft etwas nicht stimmt. Der Freund war in Griechenland immer der Bruder, der nahe Verwedte. Gemünzt auf die Politik bedeutete dies, dass die Gleichheit vor dem Gesetz immer auf einer Gleichheit der Herkunft beruhte. Fremde und Frauen konnten nicht Bruder und daher auch nicht gleich sein. Aristoteles` Satz kann daher nach Derrida als Aufforderung gelesen werden, die Freundschaft (und damit die Gleichheit) von der "Gleichbürtigkeit" zu lösen. Balke skizziert im wesentlichen zustimmend Derridas anschließende Auseinandersetzung mit Georges Bataille, Maurice Blanchot, Jean-Luc Nancy und Carl Schmitt. Aber dann hat er auch "ein Wort der Kritik" anzubringen, dass sich über das letzte Drittel der Besprechung erstreckt: Balke bemängelt, dass Derrida die Geschichte der Orden, die die Bruderschaft als Institution schufen, ebenso außen vor läßt wie die Figur des Bruders in der arabisch-islamischen Kultur. Dass Derrida dieses Manko selbst zugibt, macht es für Balke auch nicht besser. Auch Derridas Versuch, Homosexualität als das `Wesen` der Freundschaft auszugeben, findet Balke nicht überzeugend. Da hält er es eher mit Michel Foucault, der darauf hingewiesen hat, dass im Westen Freundschaft "durchaus mit einer rigiden Ausschließung homophiler Lebensformen einher" ging. Trotz dieser Kritik zeigt Balkes anregende Besprechung, dass er Derridas Buch mit Gewinn gelesen hat.
Rezensionsnotiz zu Die Zeit, 08.06.2000
In einer Sammelrezension bespricht Elisabeth von Thadden drei Bücher zum Thema Freundschaft. Am Rande erwähnt sie noch Marylin Friedmanns Aufsatz "Freundschaft und moralisches Wachstum (erschienen 1997 in der Deutsche Zeitschrift für Philosophie 45), in dem die Autorin auf die Philosophin Seyla Benhabib hinweist, die Freundschaft in die Nähe der Fürsorge rückt und in ihr "die Zuwendung zu den Bedürfnissen des konkreten Anderen" erkennt. Friedman betone Freundschaft als Beitrag zum "moralischen Wachstum", schreibt von Thadden.
1) Klaus-Dieter Eichler (Hrsg.): "Philosophie der Freundschaft"
Man möchte meinen, dass die Rezensentin die Grundmaterialien für ihre Reflexionen zum Thema Freundschaft hier gefunden hat. Sie zitiert daraus Aristoteles" paradoxen Ruf: "Oh Freunde, es gibt keinen Freund" ebenso wie Montaignes Loblied auf seine Freundschaft mit Étienne de la Boétie, sie liest Kant, Simmel, Luhmann und Giddens, und obwohl sie es nicht ausdrücklich sagt, hofft man, angesichts ihrer Begeisterung über den "schönen Band von Klaus-Dieter Eichler", dass sie diese gewinnbringend gelesenen Texte zum Thema Freundschaft in ihm gefunden hat. Die neuerliche Konjunktur des Themas an sich hat ihrer Meinung nach zu tun mit unserer Zeit und ihrer Verunsicherung für den Einzelnen. Denn weder Ehen noch Arbeitsverträge währen mehr ewig, und der Einzelne sucht daher nach anderen Einzelnen, die ihm Wertschätzung entgegenbringen und doch auch die Freiheit lassen; Vertrautheit ohne Fesselung ist gefragt. Sie merkt bedeutungsvoll an, dass Texte über und von Frauen, also Freundinnen, bei Eichler allerdings fehlen. Ein Problem des Freundschaftsbegriffs selbst? Trotzdem: ein vorzügliches Geschenk "von lesenden Freunden für lesende Freunde".
2) Harald Lemke: "Freundschaft"
Ungehalten reagiert die Rezensentin auf diesen jungen Philosophen, der eine "Ethik des Selbst" mit einer "Theorie der Lust" versöhnt. Das klingt ihr zu sehr nach einer "Freundschaftsphilosophie für städtische Singles". Sie stellt sich das flugs vor wie einen "Kreis befreundeter Doktoranden", wie sie bissig sagt, der sich fern hält von quengeligen Kindern, pflegebedürftigen Alten und überhaupt erfahrungslos ist, was die Schmerzen der Nähe und des Verlustes angeht. "Wechselseitige Selbstbefreiung"? Natürlich, recht hat er, gesteht sie ihm zu, Giddens und Luhmann setzen ja auch autonome Individuen für eine wahrhaft emanzipierte Gesellschaft voraus. Also haben Demokratie und diese Art Freundschaft womöglich miteinander zu tun?
3) Jaques Derrida: "Politik der Freundschaft"
Dies findet die Rezensentin eines der "offensten, gewinnendsten Bücher" des französischen Dekonstruktions-Philosophen. Sie rechnet ihm hoch an, dass er den Finger auf die Wunde legt und den Ausschluss der Frauen aus dem von so genannten männlichen Tugenden konstruierten Freundschaftsbegriff zur Kenntnis nimmt. Er, der doch als "Skeptiker gegenüber der Strenge Kants" gilt, versöhnt hier den Königsberger Philosophen gewissermaßen mit sich selbst und bringt das universale Gesetz mit dem partikularen Privileg der Freundschaft in Einklang. Aber er fragt auch: "Warum hat er die Schwester nicht genannt?" Entscheidend jedoch ist für Derrida, wie auch seine Rezensentin, die Neuübersetzung des aristotelischen Ausrufs: "O Freunde, es gibt keine Freunde". Er heißt bei ihm jetzt: "Es gibt niemals einen einzigen Freund". Mit dieser Differenzierung ermöglicht Derrida die Definition von Freundschaft als einer Beziehung, die sich mit jedem jeweils neu konstituiert, d.h. jede Freundschaft ist eine andere, lässt andere Facetten des Selbst zur Geltung kommen und beinhaltet auch eine je "spezifische Reserve". Derrida ist es in seinem Text um "Gleichheit" als Gegenpart zur "Einzigartigkeit" zu tun, und mit dieser Auffächerung scheint ihm in den Augen der Rezensentin die Formel für die Auflösung eines philosophischen Widerspruchs gelungen.
1) Klaus-Dieter Eichler (Hrsg.): "Philosophie der Freundschaft"
Man möchte meinen, dass die Rezensentin die Grundmaterialien für ihre Reflexionen zum Thema Freundschaft hier gefunden hat. Sie zitiert daraus Aristoteles" paradoxen Ruf: "Oh Freunde, es gibt keinen Freund" ebenso wie Montaignes Loblied auf seine Freundschaft mit Étienne de la Boétie, sie liest Kant, Simmel, Luhmann und Giddens, und obwohl sie es nicht ausdrücklich sagt, hofft man, angesichts ihrer Begeisterung über den "schönen Band von Klaus-Dieter Eichler", dass sie diese gewinnbringend gelesenen Texte zum Thema Freundschaft in ihm gefunden hat. Die neuerliche Konjunktur des Themas an sich hat ihrer Meinung nach zu tun mit unserer Zeit und ihrer Verunsicherung für den Einzelnen. Denn weder Ehen noch Arbeitsverträge währen mehr ewig, und der Einzelne sucht daher nach anderen Einzelnen, die ihm Wertschätzung entgegenbringen und doch auch die Freiheit lassen; Vertrautheit ohne Fesselung ist gefragt. Sie merkt bedeutungsvoll an, dass Texte über und von Frauen, also Freundinnen, bei Eichler allerdings fehlen. Ein Problem des Freundschaftsbegriffs selbst? Trotzdem: ein vorzügliches Geschenk "von lesenden Freunden für lesende Freunde".
2) Harald Lemke: "Freundschaft"
Ungehalten reagiert die Rezensentin auf diesen jungen Philosophen, der eine "Ethik des Selbst" mit einer "Theorie der Lust" versöhnt. Das klingt ihr zu sehr nach einer "Freundschaftsphilosophie für städtische Singles". Sie stellt sich das flugs vor wie einen "Kreis befreundeter Doktoranden", wie sie bissig sagt, der sich fern hält von quengeligen Kindern, pflegebedürftigen Alten und überhaupt erfahrungslos ist, was die Schmerzen der Nähe und des Verlustes angeht. "Wechselseitige Selbstbefreiung"? Natürlich, recht hat er, gesteht sie ihm zu, Giddens und Luhmann setzen ja auch autonome Individuen für eine wahrhaft emanzipierte Gesellschaft voraus. Also haben Demokratie und diese Art Freundschaft womöglich miteinander zu tun?
3) Jaques Derrida: "Politik der Freundschaft"
Dies findet die Rezensentin eines der "offensten, gewinnendsten Bücher" des französischen Dekonstruktions-Philosophen. Sie rechnet ihm hoch an, dass er den Finger auf die Wunde legt und den Ausschluss der Frauen aus dem von so genannten männlichen Tugenden konstruierten Freundschaftsbegriff zur Kenntnis nimmt. Er, der doch als "Skeptiker gegenüber der Strenge Kants" gilt, versöhnt hier den Königsberger Philosophen gewissermaßen mit sich selbst und bringt das universale Gesetz mit dem partikularen Privileg der Freundschaft in Einklang. Aber er fragt auch: "Warum hat er die Schwester nicht genannt?" Entscheidend jedoch ist für Derrida, wie auch seine Rezensentin, die Neuübersetzung des aristotelischen Ausrufs: "O Freunde, es gibt keine Freunde". Er heißt bei ihm jetzt: "Es gibt niemals einen einzigen Freund". Mit dieser Differenzierung ermöglicht Derrida die Definition von Freundschaft als einer Beziehung, die sich mit jedem jeweils neu konstituiert, d.h. jede Freundschaft ist eine andere, lässt andere Facetten des Selbst zur Geltung kommen und beinhaltet auch eine je "spezifische Reserve". Derrida ist es in seinem Text um "Gleichheit" als Gegenpart zur "Einzigartigkeit" zu tun, und mit dieser Auffächerung scheint ihm in den Augen der Rezensentin die Formel für die Auflösung eines philosophischen Widerspruchs gelungen.
Themengebiete
Kommentieren









