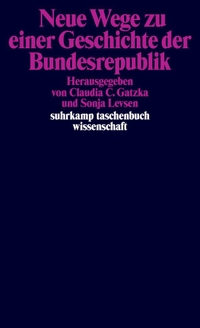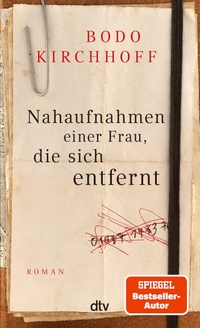Post aus Abchasien
Das steinerne Land
Von Maximilian H.
10.04.2002. "Hier haben die Abchasen das Sagen. Niemand sonst, außer vielleicht noch den Russen, ihrer Schutzmacht." Fahrt durch ein vom Krieg zerstörtes Land. Aus dem Archiv - aber aktuell! Die Brücke über den Inguri
- Wollen Sie sehen? - fragt der Stabsarzt. Er schaltet runter in den dritten Gang und sieht mich schräg von der Seite an. Links liegt das halbverfallene Fort aus der Türkenzeit. Vor uns müsste jetzt die Brücke (Bild) über den Inguri kommen. Die Waffenstillstandslinie.
Ich nicke. Der Mann von der Bundeswehr reißt den Land Cruiser von der Straße auf die Piste, haut den Vierradantrieb rein, stemmt sich in den Sitz. Rambo lässt grüßen. Wir plumpsen in zwei, drei Löcher, schlingern über Schlamm und Panzerspuren, rutschen weg, kommen einem Mauerrest der Türkenfestung zu nahe, gefährlich nahe, torkeln gerade noch knapp auf die freie Seite. Endlich die feste Grasnarbe. Ein kurzer, heftiger Spurt, dann stehen wir mit einem Ruck. Ich unterdrücke mein Dankeschön; es würde seltsam klingen nach diesem verrückten Gewaltritt. Vor uns wie ein eingefriedeter Acker, der Soldatenfriedhof. Mit leichtem Druck öffnet sich die Pforte. Ich gehe auf die Steinplatte zu. Drei Kreuze bilden einen Halbkreis.
- Passen Sie gut auf, dass Sie nicht einsacken, Sie mit Ihren Halbschuhen! - ruft der Uniformierte.
Ich drehe mich um. Er steht in der offenen Tür des Geländewagens; mit verschränkten Armen, den Kampfanzug aufgepeppt mit Halstuch, Sonnenbrille, polierten Schnürstiefel. Wie ein State Trooper aus einer US-Serie. Er klingt nicht gerade freundlich. Ist wohl sauer, dass er mich am Wochenende von Senaki abholen musste. Die UNO-Antonow aus Tiflis hatte Verspätung und außer den verlassenen Bunkern für die zwei Dutzend MIG 29, die in der Sowjetzeit hier stationiert waren, gibt es auf dem Flugplatz nichts. Jedenfalls nichts, was einem Bundeswehrstabsarzt im UNO-Einsatz die Zeit verkürzen könnte. Nur narbiger Asphalt, Ölflecken, wildwachsendes Gras und eine windschiefe Bretterbude. Und natürlich der Blick auf den Kaukasus. Sogar zwei davon: den Großen Kaukasus im Norden und den Kleinen Kaukasus im Süden.
Ich knöpfe den Mantel zu und klappe den Kragen hoch. Er kann mich mal. Es ist blendend hell, ein kalter Wind fegt von den Bergen in die Ebene. Der Wind trägt einen feinen Geruch heran wie von trockenem Gras. An den Viertausendern ist jede Zacke zu erkennen. Die Schneespitzen stechen weiß in einen stählernen Himmel. Als hätte jemand das Bild am Computer bearbeitet. Davor im Vordergrund der Toyota und der Stabsarzt. Wie ein Werbefoto für japanische Geländewagen und auf flott gebürstete Stabsärzte der Bundeswehr bei der UNO. Schöne neue Welt. Ich gehe langsam zurück und wische die Schuhe am Gras ab, bevor ich wieder in den Land Cruiser steige. Die Pforte hat Teerspuren an den Fingern hinterlassen.
- Schon mal hier gewesen? - frage ich, ohne ihn anzusehen.
- Natürlich, wir haben das hier in Ordnung gebracht. -
- So? -
Ich stecke das weg. Mein Zweifel war schlecht gespielt. Natürlich haben die das in Ordnung gebracht, die Leute von der Bundeswehr. Zumindest halten sie die Anlage in Ordnung, nachdem sie einmal angelegt worden ist. In Georgien (Karte) sind zwölftausend Kriegsgefangene gestorben. Nicht nur Deutsche, aber die meisten davon. Ein paar Dutzend liegen hier. Oder Hunderte? Überall im Lande haben sie nach dem Krieg die großen Fabriken und Gebäude gebaut.
Auch die Brücke über den Inguri ist ihr Werk. Die Auffahrt kommt gleich hinter der Türkenfestung, kaum dass wir wieder die feste Straße erreicht haben. Die Brücke ist eine schmale, auf Stein gelagerte Stahlkonstruktion, mit seltsamen pyramidenartigen Aufsetzern an den vier Enden. Kunst am Bau aus der Stalinzeit. Mein Bundeswehrfreund schaltet herunter. Es wird eng. Auf der Fahrbahn liegt eine Schmutzschicht. Wir fahren an einer langen Reihe von Bauern und Frauen mit Körben voller Gemüse vorbei. Ameisenverkehr über die Brücke, kleiner Grenzhandel. Ab und zu ein paar Stangen Zigaretten unter Tomaten und Gurken versteckt. Der richtige Schmuggel, das ist der Schmuggel, der sich wirklich lohnt, der mit den Drogen und Waffen, läuft mit Geländewagen über die Furten weiter nördlich. Er ist in festen Händen, nicht bei Gemüsebauern und Frauen in bunten Röcken.
Dann unter uns sekundenlang der Inguri, ein Flüsschen, an manchen Stellen gerade noch ein Bach, in einem viel zu breiten Flussbett, eingefasst von prallgrüner Vegetation. Im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser kommt, kann er noch lebhaft werden. Sonst hat man ihm das Wasser abgegraben. Georgier und Abchasen teilen sich die Kraftwerke. Das klappt gut; lief sogar weiter, nachdem hier geschossen und vertrieben wurde. Wir rollen von der Brücke. Vor uns tauchen mannshohe Termitenhügel auf.
- Wir sind da! - sagt der Stabsarzt, als ob er auf ein Stichwort gewartet hätte und reicht mir die Kartentasche. Die Karte ist auf russisch. Ich bin im Westen großgeworden und brauchte das nicht zu lernen. Ich lege die Tasche auf den Rücksitz. Er guckt mich von der Seite her an. Ich gucke zurück. Mit fällt nachträglich seine leicht sächsische Klangfarbe auf. Oder thüringisch? Wer kennt sich da schon aus.
- Wo sind wir? -
- An der Grenze! -
Der Inguri ist die Waffenstillstandslinie zwischen Georgiern und Abchasen. Die UNO überwacht das, dafür gibt es UNOMIG. Dazu gehört die Bundeswehr. Die Russen sollen aufpassen, dass niemandem etwas passiert. Das ist ihr Auftrag. Mit zweitausend Mann Friedenstruppen. So heißen sie jedenfalls. Ohne die Russen würde UNOMIG wieder abziehen. Und der Krieg zwischen Georgiern und Abchasen wieder anfangen. So hängt hier eines am anderen.
Ich drehe das Fenster herunter. Es wird jetzt interessant. Qualm von Holzfeuer dringt in den Wagen. Versetzte Balkensperren zwingen uns zum Langsamfahren. Die Termitenhügel entpuppen sich als Schützenpanzer hinter mannshohen Sandsackwällen. Überall Splitterschutzwälle. Die ersten russischen Posten. Pummelig wirkende Gestalten in grüngelbbraunen Kampfanzügen. Wohl jeder mit einem halben Dutzend Pullovern unter der Kampfjacke. Die Jacken mit einem dicken, schwarzen Pelzkragen. Über den Kragen Kindergesichter unter Stahlhelmen. Die Hände an der Kalaschnikow. Wahrscheinlich Wehrpflichtige, achtzehn, neunzehn, manchmal zwanzig Jahre alt. Ich drehe mich um zu meinem Stabsarzt:
- Die können sich gratulieren, dass sie nicht nach Tschetschenien mussten. -
- Von wegen - kommt die Antwort, - das ist hier nicht besser! -
Vielleicht kann man das so sehen. Tschetschenien ist ja nur ein kleines Stück weiter. Gleich auf der anderen Seite des Kaukasus. Die russische Sicherheitszone am Inguri hat es auch so in sich. Die georgischen Partisanen kommen in der Nacht. Sie nennen sich Waldbrüder oder Weiße Legion und geben sich politisch. In Wirklichkeit sind es Banden. Meistens Schmuggel. Aber auch mal Kidnapping oder Raub, wie es gerade so kommt. Sie schießen aus Richtung der Dörfer. Damit die Russen sich scheuen zurückzuschießen. Manchmal scheuen sich die Russen. Manchmal auch nicht. Dann gibt es in den Dörfern Tote. Und die Partisanen haben neue Leute.
Der Stabsarzt sieht herüber. Ich sehe, dass er Falten auf der Stirn hat. Seine Stimme klingt nicht mehr sächsisch oder thüringisch. Fast ein bisschen nach Kasernenhof:
- Bitte Fenster jetzt zu ! Und im Fahrzeug bleiben! -
Ich tue mich schwer, den Ärger über den Tonfall hinunterzuschlucken. Wir fahren langsam im zweiten Gang. Stetig, aber nicht zu schnell. Nur keine hastigen Bewegungen. Ein Gefühl wie damals, wenn man in die DDR fuhr. Mein Stabsarzt grüßt nach draußen; plötzlich ist er wieder freundlich. Ein Offizier mit Tellermütze nickt. Der Stabsarzt ist bekannt, sein Begleiter angemeldet. Nach Papieren wird nicht gefragt. Wir sind UNOMIG. Die Bundeswehr hat zu den Russen beste Beziehungen. Die Russen haben ein Feldlazarett in Suchumi. Man hilft sich gegenseitig.
Wieder eine Slalomsperre aus Balken und nochmals Termitenhügel. Erneut die russischen Soldaten-Kindergesichter über den schwarzen Fellkragen; unsicher wirkende Gesichter, aber die Finger an den Kalaschnikows. Dann sind die Russen vorbei. Wir sind in Abchasien. Hier haben die Abchasen das Sagen. Niemand sonst, außer vielleicht noch den Russen, ihrer Schutzmacht. Jetzt ist das ihr Land, das Land der Abchasen, seitdem sie, das sind die vielleicht siebzigtausend Abchasen, die ursprünglich noch nicht einmal zwanzig Prozent der Bevölkerung stellten, im Unabhängigkeitskrieg gegen Georgien 1992/93 dreihunderttausend Georgier vertrieben haben. Und 1998 noch einmal die Rückkehrer.
Unterwegs nach Suchumi:
Weiter in Richtung Suchumi. Eine Fernstraße in ordentlichem Zustand, kaum Verkehr. Mein Freund im Bundeswehr-Kampfanzug legt ein flottes Tempo vor. An den Seiten Bäume, saftig tiefgrüne Pflanzen, manchmal Palmen. Wir schalten die Heizung aus und öffnen das Fenster einen Spalt. Würzige, feuchte Luft dringt überfallartig herein. Es wächst in Abchasien alles, vom Wein bis zur Baumwolle. Eine Landschaft wie der Garten Eden. Die Pflanzenwelt reich und blühend. Eingebettet zwischen Bergen und Wasser, in weichem, mildem Klima. Das Ganze gekrönt von den weißen Kaukasusgipfeln dreißig bis fünfzig Kilometer nach Nordosten. Vielleicht noch näher, alle Einzelheiten stehen greifbar und scharf gegen den blauen Himmel. Ein paar Kilometer links von uns muss das Schwarze Meer sein. Der Stabsarzt registriert meinen Blick. Er deutet auf einen großen Bau auf einem Hügel abseits der Straße. Vermutlich ein Urlauberheim. Ich sehe, dass die Fenster leer sind. An den Wänden schwarze Brandspuren.
- In der Sowjetzeit hatten die KGB-Größen und die Generäle hier alle ihre Villen. Überall Sanatorien und Gewerkschaftsheime. Fast jeder große Betrieb hatte hier ein Ferienhaus -
- Alles hinüber ? -
Der Stabsarzt zögert einen Moment. Dann antwortet er:
- Das meiste. Kaputtgeschossen und ausgebrannt. Nördlich von Suchumi gibt es noch ein bisschen. Dorthin reisen im Sommer auch wieder die Russen. -
Wir kommen an dem Wrack einer Tankstelle vorbei. Hinter einem Waldstück öffnet sich der Blick auf einen Verschiebebahnhof. Auf den unterbrochenen, an den gesprengten Enden grotesk aufgebogenen Bahngleisen stehen Waggons mit zersplittertem Holz und verbeultem Metall. Dann sind im Vorbeifahren Gebäude zu sehen. Nur wenig ist zerschossen. Doch was zu sehen ist, scheint ausgebrannt, leer, wie ausgesogen und weggeworfen. Die Dächer sind verschwunden, durch die Fensterlöcher kann man den hellen Himmel sehen. Weißer Qualm dringt aus einem Ofenrohr, das seinen Arm durch ein mit Holz vernageltes Fenster steckt. Eine Notunterkunft ? Am Straßenrand rosten schiefgefahrene Hinweisschilder. Die wenigen Verkehrsschilder sind von Kugeln durchsiebt. Am Straßenrand liegen Autowracks, auf das Dach geworfen, einmal sogar ein T 54 mit abgesprengter Kette. Über den Rost wuchern grüne Pflanzenarme. Die Natur will sich ihr Reich zurückerobern.
Dann endlich wieder ein paar hergerichtete Bauten. Ab und zu ein ärmlicher Verkaufsstand an der Straße. Hier und da ein Mensch. Der Anblick schafft Erleichterung. Wir kommen rasch voran. Mein Stabsarzt scheint die Fahrt zu mögen. Es ist erstaunlich, dass die Straße in relativ gutem Zustand ist. Hier haben im Abchasienkrieg 1992/93 Kämpfe zwischen den Georgiern und Abchasen stattgefunden. Die Russen kamen den Abchasen zur Hilfe. Wer dann noch da war, wurde von den Siegern vertrieben. Anschließend kamen die Plünderer. Was noch stand, wurde angezündet. Einfach so zum Spaß; vor allem aber, damit es nicht zu leicht wird für die Flüchtlinge mit dem Wiederkommen.
- Ist das hier überall so ? -
- So ungefähr. Weiter ab im Landesinnern ist es nicht viel besser. Manchmal schlimmer. Da gibt es Dörfer, die sind leergeblieben. Wie bei uns nach dem Dreißigjährigen Krieg. -
Unser Toyota fährt langsamer. Otto, wir haben unterdessen die Vornamen ausgetauscht, sieht angestrengt durch seine Sonnenbrille nach vorn. Ein Lastwagen zieht an den Straßenrand und hält an. An einer Straßenbucht steht eine abchasische Patrouille. Hinter ihnen zwei Ladas, davor ein Wolga mit zwei Antennen. Ein älteres Modell noch aus der sowjetischen Zeit. In ihm vier Männer in Zivil die unbewegt geradeaus blicken. Die Uniformierten aus den Ladas sind ausgestiegen, einer wirbelt einen Leuchtstab in der Hand. Sie treten zur Seite, als sie den weißen Land Cruiser mit der UNOMIG-Aufschrift sehen. Wir fahren im Schritttempo vorbei.
- Was wollen die ? -
- Nichts von uns. Wir sind nichts für die. Die suchen jemanden. Oder sie wollen nur ein paar Rubel. Vielleicht beides. -
Wir durchqueren einen verlassen wirkenden Ort. Wieder gibt es eine Anzahl verschont gebliebener Bauten. Dazwischen ausgebrannte Häuser. Die Straßen sind sauber aufgeräumt, ohne Trümmer oder Schmutz. Ab und zu sind Frauen zu sehen. Manche tragen Kopftücher und bunte Röcke wie auf den Dörfern. Zwei Frauen huschen in einen Eingang, als wollten sie nicht gesehen werden. Ein Gruppe alter Männer mit unendlich viel Zeit an einer Ecke. Dann wieder Ruinen. Es ist, als füllten die Menschen das Bild nicht aus. Wie ein Mann in einem zu groß geschnittener Anzug. Auf dem Platz in der Ortsmitte noch ein Wolga mit den zwei Antennen. Männer in Mänteln darin, die regungslos geradeaus starren.
Dann sind wir wieder auf der Strecke. Wir müssen bald in Gali sein. Geplant ist ein Halt bei den Bundeswehrsoldaten im UNOMIG-Stützpunkt. Anschließend weiter nach Ochamchira. Von dort sind es noch fünfzig Kilometer bis nach Suchumi, wo die abchasische Regierung sitzt. Der schönste Ort am Schwarzen Meer, wenn die Ruinen nicht wären. Es gibt viele Ruinen. Stalin hatte dort seine Lieblingsdatscha. Die steht noch, trotz Krieg. Heute ist sie das Gästehaus der abchasischen Regierung. Die UNO sitzt in Berijas ehemaliger Datscha hoch am Hang über der Stadt. Die ist etwas bescheidener, wenn auch nicht ohne Eleganz mit ihrer großen geschwungenen Holztreppe und den Säulen. Von der Lage her ist sie fast noch schöner. Wenn man die Mühe nicht scheut, von Berijas Datscha noch ein wenig weiter den Berghang hochzusteigen, kommt man an einen der schönsten Aussichtspunkte der ganzen Küste.
Doch bis dahin ist es noch weit. Ich versuche zu dösen, aber die Löcher in der Fahrbahn schlagen allzu heftig ins Kreuz. Die Straße ist längst nicht mehr so gut wie vorhin. Rechts und links wuchert jetzt eine wilde, dichte Vegetation ohne eine Spur menschlicher Tätigkeit. Ich sage meinem Bundeswehrfreund Otto, dass er einen Moment anhalten soll.
- Aber nicht aussteigen! -
- Warum nicht? -
- Minen! -
Ich verzichte auf das Anhalten. Jetzt sehe ich die kleinen dreieckigen Schilder am Straßenrand. Die Warnungen sind auf russisch und englisch. Die Tafeln sind nicht groß. Man muss schon genauer hinsehen. Otto steckt sich eine Zigarette an. Zu fragen hält er nicht für nötig. Ich gönne ihm, dass er sich bei dem Geschüttel die Pfoten verbrennt. Er schlenkert heftig mit seiner rechten Hand, bläst sich auf die lädierten Fingerspitzen. Einen Augenblick scheint er nachzudenken. Dann sagt er, ohne die Fahrbahn aus den Augen zu lassen:
- Vor zwei Tagen hat es hier wieder einem das Bein abgerissen. Einem Mann aus Suchumi auf der Fahrt nach Hause. Mit der Familie im Auto unterwegs. Er wollte nur austreten. -
- Er hätte tot sein können! -
- Tote gibt es bei diesen Minen nicht. Allenfalls wenn es Kinder erwischt. Normalerweise wird immer nur ein Bein abgerissen. Selten beide Beine. Oft sogar nur ein Fuß. -
- Warum? -
- Die Minen sind dafür konstruiert. Wenn es gekracht hat, ist zunächst einmal das Opfer außer Gefecht. Dann kommt ein Helfer. Sogar ein paar Leute sind nötig, wenn der Verletzte abtransportiert wird. So schaltet man nicht nur das Minenopfer aus, sondern bindet zusätzliche gegnerische Kräfte! -
Ich höre schweigend zu. Was sollte man das bezeichnen? Vielleicht Zynismus der Tat? Plötzlich reagiert das Auto heftig. Freund Otto ist eine Spur zu scharf in die Kurve gegangen. Die Reifen jaulen, ein mulmiger Moment, doch problemlos fängt sich der Land Cruiser wieder. Wir fahren nun weniger schnell, stets und unaufhörlich begleitet von der widersprüchlichen Straßenkulisse aus überreicher Natur und den Spuren menschlicher Verwüstung.
Wir erreichen Gali. Die Bundeswehr hat hier ihren Sanitätsstützpunkt. Eigentlich ist er für Verletzte aus der UNOMIG-Truppe da. Aber dort passiert nicht viel. Die sind geschult und haben minengeschützte Fahrzeuge. Und wenn doch etwas passiert, so wie im letzten Herbst bei dem Hubschrauberabschuss, dann braucht man keine Ärzte mehr. Deshalb helfen Stabsarzt Otto und die anderen von der Bundeswehr der Zivilbevölkerung. Nicht nur bei den Minen, sondern überhaupt. Das sind hier ihre Aufgaben. Hier in Abchasien, dem steinernen Land; im Jahre Neun der Unabhängigkeit.
- Wollen Sie sehen? - fragt der Stabsarzt. Er schaltet runter in den dritten Gang und sieht mich schräg von der Seite an. Links liegt das halbverfallene Fort aus der Türkenzeit. Vor uns müsste jetzt die Brücke (Bild) über den Inguri kommen. Die Waffenstillstandslinie.
Ich nicke. Der Mann von der Bundeswehr reißt den Land Cruiser von der Straße auf die Piste, haut den Vierradantrieb rein, stemmt sich in den Sitz. Rambo lässt grüßen. Wir plumpsen in zwei, drei Löcher, schlingern über Schlamm und Panzerspuren, rutschen weg, kommen einem Mauerrest der Türkenfestung zu nahe, gefährlich nahe, torkeln gerade noch knapp auf die freie Seite. Endlich die feste Grasnarbe. Ein kurzer, heftiger Spurt, dann stehen wir mit einem Ruck. Ich unterdrücke mein Dankeschön; es würde seltsam klingen nach diesem verrückten Gewaltritt. Vor uns wie ein eingefriedeter Acker, der Soldatenfriedhof. Mit leichtem Druck öffnet sich die Pforte. Ich gehe auf die Steinplatte zu. Drei Kreuze bilden einen Halbkreis.
- Passen Sie gut auf, dass Sie nicht einsacken, Sie mit Ihren Halbschuhen! - ruft der Uniformierte.
Ich drehe mich um. Er steht in der offenen Tür des Geländewagens; mit verschränkten Armen, den Kampfanzug aufgepeppt mit Halstuch, Sonnenbrille, polierten Schnürstiefel. Wie ein State Trooper aus einer US-Serie. Er klingt nicht gerade freundlich. Ist wohl sauer, dass er mich am Wochenende von Senaki abholen musste. Die UNO-Antonow aus Tiflis hatte Verspätung und außer den verlassenen Bunkern für die zwei Dutzend MIG 29, die in der Sowjetzeit hier stationiert waren, gibt es auf dem Flugplatz nichts. Jedenfalls nichts, was einem Bundeswehrstabsarzt im UNO-Einsatz die Zeit verkürzen könnte. Nur narbiger Asphalt, Ölflecken, wildwachsendes Gras und eine windschiefe Bretterbude. Und natürlich der Blick auf den Kaukasus. Sogar zwei davon: den Großen Kaukasus im Norden und den Kleinen Kaukasus im Süden.
Ich knöpfe den Mantel zu und klappe den Kragen hoch. Er kann mich mal. Es ist blendend hell, ein kalter Wind fegt von den Bergen in die Ebene. Der Wind trägt einen feinen Geruch heran wie von trockenem Gras. An den Viertausendern ist jede Zacke zu erkennen. Die Schneespitzen stechen weiß in einen stählernen Himmel. Als hätte jemand das Bild am Computer bearbeitet. Davor im Vordergrund der Toyota und der Stabsarzt. Wie ein Werbefoto für japanische Geländewagen und auf flott gebürstete Stabsärzte der Bundeswehr bei der UNO. Schöne neue Welt. Ich gehe langsam zurück und wische die Schuhe am Gras ab, bevor ich wieder in den Land Cruiser steige. Die Pforte hat Teerspuren an den Fingern hinterlassen.
- Schon mal hier gewesen? - frage ich, ohne ihn anzusehen.
- Natürlich, wir haben das hier in Ordnung gebracht. -
- So? -
Ich stecke das weg. Mein Zweifel war schlecht gespielt. Natürlich haben die das in Ordnung gebracht, die Leute von der Bundeswehr. Zumindest halten sie die Anlage in Ordnung, nachdem sie einmal angelegt worden ist. In Georgien (Karte) sind zwölftausend Kriegsgefangene gestorben. Nicht nur Deutsche, aber die meisten davon. Ein paar Dutzend liegen hier. Oder Hunderte? Überall im Lande haben sie nach dem Krieg die großen Fabriken und Gebäude gebaut.
Auch die Brücke über den Inguri ist ihr Werk. Die Auffahrt kommt gleich hinter der Türkenfestung, kaum dass wir wieder die feste Straße erreicht haben. Die Brücke ist eine schmale, auf Stein gelagerte Stahlkonstruktion, mit seltsamen pyramidenartigen Aufsetzern an den vier Enden. Kunst am Bau aus der Stalinzeit. Mein Bundeswehrfreund schaltet herunter. Es wird eng. Auf der Fahrbahn liegt eine Schmutzschicht. Wir fahren an einer langen Reihe von Bauern und Frauen mit Körben voller Gemüse vorbei. Ameisenverkehr über die Brücke, kleiner Grenzhandel. Ab und zu ein paar Stangen Zigaretten unter Tomaten und Gurken versteckt. Der richtige Schmuggel, das ist der Schmuggel, der sich wirklich lohnt, der mit den Drogen und Waffen, läuft mit Geländewagen über die Furten weiter nördlich. Er ist in festen Händen, nicht bei Gemüsebauern und Frauen in bunten Röcken.
Dann unter uns sekundenlang der Inguri, ein Flüsschen, an manchen Stellen gerade noch ein Bach, in einem viel zu breiten Flussbett, eingefasst von prallgrüner Vegetation. Im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser kommt, kann er noch lebhaft werden. Sonst hat man ihm das Wasser abgegraben. Georgier und Abchasen teilen sich die Kraftwerke. Das klappt gut; lief sogar weiter, nachdem hier geschossen und vertrieben wurde. Wir rollen von der Brücke. Vor uns tauchen mannshohe Termitenhügel auf.
- Wir sind da! - sagt der Stabsarzt, als ob er auf ein Stichwort gewartet hätte und reicht mir die Kartentasche. Die Karte ist auf russisch. Ich bin im Westen großgeworden und brauchte das nicht zu lernen. Ich lege die Tasche auf den Rücksitz. Er guckt mich von der Seite her an. Ich gucke zurück. Mit fällt nachträglich seine leicht sächsische Klangfarbe auf. Oder thüringisch? Wer kennt sich da schon aus.
- Wo sind wir? -
- An der Grenze! -
Der Inguri ist die Waffenstillstandslinie zwischen Georgiern und Abchasen. Die UNO überwacht das, dafür gibt es UNOMIG. Dazu gehört die Bundeswehr. Die Russen sollen aufpassen, dass niemandem etwas passiert. Das ist ihr Auftrag. Mit zweitausend Mann Friedenstruppen. So heißen sie jedenfalls. Ohne die Russen würde UNOMIG wieder abziehen. Und der Krieg zwischen Georgiern und Abchasen wieder anfangen. So hängt hier eines am anderen.
Ich drehe das Fenster herunter. Es wird jetzt interessant. Qualm von Holzfeuer dringt in den Wagen. Versetzte Balkensperren zwingen uns zum Langsamfahren. Die Termitenhügel entpuppen sich als Schützenpanzer hinter mannshohen Sandsackwällen. Überall Splitterschutzwälle. Die ersten russischen Posten. Pummelig wirkende Gestalten in grüngelbbraunen Kampfanzügen. Wohl jeder mit einem halben Dutzend Pullovern unter der Kampfjacke. Die Jacken mit einem dicken, schwarzen Pelzkragen. Über den Kragen Kindergesichter unter Stahlhelmen. Die Hände an der Kalaschnikow. Wahrscheinlich Wehrpflichtige, achtzehn, neunzehn, manchmal zwanzig Jahre alt. Ich drehe mich um zu meinem Stabsarzt:
- Die können sich gratulieren, dass sie nicht nach Tschetschenien mussten. -
- Von wegen - kommt die Antwort, - das ist hier nicht besser! -
Vielleicht kann man das so sehen. Tschetschenien ist ja nur ein kleines Stück weiter. Gleich auf der anderen Seite des Kaukasus. Die russische Sicherheitszone am Inguri hat es auch so in sich. Die georgischen Partisanen kommen in der Nacht. Sie nennen sich Waldbrüder oder Weiße Legion und geben sich politisch. In Wirklichkeit sind es Banden. Meistens Schmuggel. Aber auch mal Kidnapping oder Raub, wie es gerade so kommt. Sie schießen aus Richtung der Dörfer. Damit die Russen sich scheuen zurückzuschießen. Manchmal scheuen sich die Russen. Manchmal auch nicht. Dann gibt es in den Dörfern Tote. Und die Partisanen haben neue Leute.
Der Stabsarzt sieht herüber. Ich sehe, dass er Falten auf der Stirn hat. Seine Stimme klingt nicht mehr sächsisch oder thüringisch. Fast ein bisschen nach Kasernenhof:
- Bitte Fenster jetzt zu ! Und im Fahrzeug bleiben! -
Ich tue mich schwer, den Ärger über den Tonfall hinunterzuschlucken. Wir fahren langsam im zweiten Gang. Stetig, aber nicht zu schnell. Nur keine hastigen Bewegungen. Ein Gefühl wie damals, wenn man in die DDR fuhr. Mein Stabsarzt grüßt nach draußen; plötzlich ist er wieder freundlich. Ein Offizier mit Tellermütze nickt. Der Stabsarzt ist bekannt, sein Begleiter angemeldet. Nach Papieren wird nicht gefragt. Wir sind UNOMIG. Die Bundeswehr hat zu den Russen beste Beziehungen. Die Russen haben ein Feldlazarett in Suchumi. Man hilft sich gegenseitig.
Wieder eine Slalomsperre aus Balken und nochmals Termitenhügel. Erneut die russischen Soldaten-Kindergesichter über den schwarzen Fellkragen; unsicher wirkende Gesichter, aber die Finger an den Kalaschnikows. Dann sind die Russen vorbei. Wir sind in Abchasien. Hier haben die Abchasen das Sagen. Niemand sonst, außer vielleicht noch den Russen, ihrer Schutzmacht. Jetzt ist das ihr Land, das Land der Abchasen, seitdem sie, das sind die vielleicht siebzigtausend Abchasen, die ursprünglich noch nicht einmal zwanzig Prozent der Bevölkerung stellten, im Unabhängigkeitskrieg gegen Georgien 1992/93 dreihunderttausend Georgier vertrieben haben. Und 1998 noch einmal die Rückkehrer.
Unterwegs nach Suchumi:
Weiter in Richtung Suchumi. Eine Fernstraße in ordentlichem Zustand, kaum Verkehr. Mein Freund im Bundeswehr-Kampfanzug legt ein flottes Tempo vor. An den Seiten Bäume, saftig tiefgrüne Pflanzen, manchmal Palmen. Wir schalten die Heizung aus und öffnen das Fenster einen Spalt. Würzige, feuchte Luft dringt überfallartig herein. Es wächst in Abchasien alles, vom Wein bis zur Baumwolle. Eine Landschaft wie der Garten Eden. Die Pflanzenwelt reich und blühend. Eingebettet zwischen Bergen und Wasser, in weichem, mildem Klima. Das Ganze gekrönt von den weißen Kaukasusgipfeln dreißig bis fünfzig Kilometer nach Nordosten. Vielleicht noch näher, alle Einzelheiten stehen greifbar und scharf gegen den blauen Himmel. Ein paar Kilometer links von uns muss das Schwarze Meer sein. Der Stabsarzt registriert meinen Blick. Er deutet auf einen großen Bau auf einem Hügel abseits der Straße. Vermutlich ein Urlauberheim. Ich sehe, dass die Fenster leer sind. An den Wänden schwarze Brandspuren.
- In der Sowjetzeit hatten die KGB-Größen und die Generäle hier alle ihre Villen. Überall Sanatorien und Gewerkschaftsheime. Fast jeder große Betrieb hatte hier ein Ferienhaus -
- Alles hinüber ? -
Der Stabsarzt zögert einen Moment. Dann antwortet er:
- Das meiste. Kaputtgeschossen und ausgebrannt. Nördlich von Suchumi gibt es noch ein bisschen. Dorthin reisen im Sommer auch wieder die Russen. -
Wir kommen an dem Wrack einer Tankstelle vorbei. Hinter einem Waldstück öffnet sich der Blick auf einen Verschiebebahnhof. Auf den unterbrochenen, an den gesprengten Enden grotesk aufgebogenen Bahngleisen stehen Waggons mit zersplittertem Holz und verbeultem Metall. Dann sind im Vorbeifahren Gebäude zu sehen. Nur wenig ist zerschossen. Doch was zu sehen ist, scheint ausgebrannt, leer, wie ausgesogen und weggeworfen. Die Dächer sind verschwunden, durch die Fensterlöcher kann man den hellen Himmel sehen. Weißer Qualm dringt aus einem Ofenrohr, das seinen Arm durch ein mit Holz vernageltes Fenster steckt. Eine Notunterkunft ? Am Straßenrand rosten schiefgefahrene Hinweisschilder. Die wenigen Verkehrsschilder sind von Kugeln durchsiebt. Am Straßenrand liegen Autowracks, auf das Dach geworfen, einmal sogar ein T 54 mit abgesprengter Kette. Über den Rost wuchern grüne Pflanzenarme. Die Natur will sich ihr Reich zurückerobern.
Dann endlich wieder ein paar hergerichtete Bauten. Ab und zu ein ärmlicher Verkaufsstand an der Straße. Hier und da ein Mensch. Der Anblick schafft Erleichterung. Wir kommen rasch voran. Mein Stabsarzt scheint die Fahrt zu mögen. Es ist erstaunlich, dass die Straße in relativ gutem Zustand ist. Hier haben im Abchasienkrieg 1992/93 Kämpfe zwischen den Georgiern und Abchasen stattgefunden. Die Russen kamen den Abchasen zur Hilfe. Wer dann noch da war, wurde von den Siegern vertrieben. Anschließend kamen die Plünderer. Was noch stand, wurde angezündet. Einfach so zum Spaß; vor allem aber, damit es nicht zu leicht wird für die Flüchtlinge mit dem Wiederkommen.
- Ist das hier überall so ? -
- So ungefähr. Weiter ab im Landesinnern ist es nicht viel besser. Manchmal schlimmer. Da gibt es Dörfer, die sind leergeblieben. Wie bei uns nach dem Dreißigjährigen Krieg. -
Unser Toyota fährt langsamer. Otto, wir haben unterdessen die Vornamen ausgetauscht, sieht angestrengt durch seine Sonnenbrille nach vorn. Ein Lastwagen zieht an den Straßenrand und hält an. An einer Straßenbucht steht eine abchasische Patrouille. Hinter ihnen zwei Ladas, davor ein Wolga mit zwei Antennen. Ein älteres Modell noch aus der sowjetischen Zeit. In ihm vier Männer in Zivil die unbewegt geradeaus blicken. Die Uniformierten aus den Ladas sind ausgestiegen, einer wirbelt einen Leuchtstab in der Hand. Sie treten zur Seite, als sie den weißen Land Cruiser mit der UNOMIG-Aufschrift sehen. Wir fahren im Schritttempo vorbei.
- Was wollen die ? -
- Nichts von uns. Wir sind nichts für die. Die suchen jemanden. Oder sie wollen nur ein paar Rubel. Vielleicht beides. -
Wir durchqueren einen verlassen wirkenden Ort. Wieder gibt es eine Anzahl verschont gebliebener Bauten. Dazwischen ausgebrannte Häuser. Die Straßen sind sauber aufgeräumt, ohne Trümmer oder Schmutz. Ab und zu sind Frauen zu sehen. Manche tragen Kopftücher und bunte Röcke wie auf den Dörfern. Zwei Frauen huschen in einen Eingang, als wollten sie nicht gesehen werden. Ein Gruppe alter Männer mit unendlich viel Zeit an einer Ecke. Dann wieder Ruinen. Es ist, als füllten die Menschen das Bild nicht aus. Wie ein Mann in einem zu groß geschnittener Anzug. Auf dem Platz in der Ortsmitte noch ein Wolga mit den zwei Antennen. Männer in Mänteln darin, die regungslos geradeaus starren.
Dann sind wir wieder auf der Strecke. Wir müssen bald in Gali sein. Geplant ist ein Halt bei den Bundeswehrsoldaten im UNOMIG-Stützpunkt. Anschließend weiter nach Ochamchira. Von dort sind es noch fünfzig Kilometer bis nach Suchumi, wo die abchasische Regierung sitzt. Der schönste Ort am Schwarzen Meer, wenn die Ruinen nicht wären. Es gibt viele Ruinen. Stalin hatte dort seine Lieblingsdatscha. Die steht noch, trotz Krieg. Heute ist sie das Gästehaus der abchasischen Regierung. Die UNO sitzt in Berijas ehemaliger Datscha hoch am Hang über der Stadt. Die ist etwas bescheidener, wenn auch nicht ohne Eleganz mit ihrer großen geschwungenen Holztreppe und den Säulen. Von der Lage her ist sie fast noch schöner. Wenn man die Mühe nicht scheut, von Berijas Datscha noch ein wenig weiter den Berghang hochzusteigen, kommt man an einen der schönsten Aussichtspunkte der ganzen Küste.
Doch bis dahin ist es noch weit. Ich versuche zu dösen, aber die Löcher in der Fahrbahn schlagen allzu heftig ins Kreuz. Die Straße ist längst nicht mehr so gut wie vorhin. Rechts und links wuchert jetzt eine wilde, dichte Vegetation ohne eine Spur menschlicher Tätigkeit. Ich sage meinem Bundeswehrfreund Otto, dass er einen Moment anhalten soll.
- Aber nicht aussteigen! -
- Warum nicht? -
- Minen! -
Ich verzichte auf das Anhalten. Jetzt sehe ich die kleinen dreieckigen Schilder am Straßenrand. Die Warnungen sind auf russisch und englisch. Die Tafeln sind nicht groß. Man muss schon genauer hinsehen. Otto steckt sich eine Zigarette an. Zu fragen hält er nicht für nötig. Ich gönne ihm, dass er sich bei dem Geschüttel die Pfoten verbrennt. Er schlenkert heftig mit seiner rechten Hand, bläst sich auf die lädierten Fingerspitzen. Einen Augenblick scheint er nachzudenken. Dann sagt er, ohne die Fahrbahn aus den Augen zu lassen:
- Vor zwei Tagen hat es hier wieder einem das Bein abgerissen. Einem Mann aus Suchumi auf der Fahrt nach Hause. Mit der Familie im Auto unterwegs. Er wollte nur austreten. -
- Er hätte tot sein können! -
- Tote gibt es bei diesen Minen nicht. Allenfalls wenn es Kinder erwischt. Normalerweise wird immer nur ein Bein abgerissen. Selten beide Beine. Oft sogar nur ein Fuß. -
- Warum? -
- Die Minen sind dafür konstruiert. Wenn es gekracht hat, ist zunächst einmal das Opfer außer Gefecht. Dann kommt ein Helfer. Sogar ein paar Leute sind nötig, wenn der Verletzte abtransportiert wird. So schaltet man nicht nur das Minenopfer aus, sondern bindet zusätzliche gegnerische Kräfte! -
Ich höre schweigend zu. Was sollte man das bezeichnen? Vielleicht Zynismus der Tat? Plötzlich reagiert das Auto heftig. Freund Otto ist eine Spur zu scharf in die Kurve gegangen. Die Reifen jaulen, ein mulmiger Moment, doch problemlos fängt sich der Land Cruiser wieder. Wir fahren nun weniger schnell, stets und unaufhörlich begleitet von der widersprüchlichen Straßenkulisse aus überreicher Natur und den Spuren menschlicher Verwüstung.
Wir erreichen Gali. Die Bundeswehr hat hier ihren Sanitätsstützpunkt. Eigentlich ist er für Verletzte aus der UNOMIG-Truppe da. Aber dort passiert nicht viel. Die sind geschult und haben minengeschützte Fahrzeuge. Und wenn doch etwas passiert, so wie im letzten Herbst bei dem Hubschrauberabschuss, dann braucht man keine Ärzte mehr. Deshalb helfen Stabsarzt Otto und die anderen von der Bundeswehr der Zivilbevölkerung. Nicht nur bei den Minen, sondern überhaupt. Das sind hier ihre Aufgaben. Hier in Abchasien, dem steinernen Land; im Jahre Neun der Unabhängigkeit.