Allein
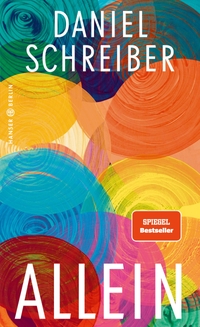
Hanser Berlin, Berlin 2021
ISBN
9783446267923
Gebunden, 160 Seiten, 20,00
EUR
Klappentext
Zu keiner Zeit haben so viele Menschen allein gelebt, und nie war elementarer zu spüren, wie brutal das selbstbestimmte Leben in Einsamkeit umschlagen kann. Aber kann man überhaupt glücklich sein allein? Und warum wird in einer Gesellschaft von Individualisten das Alleinleben als schambehaftetes Scheitern wahrgenommen? Im Rückgriff auf eigene Erfahrungen, philosophische und soziologische Ideen ergründet Daniel Schreiber das Spannungsverhältnis zwischen dem Wunsch nach Rückzug und Freiheit und dem nach Nähe, Liebe und Gemeinschaft. Dabei leuchtet er aus, welche Rolle Freundschaften in diesem Lebensmodell spielen: Können sie eine Antwort auf den Sinnverlust in einer krisenhaften Welt sein?
BuchLink. In Kooperation mit den Verlagen (
Info)
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 20.11.2021
Rezensentin Melanie Mühl versteht die Freuden und Leiden des Alleinseins besser mit Daniel Schreibers Essay. Der Autor, weiß wovon er schreibt, glaubt Mühl, und er weiß, den Blick zu weiten, indem er Texte von Illouz, Solnit, Bourdieu oder Derrida rezipiert. Vor welchen Herausforderungen der alleinstehende Mensch steht, welche Strategien ihm zur Verfügung stehen und wo Fallstricke lauern, erläutert der Autor laut Mühl auch anhand eigener Erfahrungen. Die Mischung aus Privatem und allgemeinen Erwägungen im Buch findet sie überzeugend.
Lesen Sie die Rezension bei
buecher.de
Rezensionsnotiz zu
Die Zeit, 18.11.2021
Geradezu beglückt berichtet Rezensentin Susanne Mayer von der emotionalen Präzision, mit der Damiel Schreiber das gern gemiedene Thema des Alleinseins erkundet. Dem setzt er sich gleich in der ersten Szene des Buchs aus, die mit einem "Wir" beginnt, zu dem der Autor nicht gehört, so Mayer, - oder doch? Aber wenn, dann nur als der gute Freund. Mayer stellt Schreibers Buch in die Tradition großer amerikanischer Essayistik von Autoren wie Joan Didion oder Leslie Jameson. Von ihnen habe er gelernt, "wo man Schmerz anfasst". Mayer liest das Buch auch als Beobachtung eines gesellschatlichen Wandels zurück in ein neues Biedermeier. Wann genau wurden Paar und Kleinfamilie wieder zum Leitbild unserer gut abgepolsterten Gesellschaft? Und wo ist er hin, "der Schwung der wilden Sechziger"?
Rezensionsnotiz zu
Deutschlandfunk Kultur, 22.10.2021
Kim Kindermann staunt über die Offenheit, mit der Daniel Schreiber über sein Leben als schwuler Single-Mann schreibt, über das Alleinsein in der Corona-Zeit und das Reiben am Ideal der Familie, über Stricken, Essstörungen, Stolz, Stigma und Hoffnungslosigkeit. Auch wenn Kindermann das Buch teilweise überfrachtet erscheint, eitel ist es nicht, versichert sie. Indem der Autor von allerhand soziologischen, philosophischen und literarischen Lektüren immer wieder auf seine eigene Person zurückkommt, sorgt er laut Kindermann für eine Anteilnahme, die den Leser letztlich bei sich selbst und seiner Wahrnehmung landen lässt.
Rezensionsnotiz zu
Süddeutsche Zeitung, 30.09.2021
Rezensent Alex Rühle ist froh, dass Daniel Schreiber keinen Lebensratgeber verfasst hat, sondern das eigene Unvermögen und die Scham nicht versteckt. Es geht ums Alleinsein mit und ohne Pandemie in diesem Buch, und darum, wie es gelingt, erklärt der Rezensent. Wie der Autor essayistisch Biografisches mit Exemplarischem verbindet, wenn er den Wert von Beziehungen erkundet und das Leiden an der Einsamkeit, findet Rühle lesenswert. Die vielfältigen soziologischen und philosophischen Bezüge im Text empfindet Rühle als wärmend wie einen Mantel gegen das Einsamsein.
Rezensionsnotiz zu
Die Tageszeitung, 25.09.2021
Rezensentin Nina Apin hat erst Sorge, dass Daniel Schreibers Essay über die Einsamkeit während der Pandemie nicht aus den Gefilden des White Privilege findet, gibt dann aber schnell Entwarnung. Denn Schreiber reise zur Besinnung zwar auch mal nach Luzern oder Lanzarote, reflektiere seine Situation als bürgerlicher weißer Akademiker aber ebenso wie deren literarische Verarbeitung, erkennt Apin an. Außerdem gefällt ihr die "angloamerikanisch" anmutende Lockerheit, mit der Schreiber hier Persönliches mit Theoretischem und Gesellschaftspolitischem verbinde. Wie unter dem "Schutzmantel des kosmopolitischen Großstadtintellektuellen" hier queere Scham und Einsamkeit zum Vorschein kommen, ruft bei der Kritikerin nicht zuletzt Unbehagen hervor und auch Zweifel über Konzepte wie "Self Care", die ein gutes Leben versprechen, schließt Apin nachdenklich.
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)