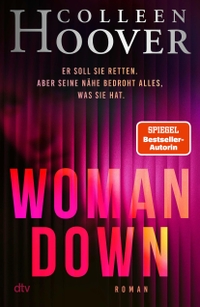Essay
Engagement
Wie man sich gegen seine 68-er Lehrer einen Begriff des Engagements erobert. Von Georg M. Oswald
27.07.2002. "Meine Lehrer hatten es auch nicht so mit Sartre. Zuviel Glamour, zuviel Kettenraucherei, zuviel Nachtclub war ihnen da im Spiel." Georg M. Oswald erzählt, wie er sich gegen seine 68-er Lehrer einen Begriff des Engagements eroberte. I.
Als ich Siebzehn war, ließ ich mir die bis zur Schulter reichenden Haare auf Streichholzlänge schneiden und trug von da an nur noch schwarze Rollkragenpullover, Röhrenjeans und spitze Schuhe. Das war 1980. Mein Kunstlehrer, ein löwenmähniger Beau, der damals sogenannte Indien-Hemden anhatte, gratulierte mir irritiert-ironisch zu meinem "restaurativen Haarschnitt", was mir bewies, dass meine Emanzipation einen Schritt vorangekommen war. Ich wollte nicht länger ein jugendlicher Nachfahr jener Hippie- oder auch 68er-Generation sein, die mich so schwer enttäuscht hatte. Ich spreche hier nicht von irgendeiner allgemeinen, theoretischen oder sonstwie unpersönlichen Enttäuschung. Mein Deutschlehrer, ein gewisser Herr B., der mich auf dem Luisengymnasium unterrichtete, hatte mir mit Brecht beigebracht, dass die Wahrheit konkret sei. Und wenn ich es von heute aus besehe, hatte meine Wandlung mindestens einen ganz handfesten Anlass, der sich kurz zuvor ereignet hatte.
Herr B., der neben Deutsch auch Englisch, Geschichte und Ethik unterrichtete und als Funktionär der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fungierte, war das ganze Jahr hindurch braungebrannt wie ein Schlagersänger und hatte eine beneidenswert volle Mittelscheitelfrisur. Er nahm einige Kollegstufler, die sich in der SMV genannten Schülermitverwaltung im Stil der Zeit revolutionär engagierten, unter seine Fittiche. Herrn B.s revolutionäres Engagement gipfelte allerdings darin, den achtzehnten Geburtstag der allseits begehrten Kollegiatin Manuela S., auch SMV, abzupassen, um sie dann flugs zu vögeln. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich dabei war, als es passierte. Bald nach Manuela S.' achtzehntem Geburtstag waren wir beim schönen B. zuhause zum Abendessen eingeladen. Wir kochten Paella, hörten Biermann und anrührende südamerikanische Revolutionsmusik. Wir, das waren eben jene vier oder fünf "politisch Bewussten" des Luisengymnasiums, die politische Elite, wie wir dachten, alles Jungs, außer Manuela, an denen B. sein revolutionäres Werk verrichtete. Nach dem Essen entwarfen wir ein Flugblatt gegen das neue Erziehungsgesetz, das, wie wir annahmen, eine raffinierte Finte des Kultusministeriums darstellte, um ein faschistisches Schulsystem zu etablieren. B. schenkte Wein nach, und wir schmolzen, schon völlig weich in der Birne, dahin, als Biermann sang, von der bitteren Wahrheit der Unidad Popular. Bei ihm zuhause dürften wir ihn duzen, raunte uns B. etwas später bei Kerzenlicht zu, nicht in der Schule, das ginge aus verständlichen Gründen nicht. Mensch du, B., denke ich noch heute, und erinnere mich, wie der Abend endete. Wir, die Jungs, bezogen ein Matratzenlager in B.s Arbeitszimmer. Dort durften wir seine Marx-Engels-Werke Gesamtausgabe bewundern, die blaue, aus dem ostdeutschen Dietz Verlag. Wer die hatte, konnte es nur ernst meinen. Als ich vom Zähneputzen in das Arbeitszimmer ging, sah ich durch den Türspalt im Wohnzimmer, wie Manuela auf einer Matratze am Boden liegend ihre Brust entblößte und B. sie küsste. Als ich mich zwischen die anderen ins Dunkel von B.s Arbeitszimmer legte, fragte ich mich, ob so ein alter Sack denn schon ein Held der Revolution war, nur weil er seinen Schwengel nicht unter Kontrolle hatte. Immerhin war Herr B. verheiratet. Mir war klar, dass das ein zutiefst bürgerlicher Einwand war, aber war Herr B. als politischer Nonkonformist geadelt, nur weil er auch vor arglosen Schülerinnen nicht Halt machte? Ich erstickte fast in der testosterongeschwängerten Luft des Arbeitszimmers, umzingelt von den Schatten der MEW-Gesamtausgabe und vier weiteren einsamen kommunistischen Schwänzen.
II.
Zu dieser Zeit ging ich am Nachmittag gerne ins "Cafe Größenwahn" in Haidhausen, um zu lesen. Dort trafen sich Leute, die sich auf irgendwie neue Art mit Musik, Kunst und Literatur beschäftigten. Vereinzelt trauten sich auch Langhaarige dorthin, die noch nicht eingesehen hatten, dass ihre Zeit vorüber war. Eines Tages saß ich dort - kurze Haare, schwarzer Rollkragenpullover, Röhrenjeans, spitze Schuhe - und hatte eines jener kleidsamen rot-schwarzen Rowohltbändchen zur Hand, als mich ein älterer Langhaariger vom Nebentisch herüber ansprach.
"Die Haare müsste man euch wachsen lassen", maulte er und fragte dann: "Was liestn da?"
"'Der Ekel' von Sartre" antwortete ich wahrheitsgemäß.
"Lies lieber was Gescheites", sagte er.
III.
Meine Lehrer hatten es auch nicht so mit Sartre. Zuviel Glamour, zuviel Kettenraucherei, zuviel Nachtclub war ihnen da im Spiel.
Herr B. sagte einmal im Ethikunterricht, er halte Antoine Roquentin, den Helden von Sartres "Der Ekel", für einen wildgewordenen Spießbürger. Als solcher sei er zwar nicht mehr als bewusstloser Repräsentant der herrschenden Klasse zu betrachten, aber seine Träume seien die eines Anarchisten, nicht die eines Revolutionärs, dessen Handeln einem übergeordneten Plan folge. Ich erinnere mich nicht mehr, ob Herr B. Manuela schon gevögelt hatte, als er das sagte.
Ich mochte Roquentin. Wie jedem, der sich auf die Sprache einlässt, war ihm nichts mehr selbstverständlich. Er beobachtete seine Umgebung, analysierte sie. Er hatte den Bösen Blick. Nichts entging ihm. Das war eine gute Methode, sich Distanz zur Welt zu verschaffen. Und die wünschte ich mir.
IV.
Als Jean Paul Sartre am 19. April 1980 auf dem Friedhof Montparnasse beigesetzt wurde, folgten seinem Sarg 50.000 Menschen. Ich fand ein Foto davon in irgendeiner Zeitung, das mich überwältigte. Die Tatsache, dass ein Schriftsteller mit seiner Arbeit eine derart bewegende Anteilnahme auslösen konnte, schien mir geradezu unglaublich. Weil ich damals von Sartre nur wenig gelesen hatte, dachte ich, die Trauergäste folgten seinem Sarg um Antoine Roquentins willen. Ich fand die Vorstellung zauberhaft, dass jemand, der einen so einsamen, oft abstossenden, ungemütlichen Helden erfunden hatte, sich solcher Zuwendung erfreuen durfte. Ich erfuhr bald, dass er noch einiges andere geschrieben hatte.
V.
Bestimmt zwei Jahre lang las ich überhaupt nichts anderes mehr als Sartre. Großartig an ihm war unter anderem, dass meine 68er-Lehrer ihn nicht wirklich gut kannten. Bei ihnen lasen wir Brecht und Brecht und Brecht und natürlich auch ein paar andere Sachen, aber je linker der Lehrer, desto mehr Brecht in seinem Unterricht, das war die Faustregel, nach der man gehen konnte. Ich mochte Brecht und las ihn gern. Aber wie ein Schriftsteller der Gegenwart aussehen sollte, konnte man sich an Brecht nicht mehr vorstellen. Eher schon an Sartre.
VI.
Sartre lieferte Jahrzehntelang das Grundmuster, nach dem ein Schriftsteller aufzutreten hatte, der seiner Tätigkeit gesellschaftliche Bedeutung zuschrieb. Der Begriff des Engagements spielte dabei die zentrale Rolle schlechthin.
Will es ein Begriff in der Welt der Literatur zu etwas bringen, darf man ihm eines unter keinen Umständen nachsagen können: Eindeutigkeit. Wie nichts anderes erzeugt Eindeutigkeit Langeweile, und die ist das einzige, was in der Literatur verboten ist. So betrachtet, war dem "Engagement" zu Beginn seiner Tage eine glänzende Zukunft sicher. In den ersten Jahren war, was "Engagement" war und was nicht, stets seinem Erfinder abzulauschen. Sartre veröffentlichte ungezählte Interviews, Essays, Briefe und andere Schriften, in denen er, manchmal dunkel raunend, manchmal funkelnd brillant, erläuterte, was "Engagement" bedeutete: nämlich immer etwas anderes.
Solange "Engagement" seinen gewandtesten Interpreten hatte, musste man sich um beide keine Sorgen machen. Nach Sartres Tod und seiner in den Achtziger Jahren vollzogenen Entthronisierung als Meisterdenker, sollte es auch mit dem Engagement bergab gehen.
In Deutschland war der Begriff in literarischen Zusammenhängen durch das Böll-Grass'sche Mahnwesen der Siebziger und frühen Achtziger Jahre besetzt, und folglich verband man mit ihm vor allem den direkten Eingriff des Literaten in "die Politik". Auf welche Weise, versinnbildlicht am schönsten jenes berühmt gewordene Foto, auf dem der greise, baskenbemützte Heinrich Böll mit sorgenvollem Blick, umringt von anderen Demonstranten, in Mutlangen den Sitzstreik praktiziert.
"Engagement" als literarischer Begriff unterschied sich also nicht wesentlich von dem, was man in den einschlägigen Kreisen überhaupt damit verband, nämlich "politisch was zu machen". Heinrich Böll war nun nie so weit gegangen, Gebrauchslyrik für Flugblätter zu verfassen, Erich Frieds Gedichte taugten zu diesem Zweck aber ausgezeichnet, und vielleicht ist es wirklich der Letztgenannte, der den engagierten Dichter deutscher Sprache in den Achtzigern wie kein anderer verkörpert hat.
Der literarische Engagementbegriff verlor in dem Maß an Interesse, indem er verflachte. Ein engagierter Schriftsteller war einer, der sich politisch betätigte, basta. Es spielte keine Rolle, ob er sich dabei seiner Fähigkeiten als Schreiber bediente oder ob er als Demonstrant auftrat. Ob er nebenher noch Romane, Gedichte oder Theaterstücke verfasste, war daneben nicht von Belang.
VII.
Und dann war da ja auch noch Adorno. In den "Noten zur Literatur" findet sich ein "Engagement" überschriebener Essay, der 1962 sowohl als Radiovortrag als auch in "Die Neue Rundschau" veröffentlicht worden war. Zwanzig Jahre vor der kompletten Vulgarisierung des Begriffs hatte Adorno schon sein Letztes Wort zum Engagement gesprochen. "Den autonomen Werken aber sind solche Erwägungen (die für das engagierte Kunstwerk sprechen, Anm. d. Verf.), und die Konzeption von Kunst, die sie trägt, selber schon die Katastrophe, vor der die engagierten den reinen Geist warnen."
Ich las diesen Aufsatz erstmals Mitte Zwanzig, in den späten Achtzigern, und da kam er mir auf unvorhergesehene Weise zupass.
Jenes beschränkte Verständnis von Engagement, das Literatur lediglich als ein eher ungeeignetes Mittel zu politischer Betätigung ansah, war mir vollkommen unerträglich.
Heute mehr als damals aber frage ich mich, was Adorno genau meint, wenn er von "autonomen Werken" und über "den reinen Geist" spricht. Auch wenn man mit ihm theoretisch zwischen Tendenz - der platten Parteinahme für welches politische Ziel auch immer - und Engagement unterscheidet, bleibt offen, zu welcher Zeit an welchem Ort und, das vor allem, in welcher Gesellschaft sich ein autonomes Werk von reinem Geist denken ließe. Auch wenn richtig ist, dass "der Rang der Werke, wie schon Hegel wusste, steigt, je weniger sie in der Person verhaftet bleiben, die sie hervorbringt", leuchten mir Autonomie und Reinheit allenfalls als unerreichbare Ideale ein, von denen ich noch nicht einmal weiß, ob sie erstrebenswert sind, weil ich nicht erkennen kann, was sie bedeuten. Ich bin sicher, es gibt eine große Zahl sehr kluger Leute, die mich darüber belehren könnten. Ich aber würde gerne nur ein einziges autonomes Werk von reinem Geist genannt bekommen - und ich bin sicher, ich könnte den Gegenbeweis führen, der da lautete, das Werk ist zutiefst in der Person seines Autors, der Zeit und der Gesellschaft in der er lebte verhaftet, und nur, weil es darüber hinausgeht, ist es große Kunst.
VIII.
Heute hängt dem Engagementbegriff der ganze Mief an, der sich jahrzehntelang in viel zu vielen Diskussionen über ihn angesammelt hat. Aber nicht, dass er abgestanden ist, etwas anderes hat ihm den Rest gegeben, der Zusammenbruch der alten, antagonistischen Weltordnung nämlich. Das engagierte Kunstwerk hielt jenem, das mit Adorno nichts wollte "denn da sein", vor, "es lenke ab vom Kampf der realen Interessen. Keinen mehr schone der Konflikt der beiden großen Blöcke." Seit es diese Blöcke nicht mehr gibt, sollte also eigentlich die Bahn frei sein für die autonome Kunst von reinem Geist. Bedauerlicher Weise scheint aber gerade in diesen Tagen das öffentliche Bedürfnis danach so gering wie selten zuvor.
Es ließe sich freilich einwenden, man solle das öffentliche Bedürfnis den dafür vorhandenen Anstalten überlassen. Literatur sei schon immer die Sache einiger Weniger gewesen, es bestehe kein Anlass zu vermuten, dass dies je anders werden würde.
Dennoch, seit Beginn der Neunziger Jahre hat sich in der literarischen Szene in Deutschland ein Kulturpessimismus breit gemacht, der nur damit zu erklären ist, dass man befürchtet, die Literatur verliere unaufhaltsam an Bedeutung.
IX.
Früher nämlich, als es die Blöcke noch gab, hatte die Beschäftigung mit Literatur eine konkrete gesellschaftliche Funktion. In einer bestimmten Schicht - etwa Herr B. und Konsorten - war es verbreitete Übung, sich durch das Besitzen und Zurschaustellen von Büchern, gelegentlich auch durch deren Lektüre, als dissident oder doch zumindest "kritisch" zu präsentieren. Sich mit Literatur zu befassen, versprach einen für jedermann verständlichen Distinktionsgewinn. Gerade, wer es sich - wie und aus welchen Gründen auch immer - im Kapitalismus der westlichen Hemisphäre bequem gemacht hatte, musste demonstrieren, dass er durchaus auch für das Höhere empfänglich war, und dafür waren Kunst und Literatur sehr geeignet.
Seit Beginn der Neunziger Jahre sind sich die Deutschen bewusst geworden, dass es der kulturellen Verbrämung des Kapitalismus nicht länger bedarf. Kultur, so sie von Interesse sein soll, muss von diesem neuen Bewusstsein zeugen. Ein Beispiel unter anderen hierfür ist die "Entdeckung" der sogenannten neuen deutschen Literatur von 1995 bis 2001.
X.
In jüngster Zeit wendet sich der literarische Betrieb mit überdrüssigem Grausen von seinem eben noch gefeierten jüngsten Homunkulus, dem deutschen Jungautor. Mitleid ist nicht angezeigt, denn es ging bei seiner Erschaffung nur um den Beweis, dass auch der "junge deutsche Autor" - die "junge deutsche Autorin" - zum Markenartikel hochgeschrieben und -produziert werden kann, wie der "amerikanische Schriftsteller", der "lateinamerikanische Geschichtenerzähler", der "skandinavische Krimiprofi", der "französische Skandalautor", und so fort. In seinem Aufsatz "Von der Berufung zum Schriftsteller" schreibt Sartre: "Das Bürgertum hat eine solche Angst vor dem Negativen, dass es es sich mit allen Mitteln verhehlt: den Schriftsteller sieht es als ein Rädchen der Buchindustrie, er ist der Erfinder oder Einrichter der Muster." Das ist, zugegeben, nicht mehr ganz zeitgemäß formuliert, im Kern aber nach wie vor richtig. Wenn wir statt "Bürgertum" "Markt" sagen, sind wir schon näher dran. Und natürlich wird das Erfinden und Einrichten der Muster heute nicht mehr dem Schriftsteller allein überlassen, dem alsbald Werber und Agenten als spin doctors zur Seite stehen. Doch das sind nur Nuancen, die der Optimierung des von Sartre beschriebenen Zwecks dienen. Das Neue an der neuen deutschen Literatur zwischen 1995 und 2001 war, dass sie im Unterschied zu den vorangegangenen Jahrzehnten ihren Warencharakter affirmierte und sich damit zurück ins (ökonomische) Spiel brachte.
Zwar ist es heute üblich, ästhetische und ökonomische Kriterien zur Bewertung von Literatur zu vermengen, neu ist aber auch das nicht. In dem erwähnten Aufsatz spricht Sartre von der "geschickten Gleichsetzung von Roman und Gedicht mit dem Band, der sie trägt". Dass hier ein Unterschied ums Ganze unterschlagen wird, gilt vielen heute womöglich als Haarspalterei. Den sonst vielleicht unter Immobilienmaklern beliebten Jubelruf "Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg" dürfen heute auch Autoren und ihre Teams anstimmen, ohne um ihren guten Ruf fürchten zu müssen.
Das schlechte Gewissen, das quälende Bewusstsein, dass all dieses eitel im Andreas Gryphius'schen Sinn ist, lässt sich aber nicht ganz verdrängen. Gerade recht kommt da Heinz Schlaffers "Die Kurze Geschichte der deutschen Literatur", die uns in knappen Worten bescheidet, dass alles, was in Deutschland seit 1950 geschrieben wurde und werde, ohnehin keine Aussicht mehr habe, in den Kanon zu gelangen.
XI.
Für einen Zeitgenossen, der sich entschlossen hat, Schriftsteller zu sein, ist dies natürlich ein unmöglicher Standpunkt. Aber wer sich heute im Bewusstsein, dass es einen Homer gegeben hat, hinsetzt, um einen Roman zu schreiben, der wird auch vor Heinz Schlaffer nicht die Feder sinken lassen. Der Pulitzerpreisträger John Cheever schrieb 1961 in sein Tagebuch: "Es hat weder Sinn, mich mit unbedeutenden Injurien aufzuhalten (...), noch zu versuchen, festzustellen, welche Rolle die Vergangenheit in meinen allzu leicht verletzlichen Gefühlen spielt. Stellen muss ich mich allerdings der geringen Zahl und der Minderwertigkeit der Werke, die ich bis jetzt produziert habe. Weder der Roman noch das Stück haben in irgendeiner Weise Form, Gestalt oder Substanz. Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde, als unbedeutender Schriftsteller in die Geschichte einzugehen, der sein Talent mit Trunkenheit, Faulheit, Zorn und Gereiztheit verschwendet hat. Ich habe es nicht mehr mit den üblichen Nachteilen der Bedürftigkeit zu tun, einem schlecht beleuchteten Zimmer oder Bauchschmerzen. Ich habe es mit der Zeit zu tun, mit dem Alkohol und dem Tod." Man muss kein verzweifelter neunundvierzigjähriger Alkoholiker sein, um zu begreifen, dass die Frage nach der eigenen Bedeutung für die Wahl, Schriftsteller zu werden, nicht von Belang ist.
XII.
Diese Wahl nämlich ist eine Frage des Engagements, so wie ich den Begriff heute verstehe.
Sartre zufolge sind wir es gewohnt anzunehmen, Schriftsteller werde, wer dazu besonders begabt ist. In dem erwähnten Aufsatz "Von der Berufung zum Schriftsteller" sagt er: "Ich glaube nicht an Begabung. Das bedeutet nicht, dass jeder Beliebige zu jeder beliebigen Zeit beschließen kann zu schreiben. Sondern dass die Literatur wie die Homosexualität einen virtuellen Ausweg darstellt, den man in bestimmten Situationen findet und der in anderen nicht einmal erwogen wird, weil er von keinerlei Hilfe wäre. Wenn man nicht gut schreibt, so haben einen die Umstände nicht dazu gebracht, sein Heil in die Wörter zu legen." Sein Heil aber legt in die Wörter, wer sich in der Unmöglichkeit zu Leben befindet. Das klingt sehr pathetisch, ist aber existentiell.
Das Eingangskapitel des vorliegenden Textes liest sich heute vielleicht als witzige Geschichte. Ich selbst fand sie damals gar nicht komisch, weil ich auf der Suche war und nicht verstand, was all das zu bedeuten hatte. Aber ich hatte mich Leuten angeschlossen, die ihre Sache viel weniger wichtig nahmen, als ihre Hormone. Das ist verzeihlich, gewiss, aber mir half es nicht weiter. Erlebnisse wie diese haben mich dazu gebracht, mein Heil in die Wörter zu legen. Das ist vielleicht zum Lachen, aber es war die einzige Möglichkeit, mir eine Welt vom Hals zu halten, die ich lächerlich fand. Und mein armer Deutschlehrer Herr B. ist dafür, das will ich zugeben, nicht ganz allein verantwortlich.
Jeder, der sein Heil in die Wörter legt, ist engagiert. "Wenn die Literatur nicht alles ist, ist sie nicht der Mühe wert", sagte Sartre 1960 in dem berühmten Interview "Literatur als Engagement für das Ganze". Kann sein, dass dies, auf die zeitgenössische Literatur bezogen, erfahrenen Branchenrittern und eitlen Kulturpessimisten nur ein müdes Lächeln entlockt. Der Schriftsteller aber muss dran glauben.
*
Wir entnehmen diesen Essay der neuen Nummer der Zeitschrift Akzente über "Tradition" und danken dem Hanser Verlag für die Publikationsgenehmigung. (D. Red.)
Georg M.Oswald, geboren 1963 in München, lebt dort als Schriftsteller und Rechtsanwalt. Zuletzt erschien: "Alles was zählt" (Hanser, 2000).
Als ich Siebzehn war, ließ ich mir die bis zur Schulter reichenden Haare auf Streichholzlänge schneiden und trug von da an nur noch schwarze Rollkragenpullover, Röhrenjeans und spitze Schuhe. Das war 1980. Mein Kunstlehrer, ein löwenmähniger Beau, der damals sogenannte Indien-Hemden anhatte, gratulierte mir irritiert-ironisch zu meinem "restaurativen Haarschnitt", was mir bewies, dass meine Emanzipation einen Schritt vorangekommen war. Ich wollte nicht länger ein jugendlicher Nachfahr jener Hippie- oder auch 68er-Generation sein, die mich so schwer enttäuscht hatte. Ich spreche hier nicht von irgendeiner allgemeinen, theoretischen oder sonstwie unpersönlichen Enttäuschung. Mein Deutschlehrer, ein gewisser Herr B., der mich auf dem Luisengymnasium unterrichtete, hatte mir mit Brecht beigebracht, dass die Wahrheit konkret sei. Und wenn ich es von heute aus besehe, hatte meine Wandlung mindestens einen ganz handfesten Anlass, der sich kurz zuvor ereignet hatte.
Herr B., der neben Deutsch auch Englisch, Geschichte und Ethik unterrichtete und als Funktionär der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fungierte, war das ganze Jahr hindurch braungebrannt wie ein Schlagersänger und hatte eine beneidenswert volle Mittelscheitelfrisur. Er nahm einige Kollegstufler, die sich in der SMV genannten Schülermitverwaltung im Stil der Zeit revolutionär engagierten, unter seine Fittiche. Herrn B.s revolutionäres Engagement gipfelte allerdings darin, den achtzehnten Geburtstag der allseits begehrten Kollegiatin Manuela S., auch SMV, abzupassen, um sie dann flugs zu vögeln. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich dabei war, als es passierte. Bald nach Manuela S.' achtzehntem Geburtstag waren wir beim schönen B. zuhause zum Abendessen eingeladen. Wir kochten Paella, hörten Biermann und anrührende südamerikanische Revolutionsmusik. Wir, das waren eben jene vier oder fünf "politisch Bewussten" des Luisengymnasiums, die politische Elite, wie wir dachten, alles Jungs, außer Manuela, an denen B. sein revolutionäres Werk verrichtete. Nach dem Essen entwarfen wir ein Flugblatt gegen das neue Erziehungsgesetz, das, wie wir annahmen, eine raffinierte Finte des Kultusministeriums darstellte, um ein faschistisches Schulsystem zu etablieren. B. schenkte Wein nach, und wir schmolzen, schon völlig weich in der Birne, dahin, als Biermann sang, von der bitteren Wahrheit der Unidad Popular. Bei ihm zuhause dürften wir ihn duzen, raunte uns B. etwas später bei Kerzenlicht zu, nicht in der Schule, das ginge aus verständlichen Gründen nicht. Mensch du, B., denke ich noch heute, und erinnere mich, wie der Abend endete. Wir, die Jungs, bezogen ein Matratzenlager in B.s Arbeitszimmer. Dort durften wir seine Marx-Engels-Werke Gesamtausgabe bewundern, die blaue, aus dem ostdeutschen Dietz Verlag. Wer die hatte, konnte es nur ernst meinen. Als ich vom Zähneputzen in das Arbeitszimmer ging, sah ich durch den Türspalt im Wohnzimmer, wie Manuela auf einer Matratze am Boden liegend ihre Brust entblößte und B. sie küsste. Als ich mich zwischen die anderen ins Dunkel von B.s Arbeitszimmer legte, fragte ich mich, ob so ein alter Sack denn schon ein Held der Revolution war, nur weil er seinen Schwengel nicht unter Kontrolle hatte. Immerhin war Herr B. verheiratet. Mir war klar, dass das ein zutiefst bürgerlicher Einwand war, aber war Herr B. als politischer Nonkonformist geadelt, nur weil er auch vor arglosen Schülerinnen nicht Halt machte? Ich erstickte fast in der testosterongeschwängerten Luft des Arbeitszimmers, umzingelt von den Schatten der MEW-Gesamtausgabe und vier weiteren einsamen kommunistischen Schwänzen.
II.
Zu dieser Zeit ging ich am Nachmittag gerne ins "Cafe Größenwahn" in Haidhausen, um zu lesen. Dort trafen sich Leute, die sich auf irgendwie neue Art mit Musik, Kunst und Literatur beschäftigten. Vereinzelt trauten sich auch Langhaarige dorthin, die noch nicht eingesehen hatten, dass ihre Zeit vorüber war. Eines Tages saß ich dort - kurze Haare, schwarzer Rollkragenpullover, Röhrenjeans, spitze Schuhe - und hatte eines jener kleidsamen rot-schwarzen Rowohltbändchen zur Hand, als mich ein älterer Langhaariger vom Nebentisch herüber ansprach.
"Die Haare müsste man euch wachsen lassen", maulte er und fragte dann: "Was liestn da?"
"'Der Ekel' von Sartre" antwortete ich wahrheitsgemäß.
"Lies lieber was Gescheites", sagte er.
III.
Meine Lehrer hatten es auch nicht so mit Sartre. Zuviel Glamour, zuviel Kettenraucherei, zuviel Nachtclub war ihnen da im Spiel.
Herr B. sagte einmal im Ethikunterricht, er halte Antoine Roquentin, den Helden von Sartres "Der Ekel", für einen wildgewordenen Spießbürger. Als solcher sei er zwar nicht mehr als bewusstloser Repräsentant der herrschenden Klasse zu betrachten, aber seine Träume seien die eines Anarchisten, nicht die eines Revolutionärs, dessen Handeln einem übergeordneten Plan folge. Ich erinnere mich nicht mehr, ob Herr B. Manuela schon gevögelt hatte, als er das sagte.
Ich mochte Roquentin. Wie jedem, der sich auf die Sprache einlässt, war ihm nichts mehr selbstverständlich. Er beobachtete seine Umgebung, analysierte sie. Er hatte den Bösen Blick. Nichts entging ihm. Das war eine gute Methode, sich Distanz zur Welt zu verschaffen. Und die wünschte ich mir.
IV.
Als Jean Paul Sartre am 19. April 1980 auf dem Friedhof Montparnasse beigesetzt wurde, folgten seinem Sarg 50.000 Menschen. Ich fand ein Foto davon in irgendeiner Zeitung, das mich überwältigte. Die Tatsache, dass ein Schriftsteller mit seiner Arbeit eine derart bewegende Anteilnahme auslösen konnte, schien mir geradezu unglaublich. Weil ich damals von Sartre nur wenig gelesen hatte, dachte ich, die Trauergäste folgten seinem Sarg um Antoine Roquentins willen. Ich fand die Vorstellung zauberhaft, dass jemand, der einen so einsamen, oft abstossenden, ungemütlichen Helden erfunden hatte, sich solcher Zuwendung erfreuen durfte. Ich erfuhr bald, dass er noch einiges andere geschrieben hatte.
V.
Bestimmt zwei Jahre lang las ich überhaupt nichts anderes mehr als Sartre. Großartig an ihm war unter anderem, dass meine 68er-Lehrer ihn nicht wirklich gut kannten. Bei ihnen lasen wir Brecht und Brecht und Brecht und natürlich auch ein paar andere Sachen, aber je linker der Lehrer, desto mehr Brecht in seinem Unterricht, das war die Faustregel, nach der man gehen konnte. Ich mochte Brecht und las ihn gern. Aber wie ein Schriftsteller der Gegenwart aussehen sollte, konnte man sich an Brecht nicht mehr vorstellen. Eher schon an Sartre.
VI.
Sartre lieferte Jahrzehntelang das Grundmuster, nach dem ein Schriftsteller aufzutreten hatte, der seiner Tätigkeit gesellschaftliche Bedeutung zuschrieb. Der Begriff des Engagements spielte dabei die zentrale Rolle schlechthin.
Will es ein Begriff in der Welt der Literatur zu etwas bringen, darf man ihm eines unter keinen Umständen nachsagen können: Eindeutigkeit. Wie nichts anderes erzeugt Eindeutigkeit Langeweile, und die ist das einzige, was in der Literatur verboten ist. So betrachtet, war dem "Engagement" zu Beginn seiner Tage eine glänzende Zukunft sicher. In den ersten Jahren war, was "Engagement" war und was nicht, stets seinem Erfinder abzulauschen. Sartre veröffentlichte ungezählte Interviews, Essays, Briefe und andere Schriften, in denen er, manchmal dunkel raunend, manchmal funkelnd brillant, erläuterte, was "Engagement" bedeutete: nämlich immer etwas anderes.
Solange "Engagement" seinen gewandtesten Interpreten hatte, musste man sich um beide keine Sorgen machen. Nach Sartres Tod und seiner in den Achtziger Jahren vollzogenen Entthronisierung als Meisterdenker, sollte es auch mit dem Engagement bergab gehen.
In Deutschland war der Begriff in literarischen Zusammenhängen durch das Böll-Grass'sche Mahnwesen der Siebziger und frühen Achtziger Jahre besetzt, und folglich verband man mit ihm vor allem den direkten Eingriff des Literaten in "die Politik". Auf welche Weise, versinnbildlicht am schönsten jenes berühmt gewordene Foto, auf dem der greise, baskenbemützte Heinrich Böll mit sorgenvollem Blick, umringt von anderen Demonstranten, in Mutlangen den Sitzstreik praktiziert.
"Engagement" als literarischer Begriff unterschied sich also nicht wesentlich von dem, was man in den einschlägigen Kreisen überhaupt damit verband, nämlich "politisch was zu machen". Heinrich Böll war nun nie so weit gegangen, Gebrauchslyrik für Flugblätter zu verfassen, Erich Frieds Gedichte taugten zu diesem Zweck aber ausgezeichnet, und vielleicht ist es wirklich der Letztgenannte, der den engagierten Dichter deutscher Sprache in den Achtzigern wie kein anderer verkörpert hat.
Der literarische Engagementbegriff verlor in dem Maß an Interesse, indem er verflachte. Ein engagierter Schriftsteller war einer, der sich politisch betätigte, basta. Es spielte keine Rolle, ob er sich dabei seiner Fähigkeiten als Schreiber bediente oder ob er als Demonstrant auftrat. Ob er nebenher noch Romane, Gedichte oder Theaterstücke verfasste, war daneben nicht von Belang.
VII.
Und dann war da ja auch noch Adorno. In den "Noten zur Literatur" findet sich ein "Engagement" überschriebener Essay, der 1962 sowohl als Radiovortrag als auch in "Die Neue Rundschau" veröffentlicht worden war. Zwanzig Jahre vor der kompletten Vulgarisierung des Begriffs hatte Adorno schon sein Letztes Wort zum Engagement gesprochen. "Den autonomen Werken aber sind solche Erwägungen (die für das engagierte Kunstwerk sprechen, Anm. d. Verf.), und die Konzeption von Kunst, die sie trägt, selber schon die Katastrophe, vor der die engagierten den reinen Geist warnen."
Ich las diesen Aufsatz erstmals Mitte Zwanzig, in den späten Achtzigern, und da kam er mir auf unvorhergesehene Weise zupass.
Jenes beschränkte Verständnis von Engagement, das Literatur lediglich als ein eher ungeeignetes Mittel zu politischer Betätigung ansah, war mir vollkommen unerträglich.
Heute mehr als damals aber frage ich mich, was Adorno genau meint, wenn er von "autonomen Werken" und über "den reinen Geist" spricht. Auch wenn man mit ihm theoretisch zwischen Tendenz - der platten Parteinahme für welches politische Ziel auch immer - und Engagement unterscheidet, bleibt offen, zu welcher Zeit an welchem Ort und, das vor allem, in welcher Gesellschaft sich ein autonomes Werk von reinem Geist denken ließe. Auch wenn richtig ist, dass "der Rang der Werke, wie schon Hegel wusste, steigt, je weniger sie in der Person verhaftet bleiben, die sie hervorbringt", leuchten mir Autonomie und Reinheit allenfalls als unerreichbare Ideale ein, von denen ich noch nicht einmal weiß, ob sie erstrebenswert sind, weil ich nicht erkennen kann, was sie bedeuten. Ich bin sicher, es gibt eine große Zahl sehr kluger Leute, die mich darüber belehren könnten. Ich aber würde gerne nur ein einziges autonomes Werk von reinem Geist genannt bekommen - und ich bin sicher, ich könnte den Gegenbeweis führen, der da lautete, das Werk ist zutiefst in der Person seines Autors, der Zeit und der Gesellschaft in der er lebte verhaftet, und nur, weil es darüber hinausgeht, ist es große Kunst.
VIII.
Heute hängt dem Engagementbegriff der ganze Mief an, der sich jahrzehntelang in viel zu vielen Diskussionen über ihn angesammelt hat. Aber nicht, dass er abgestanden ist, etwas anderes hat ihm den Rest gegeben, der Zusammenbruch der alten, antagonistischen Weltordnung nämlich. Das engagierte Kunstwerk hielt jenem, das mit Adorno nichts wollte "denn da sein", vor, "es lenke ab vom Kampf der realen Interessen. Keinen mehr schone der Konflikt der beiden großen Blöcke." Seit es diese Blöcke nicht mehr gibt, sollte also eigentlich die Bahn frei sein für die autonome Kunst von reinem Geist. Bedauerlicher Weise scheint aber gerade in diesen Tagen das öffentliche Bedürfnis danach so gering wie selten zuvor.
Es ließe sich freilich einwenden, man solle das öffentliche Bedürfnis den dafür vorhandenen Anstalten überlassen. Literatur sei schon immer die Sache einiger Weniger gewesen, es bestehe kein Anlass zu vermuten, dass dies je anders werden würde.
Dennoch, seit Beginn der Neunziger Jahre hat sich in der literarischen Szene in Deutschland ein Kulturpessimismus breit gemacht, der nur damit zu erklären ist, dass man befürchtet, die Literatur verliere unaufhaltsam an Bedeutung.
IX.
Früher nämlich, als es die Blöcke noch gab, hatte die Beschäftigung mit Literatur eine konkrete gesellschaftliche Funktion. In einer bestimmten Schicht - etwa Herr B. und Konsorten - war es verbreitete Übung, sich durch das Besitzen und Zurschaustellen von Büchern, gelegentlich auch durch deren Lektüre, als dissident oder doch zumindest "kritisch" zu präsentieren. Sich mit Literatur zu befassen, versprach einen für jedermann verständlichen Distinktionsgewinn. Gerade, wer es sich - wie und aus welchen Gründen auch immer - im Kapitalismus der westlichen Hemisphäre bequem gemacht hatte, musste demonstrieren, dass er durchaus auch für das Höhere empfänglich war, und dafür waren Kunst und Literatur sehr geeignet.
Seit Beginn der Neunziger Jahre sind sich die Deutschen bewusst geworden, dass es der kulturellen Verbrämung des Kapitalismus nicht länger bedarf. Kultur, so sie von Interesse sein soll, muss von diesem neuen Bewusstsein zeugen. Ein Beispiel unter anderen hierfür ist die "Entdeckung" der sogenannten neuen deutschen Literatur von 1995 bis 2001.
X.
In jüngster Zeit wendet sich der literarische Betrieb mit überdrüssigem Grausen von seinem eben noch gefeierten jüngsten Homunkulus, dem deutschen Jungautor. Mitleid ist nicht angezeigt, denn es ging bei seiner Erschaffung nur um den Beweis, dass auch der "junge deutsche Autor" - die "junge deutsche Autorin" - zum Markenartikel hochgeschrieben und -produziert werden kann, wie der "amerikanische Schriftsteller", der "lateinamerikanische Geschichtenerzähler", der "skandinavische Krimiprofi", der "französische Skandalautor", und so fort. In seinem Aufsatz "Von der Berufung zum Schriftsteller" schreibt Sartre: "Das Bürgertum hat eine solche Angst vor dem Negativen, dass es es sich mit allen Mitteln verhehlt: den Schriftsteller sieht es als ein Rädchen der Buchindustrie, er ist der Erfinder oder Einrichter der Muster." Das ist, zugegeben, nicht mehr ganz zeitgemäß formuliert, im Kern aber nach wie vor richtig. Wenn wir statt "Bürgertum" "Markt" sagen, sind wir schon näher dran. Und natürlich wird das Erfinden und Einrichten der Muster heute nicht mehr dem Schriftsteller allein überlassen, dem alsbald Werber und Agenten als spin doctors zur Seite stehen. Doch das sind nur Nuancen, die der Optimierung des von Sartre beschriebenen Zwecks dienen. Das Neue an der neuen deutschen Literatur zwischen 1995 und 2001 war, dass sie im Unterschied zu den vorangegangenen Jahrzehnten ihren Warencharakter affirmierte und sich damit zurück ins (ökonomische) Spiel brachte.
Zwar ist es heute üblich, ästhetische und ökonomische Kriterien zur Bewertung von Literatur zu vermengen, neu ist aber auch das nicht. In dem erwähnten Aufsatz spricht Sartre von der "geschickten Gleichsetzung von Roman und Gedicht mit dem Band, der sie trägt". Dass hier ein Unterschied ums Ganze unterschlagen wird, gilt vielen heute womöglich als Haarspalterei. Den sonst vielleicht unter Immobilienmaklern beliebten Jubelruf "Nichts ist erfolgreicher als der Erfolg" dürfen heute auch Autoren und ihre Teams anstimmen, ohne um ihren guten Ruf fürchten zu müssen.
Das schlechte Gewissen, das quälende Bewusstsein, dass all dieses eitel im Andreas Gryphius'schen Sinn ist, lässt sich aber nicht ganz verdrängen. Gerade recht kommt da Heinz Schlaffers "Die Kurze Geschichte der deutschen Literatur", die uns in knappen Worten bescheidet, dass alles, was in Deutschland seit 1950 geschrieben wurde und werde, ohnehin keine Aussicht mehr habe, in den Kanon zu gelangen.
XI.
Für einen Zeitgenossen, der sich entschlossen hat, Schriftsteller zu sein, ist dies natürlich ein unmöglicher Standpunkt. Aber wer sich heute im Bewusstsein, dass es einen Homer gegeben hat, hinsetzt, um einen Roman zu schreiben, der wird auch vor Heinz Schlaffer nicht die Feder sinken lassen. Der Pulitzerpreisträger John Cheever schrieb 1961 in sein Tagebuch: "Es hat weder Sinn, mich mit unbedeutenden Injurien aufzuhalten (...), noch zu versuchen, festzustellen, welche Rolle die Vergangenheit in meinen allzu leicht verletzlichen Gefühlen spielt. Stellen muss ich mich allerdings der geringen Zahl und der Minderwertigkeit der Werke, die ich bis jetzt produziert habe. Weder der Roman noch das Stück haben in irgendeiner Weise Form, Gestalt oder Substanz. Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde, als unbedeutender Schriftsteller in die Geschichte einzugehen, der sein Talent mit Trunkenheit, Faulheit, Zorn und Gereiztheit verschwendet hat. Ich habe es nicht mehr mit den üblichen Nachteilen der Bedürftigkeit zu tun, einem schlecht beleuchteten Zimmer oder Bauchschmerzen. Ich habe es mit der Zeit zu tun, mit dem Alkohol und dem Tod." Man muss kein verzweifelter neunundvierzigjähriger Alkoholiker sein, um zu begreifen, dass die Frage nach der eigenen Bedeutung für die Wahl, Schriftsteller zu werden, nicht von Belang ist.
XII.
Diese Wahl nämlich ist eine Frage des Engagements, so wie ich den Begriff heute verstehe.
Sartre zufolge sind wir es gewohnt anzunehmen, Schriftsteller werde, wer dazu besonders begabt ist. In dem erwähnten Aufsatz "Von der Berufung zum Schriftsteller" sagt er: "Ich glaube nicht an Begabung. Das bedeutet nicht, dass jeder Beliebige zu jeder beliebigen Zeit beschließen kann zu schreiben. Sondern dass die Literatur wie die Homosexualität einen virtuellen Ausweg darstellt, den man in bestimmten Situationen findet und der in anderen nicht einmal erwogen wird, weil er von keinerlei Hilfe wäre. Wenn man nicht gut schreibt, so haben einen die Umstände nicht dazu gebracht, sein Heil in die Wörter zu legen." Sein Heil aber legt in die Wörter, wer sich in der Unmöglichkeit zu Leben befindet. Das klingt sehr pathetisch, ist aber existentiell.
Das Eingangskapitel des vorliegenden Textes liest sich heute vielleicht als witzige Geschichte. Ich selbst fand sie damals gar nicht komisch, weil ich auf der Suche war und nicht verstand, was all das zu bedeuten hatte. Aber ich hatte mich Leuten angeschlossen, die ihre Sache viel weniger wichtig nahmen, als ihre Hormone. Das ist verzeihlich, gewiss, aber mir half es nicht weiter. Erlebnisse wie diese haben mich dazu gebracht, mein Heil in die Wörter zu legen. Das ist vielleicht zum Lachen, aber es war die einzige Möglichkeit, mir eine Welt vom Hals zu halten, die ich lächerlich fand. Und mein armer Deutschlehrer Herr B. ist dafür, das will ich zugeben, nicht ganz allein verantwortlich.
Jeder, der sein Heil in die Wörter legt, ist engagiert. "Wenn die Literatur nicht alles ist, ist sie nicht der Mühe wert", sagte Sartre 1960 in dem berühmten Interview "Literatur als Engagement für das Ganze". Kann sein, dass dies, auf die zeitgenössische Literatur bezogen, erfahrenen Branchenrittern und eitlen Kulturpessimisten nur ein müdes Lächeln entlockt. Der Schriftsteller aber muss dran glauben.
*
Wir entnehmen diesen Essay der neuen Nummer der Zeitschrift Akzente über "Tradition" und danken dem Hanser Verlag für die Publikationsgenehmigung. (D. Red.)
Georg M.Oswald, geboren 1963 in München, lebt dort als Schriftsteller und Rechtsanwalt. Zuletzt erschien: "Alles was zählt" (Hanser, 2000).
Kommentieren