BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Wolfram Lotz: Träume in Europa
Du sitzt im Taxi in Amsterdam, aber seltsamerweise musst du selbst fahren, während der Taxifahrer daneben sitzt. Ein Bekannter aus dem Internet umarmt dich zu Hause, du fühlst…
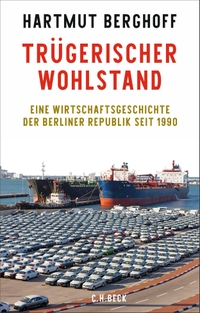
Hartmut Berghoff: Trügerischer Wohlstand
Vom Musterknaben zum Patienten? Die deutsche Wirtschaft seit der Wiedervereinigung Die Bundesrepublik befindet sich mitten in einer "Zeitenwende" und steht vor tiefgreifenden…

Tomer Gardi: Liefern
Aus dem Hebräischen von und in Zusammenarbeit mit Anne Birkenhauer. Sie sind überall, wir sehen sie jeden Tag. Egal ob in Delhi, Tel Aviv, Buenos Aires, Istanbul oder Berlin,…
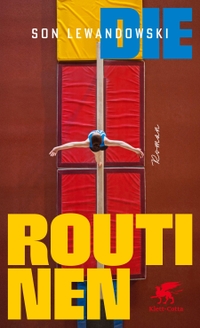
Son Lewandowski: Die Routinen
Ein Gummibärchen essen, heute den Arm, morgen ein Bein. Was sich anhört wie ein Witz, ist Alltag für die Leistungsturnerin Amik. Für sie zählt jedes Gramm, jeder Wettkampf,…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier