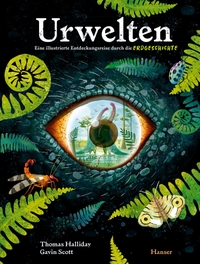BuchLink: Aktuelle Leseproben.
In Kooperation mit den Verlagen (Info)

Wolfgang Müller-Funk: Grenzen
Grenzen sind in einer globalisierten Welt zum Dauerthema geworden: Die Überwindung von Grenzen wird zum Versprechen wie zum panischen Schrecken, und die Annahme, dass in…
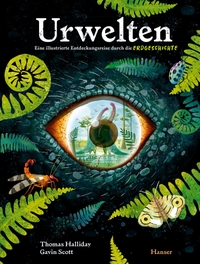
Thomas Halliday: Urwelten
Aus dem Englischen von Friedrich Pflüger. Mit Illustrationen von Gavin Scott. In diesem Buch reisen wir rückwärts durch 550 Millionen Jahre Erdgeschichte und besuchen die…

Hans Jürgen von der Wense: Routen II
Mit zahlreichen Abbildungen und zwei beigelegten Messtischblättern aus dem Nachlass. Der Privatgelehrte, Übersetzer, Komponist, Landschaftsforscher, Briefkünstler Hans Jürgen…

Gerhard Poppenberg: Maria voll der Gnade
Ein paar Berichte in den apokryphen Evangelien und, alles in allem, keine fünf Seiten im Neuen Testament - mehr umfasst die Geschichte von Maria nicht. Und doch ist daraus…
Alle aktuellen BuchLink-Leseproben finden Sie
hier
 Im Kino 10.11.2021 […] Fabian Tietke
Stollen - Deutschland 2021 - Regie: Laura Reichwald - Laufzeit: 85 Minuten. Die Premiere von "Stollen" findet am 11.11. in den Leipziger Passagenkinos statt. […] Von Lukas Foerster, Fabian Tietke
Im Kino 10.11.2021 […] Fabian Tietke
Stollen - Deutschland 2021 - Regie: Laura Reichwald - Laufzeit: 85 Minuten. Die Premiere von "Stollen" findet am 11.11. in den Leipziger Passagenkinos statt. […] Von Lukas Foerster, Fabian Tietke