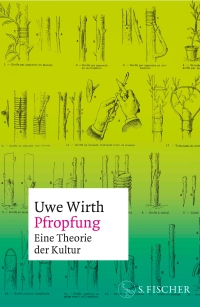Essay
In offener Feindschaft
Von Wolfgang Ullrich
22.12.2017. In seinem Essay "Zwischen Deko und Diskurs" beschrieb Wolfgang Ullrich im Sommer das sich abzeichnende Schisma in der Kunstwelt. Dieses Schisma hat sich im "Superkunstjahr" weiter vertieft: Wenn Kunst nur noch entweder als Luxus oder als Statement funktioniert, gelten dann überhaupt noch künstlerische Kriterien? Ein Gutes hat der Markt aber: Er ist nicht moralisch. Eine Bilanz.Es ist ein alter, weit verbreiteter Topos, den Markt für unvereinbar mit der Kunst zu halten. Er würde ihre Werke durch Preise auf profane Waren reduzieren und mit beliebigem Anderem vergleichbar machen, das Kräftespiel zwischen Angebot und Nachfrage würde Einfluss auf die Kunstentwicklung nehmen und deren Autonomie stören, letztlich würde sich der Geschmack der Reichen durchsetzen, der nicht unbedingt der differenzierteste und fortschrittlichste sei, die Qualität der Kunst würde also darunter leiden, dass und soweit sie eine Sache des Marktes sei. Das sind nur die geläufigsten Argumente jenes Topos, die je nach Anlass noch ergänzt werden - und die je nach Situation mal mehr, mal weniger berechtigt sein können.
Allerdings existiert auch die gegenteilige Überzeugung, wonach der Markt der Kunst mehr nützt als schadet und sie letztlich sogar besser schützt als irgendetwas sonst. Diese Auffassung vertritt etwa Walter Grasskamp. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1996 führte er aus, dass viele Artefakte nur deshalb der Zerstörung oder Vernachlässigung entgangen seien, weil "man Geld für sie bekam", es also einen Markt für sie gegeben und man sie daher sorgsam behandelt habe. Ökonomische Interessen hätten zudem immer wieder Neues und Anderes für den Kunstmarkt erschlossen, der so zum Motor des Diskurses über Kunst geworden sei: "Zunächst machen marginale Sammlernachfragen und spürsinnige Händler die Werke auf dem Markt sichtbar, die in einen vitalen Diskurs der Amateure und Kenner verwickelt werden, dem sich dann die Papierdiskurse der Kunstpublizistik und zuletzt der Wissenschaft aufpflanzen." Dass etwa die Fotografie nach längerer Zeit in den 1970er Jahren doch endlich Kunstwürde erlangte, sei "vor allem der Hartnäckigkeit und Cleverness weniger leidenschaftlicher Sammler und Händler" zu verdanken gewesen. "Hätte man es aber den Kritikern und Ausstellungsmachern, Doktoranden oder gar ihren Professoren überlassen, die Schätze zu heben - die Verlustliste wäre heute wesentlich länger als alle Auktionslisten zusammen." Und Grasskamp bilanziert: "Daher ist jede wohlfeile Verachtung für Kunsthändler und Investitionssammler fehl am Platz, denn die Intensität ihrer kommerziellen Interessen ist durchaus beruhigend, stellt sie doch sicher, dass alle Kandidaten, die für den sich stetig erweiternden Kunstbegriff in Frage kommen, auch eine Chance erhalten. Man muss das Milieu der Händler und Investitionssammler keineswegs mögen, um ihnen die größten Verdienste für den Erhalt und die Durchsetzung von Kunstwerken zuzusprechen..."1
An diese Thesen dachte ich in den letzten Monaten häufiger - und zwar immer dann, wenn einzelne Kunstwerke unter Beschuss gerieten und plötzlich sogar in ihrem Erhalt bedroht schienen. In westlichen Ländern stellt es eine neue Entwicklung dar, dass Kunst in offener Feindschaft und ohne Kompromissbereitschaft an den Pranger gestellt wird - und das gerade auch von anderen Milieus des Kunstbetriebs, von Intellektuellen und Vertretern des Feuilletons und nicht etwa nur von ressentimentgeladenen Wutbürgern und Populisten. Fast immer handelt es sich dabei um Fälle, bei denen Künstler Probleme mit anderen Ethnien bekommen, auf die sie sich in ihren Werken beziehen. So wird Cindy Sherman seit Ende 2015 für einzelne Fotos ihrer 1976 entstanden Serie Bus Riders angegriffen, in der sie sich bereits - wie in den späteren Film Stills - in verschiedene Identitäten begab, darunter auch in die von Schwarzen. Dass diese Inszenierungen klischeehafter ausgefallen seien als diejenigen, bei denen sie sich als Weiße präsentierte, wurde nun rückwirkend als Rassismus ausgelegt - ohne zu berücksichtigen, ob sich die Standards in den vierzig Jahren seit Entstehung der Arbeiten geändert haben könnten, und ohne Anerkennung dafür, dass es sich bei der Serie um erste Versuche einer damals 22-jährigen Studentin handelte. Unter dem Hashtag #cindygate, geprägt seinerseits von einer Kunststudentin, die sich als "black queer femme" bezeichnet2 und den Protest initiierte, wurden vielmehr zum Teil sehr aggressive Tweets gepostet, in denen man sogar zur öffentlichen Zerstörung der Fotos aufrief.
International mehr Aufsehen erregte im Frühjahr 2017 der Streit um ein Gemälde von Dana Schutz bei der Whitney Biennale in New York. Die bisher erfolgsverwöhnte Künstlerin wurde mit dem Vorwurf konfrontiert, eines ihrer Gemälde, dem ein berühmtes Foto zugrunde liegt, das die von Rassenhass getriebene brutale Ermordung eines schwarzen Jugendlichen im Jahr 1955 dokumentiert, nicht mit der richtigen Haltung gemalt zu haben. Die Scham, die sie als Weiße zu empfinden habe, komme auf dem Bild nicht angemessen zum Ausdruck - so die Begründung dafür, seine Abhängung zu fordern. Es gab, von der Künstlerin Hannah Black verfasst und von zahlreichen anderen Künstlern mitunterzeichnet, einen offenen Brief; ferner kam es zu Protesten vor dem Gemälde selbst.
Das sind nur zwei von etlichen Fällen, die jeweils etwas anders gelagert sind, aber alle darin übereinkommen, einzelne Werke oder gesamte Künstlerpersönlichkeiten aus politisch-moralischen Gründen zu diskreditieren. Jimmie Durham droht aktuell sogar ein Sturz ins Bodenlose, da die in seinen Werken oft verhandelte Abstammung von den Cherokee, einem Indianervolk Nordamerikas, offenbar erfunden ist. Ohne erst darüber zu diskutieren, wie viel Fiktion einem Künstler erlaubt ist und wann daraus eine bedenkliche oder gar verwerfliche Lüge wird, ist eine Ausstellung im Whitney Museum zum Anlass geworden, Arbeiten, die in den letzten Jahrzehnten fest zum Kanon einer multiethnischen, globalen Kunst gehörten, so kritisch zu diskutieren, dass dies einer Vernichtung gleichkommt. Alles, was sie bisher stark und originell - gute Kunst - sein ließ, ist schlagartig Makulatur geworden.
Auch Marina Abramovic, Vanessa Beecroft oder Omer Fast mussten im Lauf des letzten Jahres die Erfahrung machen, ganz überraschend in einen Shitstorm zu geraten, zum Teil ausgelöst sogar nur von einer einzelnen Äußerung, auf die eine Abrechnung mit der künstlerischen Haltung folgte, die daraufhin insgesamt des Rassismus geziehen wurde. Durch die Mechanismen der Sozialen Medien mögen derartige Fälle in ihrer Bedeutung unangemessen gepusht worden sein, aber fraglos zeugen sie von einem Mentalitätswandel. Es scheint, als sei Kunst, die lange sakrosankt war und der weitgehende Freiheit - manchmal gar Immunität - gegenüber gesellschaftlichen und moralischen Ansprüchen zugestanden worden war, nun genauso zum Gegenstand und Spielball politischer Interessengruppen geworden wie Lehrpläne, der Journalismus oder die Werbung. Ihre Sonderstellung hat die Kunst also eingebüßt; besondere Fähigkeiten - und damit auch Rechte - werden ihr nicht mehr zugestanden.
An dieser Stelle fällt auf, dass der Markt als Gegeninstanz wirken kann. So gerne man dem Kapitalismus - also dem gewinnorientierten, auf Spekulation getrimmten Denken - vorhält, keine Werte und keine Moral zu kennen, so sehr kann gerade das zum Vorteil für eine Kunst werden, die unter den Druck moralischer Rechtfertigung gerät. Denn soweit der Markt amoralisch ist, herrscht auf ihm auch nicht jener Druck; vielmehr lässt er der Kunst in moralischer Hinsicht Freiheit. Daran zeigt sich eine Wahlverwandtschaft zwischen Markt und Kunst. Beide kommen darin überein, die Phantasie über die Moral zu stellen, auch wenn jene jeweils eine ganz andere Ausprägung annimmt. Gibt man auf dem Markt, wie Grasskamp feststellt, allem eine Chance, was als Kunst durchgehen könnte, richtet darauf also Phantasien von Entdeckung und Gewinn, so geht es in der Kunst darum, Grenzen infrage zu stellen, die Realität zu paraphrasieren oder Fiktionen ohne Rücksicht auf was auch immer zu schaffen und dabei jedes Mal eine lebhafte Einbildungskraft unter Beweis zu stellen. Markt und Kunst - so könnte man es pathetisch formulieren - leben vom Abenteuer, in dem die sonst geltenden Konventionen zumindest entkräftet, wenn nicht völlig suspendiert sind.
Bis eine politisch-moralische Debatte über einen Künstler auf den Markt durchschlägt, dauert es also ziemlich lange. Mag manches Museum fortan zögern, eine Ausstellung mit Dana Schutz oder Omer Fast zu machen, oder wird eine öffentliche Kunstinstitution vorab zumindest sicherstellen, keine eventuell diskriminierenden Werke zu zeigen, spielt das für Galerien, Messen und Auktionshäuser keine Rolle. Sie geben den betroffenen Künstlern vielmehr das beruhigende Gefühl, alles sei wie bisher, die Freiheit der Kunst nicht ernsthaft in Gefahr.
Abgesehen davon, dass sich das noch als Trugschluss erweisen könnte, wirkt der amoralische Charakter des Marktes aber auf andere Bereiche des Kunstbetriebs auch als Provokation, ja gar als unmoralische Attitüde. Ist es nicht obszön, mit Werken Geschäfte zu machen und zu spekulieren, die ganze Ethnien, spezielle Minderheiten oder einzelne Individuen verletzen und von einer unsensiblen, eventuell sogar von einer gleichgültig-aggressiven Haltung zeugen? Missachtet der Markt die jeweils Verletzten nicht noch ein weiteres Mal und wirkt daher erst recht demütigend?
Tatsächlich dürfte es manchen Protest, der in letzter Zeit gegen Künstler oder Werke erhoben wurde, noch verstärkt haben, dass diese auf dem Markt besonders erfolgreich sind. So heißt es im offenen Brief gegen Dana Schutz, die Gewalt der Weißen gegenüber Schwarzen setze sich weiter fort, wenn jenes Foto eines niedergemetzelten schwarzen Jungen als Rohmaterial ("raw material") für eine Malerei diene, die Teil eines Kunstbetriebs sei, in dem es um "Geld und Spaß" ("profit and fun") gehe.3 Sofern Leute mit hohen Preisen, die sie für Kunst zahlen, ihren Reichtum demonstrieren und von der Distinktionskraft profitieren, die gerade etwas moralisch Umstrittenes besitzt, ist das wirklich kaum anders als geschmacklos und kaltherzig zu bezeichnen.
So trägt der Markt seinerseits zu einer Polarisierung bei, und in dem Maß, in dem er sich den einen als Garant von Freiheit darbietet, verstärkt sich bei den anderen das Feindbild einer rücksichtslosen Ökonomie. Gerade unter Kuratoren einer jüngeren Generation ist das zu bemerken, deren beliebtestes Schlagwort 'Neoliberalismus' lautet und die dem Markt auch insofern misstrauen, als sie - anders als jemand wie Walter Grasskamp - nicht glauben, dass auf ihm sichtbar wird, was als Kunst gelten und geschätzt werden kann. Manche gehen sogar so weit wie Adam Szymczyk, der Leiter der documenta 14, der schon den Begriff der Qualität als Kriterium für Kunst ablehnt, da das "eine leere Kategorie" sei, "die gefährlich mit einem Markt [...] verbunden ist".4 Marktpreise sind für Szymczyk keine Qualitätsindikatoren: Nicht aus dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage ergibt sich, was als Kunst Anspruch auf Beachtung verdient, sondern das ist viel eher die Sache von Experten, namentlich von Kuratoren. Diese handeln Marktentscheidungen sogar bewusst zuwider oder machen sich für Kunstformen stark, die - wie Performances oder ortsgebundene Installationen - auf dem Markt nur schlechte Chancen haben.
Damit aber ist das, was bei kuratierten Großausstellungen wie einer Documenta gezeigt wird, in seiner Spannbreite von vornherein ziemlich begrenzt. Auf dem Markt erfolgreiche Kunst bekommt einen Malus und wird nur ausgewählt, wenn sie zugleich der politischen Agenda der Kuratoren genau entspricht, also ihrerseits etwa eine Kritik am Neoliberalismus verkörpert oder sich mit Minderheiten beschäftigt. Und da sich die Kuratoren umso stärker profilieren können, je besser die von ihnen gezeigte - vielleicht sogar in Auftrag gegebene - Kunst zu ihrem Programm und ihren Thesen passt, hat auch eine unpolitische Kunst, die sich vornehmlich formalen Fragen widmet oder die in einer autonomen 'L'art pour l'art'-Tradition steht, kaum eine Chance, ausgestellt zu werden.
Also bestehen kuratierte Ereignisse wie eine Biennale oder die Documenta vor allem aus Arbeiten, die sich emanzipatorisch-gesellschaftskritischen oder ökonomisch-investigativen Themen widmen. Und da viele Kuratoren ihrerseits sehr sensibel hinsichtlich der eventuell verletzenden oder diskriminierenden Wirkung von Werken sind, zeigen sie lieber keine Arbeiten, in denen die Unterdrückungserfahrung einer Minderheit oder die Herabwürdigung einer Ethnie von Künstlern anderer Milieus und Ethnien reflektiert werden (wie im Fall von Sherman, Schutz oder Beecroft), sondern bevorzugen die Präsentation von Arbeiten der betroffenen Opfergruppen selbst. Für eine derartige identitätspolitische Vorstellung von Kunst, wonach diese Ausdruck spezifischer Erfahrung sein soll und nur als solche ehrlich und über allen moralischen Zweifel erhaben ist, lieferte gerade die documenta 14 viele markante Beispiele.
Durch diese Programmatik einer Reihe von Kuratoren wurden und werden umgekehrt Angriffe auf eine Kunst, die ein Thema von außen - mit Fremderfahrung - betrachtet, also sogar noch begünstigt und, da sie derselben Identitätslogik folgen, zumindest teilweise legitimiert. Innerhalb der letzten Jahre haben die meisten Biennalen sowie andere kuratierte Großausstellungen somit zu einer Politisierung und Moralisierung der Kunst geführt, die für nicht unerhebliche Umwälzungen innerhalb der Wertschätzung und Ranglisten von Künstlern sorgt. Eine größere Anzahl von Künstlern, die lange unumschränkte Aufmerksamkeit genossen und die nach wie vor in Publikumsausstellungen in großen Museen und in den Institutionen des Kunstmarkts sowie bei vielen Sammlern sehr beliebt sind, die also bei jeder größeren Messe zahlreich zu finden sind, kann man sich als Biennale- oder Documenta-Teilnehmer kaum noch vorstellen.
Ein paar Beispiele: David Hockney ist viel zu unpolitisch, seine Kunst zu fröhlich und unbeschwert, um zu den aktuellen und ernsten Themen der meisten Kuratoren zu passen. Jeff Wall ist selbst schon so reflektiert und dezidiert in seinen politischen Ansichten, dass er die meisten Kuratoren intellektuell in den Schatten stellt, weshalb sie lieber einen Bogen um ihn machen. Jonathan Meese ist mit seiner Idee einer 'Diktatur der Kunst' von vornherein im offenen Widerspruch zu all den Theorien und Aussagen, die Kuratoren an Kunst herantragen, um sie zum Medium dafür zu machen. Neo Rauch ist zu rechts in seinen politischen und weltanschaulichen Einstellungen, um in ein Kuratoren-Programm zu passen, und seit er im Oktober 2017 sogar öffentlich eine direkte Linie von der SED-Diktatur zu den von ihm als "Politkommissare" bezeichneten Kuratoren zog, deren "Erwartungshaltungen" bei "allen Documenta- und Biennale-Veranstaltungen" dominierten und von denen "neue Verbote" verhängt würden, "die mit Sprechen und Denken zu tun haben", dürfte er endgültig seinen Abschied von diesem Teil des Kunstbetriebs vollzogen haben. Man müsse sich, so Rauchs Fazit, "einen Teufel darum scheren, ob man in diesen Arenen wahrgenommen wird oder nicht".5
Wieder andere Künstler von Albert Oehlen über André Butzer bis zu Anselm Kiefer wird man ebenfalls kaum einmal auf Künstlerlisten von Kuratoren finden. Doch scheint das viele Sammler nicht zu beeindrucken. Sie halten ihnen die Treue, überlegen sich aber vielleicht, ob sie wirklich noch jedes Großevent kuratierter Kunst besuchen sollen. In diesem Jahr waren einige von ihnen erstmals - wie ich in etlichen Gesprächen mitbekam - nicht auf der Documenta, und sie geben das sogar zu, ohne die Sorge erkennen zu lassen, sich mit dieser Aussage vielleicht zu blamieren. Umgekehrt berichten nicht wenige Besucher der Venedig-Biennale, dass man sich die zeitgleich stattfindende Hirst-Ausstellung im Palazzo Grassi 'natürlich' nicht angeschaut habe - und wenn doch, dann gibt es nur ein paar abfällig-überhebliche Bemerkungen dazu, so als sei von vornherein klar, dass das dort Gezeigte für ein ernsthaftes Kunstpublikum nicht satisfaktionsfähig ist. Auch Hirst ist übrigens einer der Künstler, die überall auftauchen, nur sicher auf keiner Documenta oder Biennale.
In einem Vortrag in diesem Sommer spekulierte ich darüber, ob in der Kunstwelt ein Schisma bevorstehe, es also zu einer Abspaltung einzelner Bereiche dessen kommen könnte, was dem Begriff und Anspruch nach im Moment noch alles unter 'Kunst' gefasst wird.6 Selbst wenn stimmt, dass es immer schon höchst unvereinbare Richtungen und Interessen im Kunstbetrieb gegeben hat, scheint mir in diesem 'Superkunstjahr' mehr denn je deutlich geworden zu sein, dass mittlerweile auch der Wille einzelner Beteiligter schwindet, überhaupt noch unter einem gemeinsamen Dach versammelt zu sein. Man setzt sich nicht mehr miteinander aus, um zu bestimmen, wer die bessere Kunst macht. Vielmehr haben sich eigene Dynamiken entwickelt, die dazu führen, dass eine Idee davon, was Kunst spezifisch sein und leisten könnte, in den Hintergrund gerät - zugunsten von Kriterien, die anderen Bereichen entstammen.
So geht es für viele Kuratoren - wie etwa auch für Kunstaktivisten - nicht mehr primär darum, mit ihren Ausstellungen und Projekten in Kunstmagazinen und Feuilletons besprochen zu werden; vielmehr wollen sie in die Politikteile der Zeitungen vordringen, in Politmagazinen des Fernsehens auftauchen, in den Sozialen Medien Shitstorms und virale Effekte erzeugen. Die Grenzen von Kunst, politischem Protest, Theater, zivilem Ungehorsam, Comedy und Crowdfunding-Kampagnen werden hier fließend. Gerade damit aber spielen Fragen nach künstlerischer Originalität, Fragen nach Form und Material oder Fragen nach Werkprozessen keine nennenswerte Rolle mehr. Schon gar nicht sind solche Fragen noch Gegenstand von Debatten oder gar von ideologischen Kämpfen. Mit Kolja Reichert kann man vielmehr konstatieren, dass die Kuratoren in den zwei letzten Jahrzehnten "das Sprechen über Kunst verlernt" haben.7
Aber auch in einigen Hochpreissegmenten des Kunstmarkts sind kunstspezifische Kriterien nicht mehr relevant. Sonst würde man einen Leonardo nicht als 'Post-War and Contemporary Art' versteigern, würde sich fragen, was am tausendfünfhundertsten Spot-Painting von Damien Hirst anders ist als am ersten oder am hundertfünfzigsten, oder würde zumindest darüber streiten, ob es geniale Konzeptkunst oder ideenlose Chuzpe ist, dass Jeff Koons reihenweise Meisterwerke der Kunstgeschichte kopieren lässt und sie, jeweils um eine blaue Kugel ergänzt, auf den Markt bringt. Doch findet ein solcher Streit nicht statt, weil sich niemand dafür interessiert. Vielmehr reizt es, Gründe zu finden, warum gerade Künstler wie Hirst und Koons, offenbar ganz unabhängig von Auseinandersetzungen über künstlerische Qualitätskriterien, die höchsten Preise erzielen, und darüber zu spekulieren, was sich daraus für den Kunstmarkt insgesamt ableiten lässt.
Ich gebe gerne zu, dass auch ich mehr Zeit damit verbringe, Rekordpreise des Kunstmarkts zu verstehen als über Kriterien für gute Kunst nachzudenken. Deshalb sind meine Bemerkungen und Beispiele auch nicht kulturpessimistisch gemeint, sondern sollen erst einmal nur darauf aufmerksam machen, wie stark selbst Diskussionen, in denen es vermeintlich um Kunst geht, von anderem bestimmt sind. Auf der einen Seite ist man mit Verkaufspsychologie, Reichensoziologie und Verschwendungsökonomie befasst, während man sich am anderen Ende des Spektrums mit Minderheiten- und Identitätspolitik sowie mit Partizipations- und Protestformen beschäftigt.
Je mehr aber kunstspezifische Kriterien an Stellenwert verlieren, desto weniger selbstverständlich ist es auch noch, dass das, was in weit voneinander entfernten Bereichen geschieht, als zusammengehörig angesehen und etwa von denselben Institutionen repräsentiert wird. Was hat Anselm Reyle mit dem Zentrum für politische Schönheit gemeinsam? Vermutlich verbindet sie nur, dass ihr Ehrgeiz jeweils gerade nicht darin besteht, den Begriff der Kunst voranzubringen und ihm ihre gesamte Arbeit zu unterstellen. Ihre Ziele speisen sich vielmehr aus ganz anderen Motivationen. Daher braucht auch nicht zu wundern, wenn ihre Arbeit vermehrt an kunstfremden Kriterien gemessen wird, ja wenn ihr nicht länger die Sonderstellung zuerkannt wird, die Kunst lange Zeit besessen hat. Das eine ist auf einmal Luxus-Design, das andere eine Demonstration, die sich vor allem in den Sozialen Medien abspielt.
Man mag einwenden, dass Künstler wie Olafur Eliasson oder Liam Gillick es schaffen, sowohl auf dem Kunstmarkt erfolgreich und teuer als auch bei Kuratoren beliebt zu sein, es also keineswegs zwangsläufig sei, dass eine Karriere im einen Bereich Misserfolg im anderen zur Folge habe. Tatsächlich erstaunt, wie einigen ein Spagat zwischen den Welten gelingt. Aber es scheint mir tatsächlich ein Spagat zu sein, so dass sie mit einem Bein auf dem Feld politischer Diskurse stehen und sich mit dem anderen gleichzeitig fest auf die Logik der Kommodifizierung stützen. Auch sie agieren also nicht aus einer Mitte heraus, in der darüber verhandelt würde, was Kunst als Kunst ausmacht und von anderem unterscheidet, sondern sie haben es nur viel besser als andere verstanden, ihre Arbeiten mehrfach zu codieren oder mehrstufig anzulegen, so dass diese sowohl als Medien politischer Botschaften wie auch als Objekte funktionieren, die Sammlerphantasien stimulieren.
Künstler, die sich in jener Mitte bewegen, die sich also ausdrücklich als autonom - unabhängig von Markt und Kuratoren - begreifen und die ihre Werke ausschließlich nach Kriterien beurteilt wissen wollen, die dem Begriff der Kunst entstammen, haben es schwerer als früher, Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen. Wenn weder hohe Preise noch aktuelle politische Themen damit verbunden sind, wirken sie vielmehr schnell etwas langweilig und, vor allem, beliebig. Für ältere Künstler, die sich bereits einen Namen gemacht haben, als noch allenthalben über Kunst gestritten wurde, mag das traurig, aber nicht existenziell sein, für jüngere hingegen eine Katastrophe, da ihnen dauerhafte Nichtbeachtung droht.
Sofern sie doch noch etwas zu erwarten haben, dann aber eher vom Markt als von den Kuratoren. Denn immerhin gibt es nicht nur die Orte des Marktes, an denen es um Millionen und Rekorde geht, sondern erst recht die Orte, an denen sich Kenner und Freaks, Spezialisten und Hasardeure treffen und an denen tatsächlich nach wie vor - oder sogar bereits wieder? - Kriterien interessant sind, die sehr viel mit Kunst und kaum etwas mit anderem zu tun haben. Viele Galerien, die als solche Orte fungieren, spüren allerdings ihrerseits, wie eng es für sie geworden ist, seit auch im Kunstbetrieb so vieles andere an Dominanz gewonnen hat. Das oft beklagte Galeriensterben hat vor allem damit zu tun, ist also seinerseits Vorbote jenes möglichen Schismas.
Aber vielleicht behält Walter Grasskamp dennoch Recht und es bleibt dabei, dass Galeristen und Händler - nicht unbedingt die größten und bekanntesten unter ihnen - neue Kandidaten für das entdecken, was künftig einmal als Kunst gelten wird und sich dabei nach wie vor von allem anderen hinreichend unterscheidet. Auf jeden Fall aber hat sich in diesem 'Superkunstjahr' gezeigt, dass der Markt wichtig ist, um die Vielfalt und Freiheit der Kunst zu garantieren, die sonst zunehmend gefährdet zu sein scheinen.
Der Text basiert auf einer Rede, die Wolfgang Ullrich am 1. Dezember 2017 auf dem FAZ-Forum zum Kunstmarkt und dem Superkunstjahr hielt. Mehr zu Wolfgang Ullrich unter ideenfreiheit.de .
****
2 Tweet zu Cindy Shermans Serie "Bus driver".
3 Hannah Blacks Offener Brief an die Kuratoren der Whitney Biennale.
4 Carmela Thiele: "Qualität ist eine leere Kategorie", in: taz vom 18. März 2014.
5 "Meister der hocherotischen Zone. Der Maler Neo Rauch spricht über seinen verstorbenen Lehrer Arno Rink, über den fröhlichen Hedonismus der DDR-Künstler und den schlecht gelaunten Moralismus von heute", in: DIE ZEIT 38/2017.
6 Vgl. Wolfgang Ullrich: "Zwischen Deko und Diskurs" (2017), perlentaucher.de.
7 Kolja Reichert: "Es lebe die Kunst! Nur welche? Und warum?", in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 9. Mai 2017.