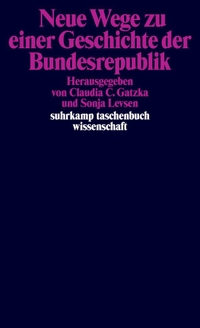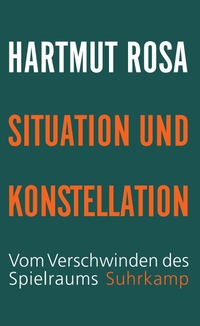Essay
Die Freiheit, die ich meine
Von Ekkehard Knörer
22.10.2009. Haneke ist für mich ein Geist, der stets verneint. Seine Filme sind Exerzitien, die die Freiheit leugnen. Eine sehr grundsätzliche Erwiderung auf Wolfram Schüttes Kritik an meiner Haneke-Kritik. Lieber Herr Schütte,
was mich an Ihrer Replik auf meine Kritik an Hanekes Film am meisten ärgert - und sie ärgert mich in der Tat -, sind Ihre Unterstellungen. Die muss ich erst einmal beiseite räumen, bevor ich auf den Kern der Sache, also das ästhetische System Hanekes komme und die Gründe für meine Kritik daran und insbesondere an seinem jüngsten Film "Das weiße Band" - und von da dann sogar noch auf etwas viel Grundsätzlicheres, nämlich mein Credo als Kritiker.
Es ist mir wohl bekannt, dass meine Argumente gegen Haneke aus der Rezeptionsgeschichte des Regisseurs durchaus vertraut klingen. Tatsächlich habe ich meine Kritik nicht zuletzt als Versuch begriffen, die problematischen Aspekte seiner Kunst - zum Beispiel durch die Kontrastierung mit Lars von Trier - einmal möglichst scharf zu konturieren. Das bot sich beim "Weißen Band" an, weil der Film erstens weithin über den grünen Klee gelobt wurde und wird und mir andererseits ein von der Haneke-Malaise ganz besonders stark bestimmter Film scheint.
Ich fühle mich nicht darum sehr zu Unrecht in den Topf eines angeblichen deutschen Anti-Haneke-Konsenses geschmissen, besonders unangenehm daran dann noch der Psychose-Vorwurf als aparte Würze. Im übrigen halte ich es sowieso für die unfeine Art, jemanden, dessen Urteil einem nicht passt, erst mal nicht beim Argument zu nehmen, sondern ihm ein Herdenverhalten zu unterstellen, das dann zu allem Überfluss auch noch national - von psychopathologisch zu schweigen - zugerechnet wird. Und davon dann noch einmal abgesehen, halte ich Ihre Diagnose einer generalisierten Haneke-Verachtung hierzulande nicht nur im aktuellen Fall für falsch, weil mindestens undifferenziert. Sehr wohl erinnere ich mich an begeisterte Stimmen auch aus Deutschland zu mehr oder minder allen Haneke-Filmen seit "Bennys Video", seinem Durchbruch zu mindestens nationaler Beachtung.
Haneke war gewiss ein Regisseur, der die Kritik immer gespalten hat - an Befürwortern hat es aber, anders als Sie behaupten, niemals gefehlt. Ich verweise exemplarisch auf Andreas Kilbs Kritik in der Zeit zu "Bennys Video" (11.6.1993), der Untertitel "Michael Hanekes verstörendes Meisterwerk" sagt schon alles. Auch das ganze Arsenal der Pro-Argumente findet sich bereits in Kilbs Text. Und dass sich die Argumente seit Jahr und Tag gleichen und der Hut immer älter wird, muss ja nicht an der Borniertheit der Kritiker liegen. Es hat wohl eher damit etwas zu tun, dass die Hanekesche Ästhetik seit Jahr und Tag eine ähnliche ist - von den einen bewundert, von den anderen verachtet und im Ergebnis von den meisten, je nach Film, als mal mehr und mal weniger überzeugend betrachtet. Das sehe ich übrigens selber so und verweise darauf, dass ich andere Haneke-Filme, namentlich "Die Klavierspielerin" und "Cache", trotz meiner massiven und grundsätzlichen Probleme mit dem Regisseur, in positiverem Licht sehe als "Das weiße Band" (oder "Bennys Video" oder "Funny Games"). Kurzum: Der Hut, den Sie mir aufsetzen, der steht mir nicht, und die Suppe, in die Sie mich ungefragt reinrühen, esse ich nicht.
***
Und damit zum Kern der Sache: Michael Hanekes Ästhetik. Wahrscheinlich sind wir in der Beschreibung in einem Punkt nicht uneins. Beide sehen wir - wie er selbst - einen starken ethischen Impuls in Hanekes Kino. Er selbst leugnet nicht seine aufklärerischen Absichten - und wenn man ihn und die Filme da auch nur ein wenig ernst nimmt, wird man sagen dürfen: Er möchte, dass die Zuschauer klüger werden durch das, was sie in seinen Filmen sehen, erleben und, ja, erleiden. So allgemein formuliert, hätte ich noch nicht einmal etwas dagegen. Ich bin ein Freund der Aufklärung, auch in der Kunst, und ich halte es für alles andere als verwerflich - anders als etwa die Fragesteller im aktuellen Spiegel-Interview -, wenn ein Regisseur nicht Beruhigung und Unterhaltung als oberstes Ziel seines filmischen Tun und Trachtens begreift.
(Wobei, möglicherweise muss man das tatsächlich dazusagen, ich gegen Unterhaltung auch nichts habe. Vielmehr ist mein einziges Dogma, durchaus typisch aufklärerisch, die Dogmenkritik: Als Kritiker stelle ich jedes Ding nach Möglichkeit in den Rahmen, in den es gehört. Weder das Strenge noch das Luftige, weder das Obszöne noch das Heilige, weder die Kunst noch das Entertainment, weder das Hochkontrollierte noch das Aus dem Ruder Gelaufene, weder das Verstiegene noch das Populäre finde ich per se gut oder schlecht. Es ist einerseits immer der Einzelfall, auf den es ankommt. Ein Film kann auf grandiose Weise aus dem Ruder laufen, aber auf genauso großartige Weise auch überaus kontrolliert komponiert sein. Ich kann Primitives toll finden und Sublimes, Gewalt und Vergeistigung, Intellektualität und Somatik und so weiter, ist ja klar, worauf ich hinauswill.)
Diese Klärung scheint mir nötig, weil sie deutlich macht, auf welcher Ebene ich Haneke kritisiere. Nicht dafür, dass seine Filme streng sind oder hoch kontrolliert oder humorlos. Sondern dafür, auf welche Weise sie streng sind (nämlich: verbissen) und kontrolliert (nämlich: kontrollfetischistisch) und humorlos (nämlich: gegen die Freiheit gerichtet, die dem Humor innewohnt). Sehr erstaunt bin ich allerdings im Licht meines Textes zu "Das weiße Band", ein sehr wichtiges Argument gegen Haneke in Ihrer Erwiderung nun als Argument für ihn anzutreffen. Ich zitiere: "Ich gebe zu, dass ich mich nicht nur im Alltag, sondern erst recht in der Kultur besser aufgehoben und animiert sehe, wenn ich mich als (Mit)Produzent, statt als traktierter Konsument angesprochen sehe & fühle: im Film so gut wie in der Literatur."
Eben das, so mein Einwand gegen Hanekes Filme, ist doch nicht der Fall. Sie sind totalitär, weil sie gerade nicht auf das Mitdenken, die Freiheit des Betrachters zu eigenem Fühlen und Dünken, kurzum: auf die Mitproduktion, auf die Offenheit eines Prozesses hinauswollen, sondern auf die Konsumtion - also: auf das Schlucken der bitteren Arznei, die da wieder und wieder verabreicht wird. Sie verstehen sich in genau diesem Sinn, dabei bleibe ich, als "Schauprozesse": Das Ergebnis, die Lehre, die Moral von der Geschichte möchten Hanekes Filme lückenlos festlegen und kontrollieren. Und was mich dann erst recht ärgert, ist die Selbstgerechtigkeit, mit der Haneke immer wieder eine textuelle Offenheit behauptet, deren Fehlen nicht nur das "Weiße Band" so ärgerlich macht. Was Haneke offen lässt, ist nicht offen, sondern eben offen gelassen - und das heißt: auch das Offene ist genau konturiert, bereits eingetragen ins Bild.
Gute Gelegenheit, auf den Ich-Erzähler zu kommen. In dem nämlich verkörpert sich das für meine Begriffe am besten. Erzähltheoretisch sind ein Ich-Erzähler und ein auktorialer Standpunkt sehr wohl vereinbar (der törichte Stanzel hat da manch Unheil angerichtet) - und insbesondere sind sie das, wenn das Ich, das da spricht, im Rückblick, also nicht als die in der Erzählung dann selbst auftretende Figur, berichtet. Den Eindruck, dass der Lehrer als Erzähler in "Das weiße Band" etwas offen lässt, gewinne ich allerdings gar nicht. Dafür ist die ideologiekritische - von mir als ätiologische bezeichnete - Moral von der ganzen Geschichte doch allzu offenkundig. Die Unsicherheit, von der der Ich-Erzähler da spricht, erscheint mir als reine und also falsche Behauptung. Und dieser Sachverhalt selbst, wie gesagt, als ganz und gar typisch für Hanekes größte Untugend: Er nötigt dem Betrachter sein Weltbild auf, er unterstellt ihm (und aller Welt) eine prinzipielle Unfreiheit, von der er dann (similia similibus curantur) nur durch die spezifische Form von "Vergewaltigung", als die Haneke seine Filme begreift, befreit werden kann. Wenn es dem Regisseur gelingt, dieses - sein erklärtes! - Programm durchzuziehen, kommen mit schöner Regelmäßigkeit so totalitäre wie selbstgerechte Filme heraus, "Funny Games" etwa oder "Das weiße Band". In anderen Fällen gelingt ihm die Schließung nicht (ganz), manchmal gerät ihm das Ganze zum Vexierbild mit "innerem Widerspruch" und dann wird es doch recht interessant, siehe "Cache".
***
Auf einen Absatz in Ihrer Replik möchte ich noch zurückkommen, weil er ins Zentrum der ästhetischen Fragestellung und damit auch über die üblichen, etwas vordergründigen Vorwürfe des Didaktischen und Totalitären bei Haneke hinaus- und in die Tiefe des Grundsätzlichen führt. Ich zitiere diesen Absatz:
"Ja, mein Gott, lieber Herr Knörer, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Was Sie an Hanekes Arbeiten inkriminieren, ist doch das innerste ästhetische Gesetz von Kunst & von Handwerk, wo alles an seinen Platz gehört und dies der Autor haargenau selbst bestimmt: ob es ein Tischler, ein Schriftsteller oder ein Filmregisseur ist!"
Tatsächlich bin ich, lieber Herr Schütte, von allen guten Geistern verlassen und sehe das anders. Ein Tisch ist kein Film und kein Buch. Ein Tisch erfüllt eine klare Funktion (gut oder schlecht), ein Film tut das nicht. Ein Tisch, der nicht steht, ein Stuhl, auf dem man nicht sitzen kann, sind ein Tisch und ein Stuhl, die nichts taugen. Wenn ich etwas als ästhetisches Artefakt betrachte, dann stelle ich es in einen anderen Rahmen. (Da kann ich, q.e.d. Duchamp, freilich auch einen Tisch und einen Stuhl hineinstellen.) Das Artefakt hat nicht a priori eine Funktion, keinen Gebrauchszweck, kennt keine Vorschrift und steht, etwas pathetisch gesagt, über dem Gesetz. Oder: Sein innerstes Gesetz lautet eben, dass sich ein Moment des Offenen und Unkontrollierbaren nicht austreiben lässt. Weder durch seinen Autor noch durch seinen Interpreten ist ein Kunstwerk ein- für allemal festzuschreiben. Das genau heißt es, würde ich sogar sagen, etwas, und sei es etwas das aussieht, wie ein Stuhl oder Tisch, ein Kunstwerk zu nennen.
Das heißt aber auch: Ich kann ein Werk - sagen wir: "Cache", sagen wir: "Inglourious Basterds" - gegen die Intentionen, die sein Schöpfer gehabt hat (oder: gehabt zu haben glaubt oder behauptet), verteidigen. Es steht immer zuerst für sich. Es ist, in einem noch anderen Wort: immer zuerst Text. Alles steht selbstverständlich immer in Kontexten, aber nicht so, dass sie den Text in einsinniger Weise determinieren. Seien diese Kontexte: der Autor, seine Intention oder sein Unbewusstes, die Sprache, die Gesellschaft, die Geschichte, Strukturen, die Theorie, die Ökonomie, die Episteme oder was immer an Determinismen man sich im Lauf der Ästhetikgeschichte so alles hat vorstellen können. Dies Momente sind immer im Spiel, aber nie so, dass sich der Text selbst je stillstellen ließe. Texte sind mithin Formen, aus denen die Möglichkeit von Ereignissen niemals auszuschließen ist, die sich darum der Kontrolle auch ihres Autors entziehen; sie sind Formen, die, jetzt im emphatischen Sinn der Dekonstruktion formuliert, der "Lektüre" zugänglich sind. Ganz wie das Leben selbst, dem sie darin auch gleichen.
So weit, so grundsätzlich. Soll heißen: Wer anderes behauptet, liegt in meinem Verständnis falsch. Daraus folgt aber etwas Entscheidendes für mein ästhetisches Urteil: Ich habe eine Präferenz - und zwar eine, die ich für aus dem "innersten Gesetz" der Kunst begründet halte -, für Filme, Bücher, Performances, Kunstwerke etc. pp., die innere Widersprüche nicht leugnen. Die, um es jetzt nicht auf den Begriff des Widerspruchs festzulegen: jene Momente, die sich jedweder Kontrolle entziehen, also "Ereignisse", also "Lektüre", mindestens zulassen. Die nach Formen für diese Momente der Freiheit sogar suchen. Das kann in durchaus strengen Formen der Fall sein, sagen wir, weil sie mir gerade einfallen und weil ich sie so liebe, in den Filmen von Angela Schanelec oder Hong Sang-soo. (Strenge Formen sind, gegen den ersten Anschein, sogar besonders geeignet dafür, weil sie das Moment des Widerstands, das zu dem der Freiheit gehört, gleich mit sichtbar machen.)
Ein Buch, ein Film, die so tun, als hätten sie alles im Griff, als wäre es möglich, alles an haargenau den richtigen Platz zu stellen, als könne man den Rand des Werks mit Nadel und Faden vernähen, sind dagegen ein Selbstwiderspruch. Zwar also ein Widerspruch, aber ein schlechter und ideologischer: Sie eröffnen nichts, sondern verschließen sich der Freiheit, die in ihrem Innersten wohnt. Es gibt die unterschiedlichsten Arten, sich der Freiheit zu öffnen, sie reichen ganz sicher von Hitchcock bis Kiarostami und an beiden Enden darüber hinaus (bei Kubrick beginne ich in Ihrer Beispielreihe freilich zu zögern; auch, horribile dictu, bei manchen Filmen der Straubs). Lars von Trier schätze ich dafür, dass er in vielen - nicht allen! - seiner Filme den Widerspruch auf allen Ebenen offensiv sucht. Ja, das ist oft ein heilloses Durcheinander, aber es ist das eine - so meine Behauptung - bei aller Bösartigkeit das Leben in letzter Instanz bejahende Heillosigkeit. Nochmal anders: Lars von Trier ist seinem Naturell nach durchaus totalitär - aber in seinen besten Filmen fliegen die Fetzen, weil da ein Kampf des Totalitären und Auktorialen gegen sich selbst zum Austrag kommt.
Haneke aber ist für mich ein Geist, der stets verneint. Seine Filme sind Exerzitien, die die Freiheit leugnen und, schlimmer noch, aus ihrem Inneren auszutreiben versuchen - und diese ihre Verneinungslust dann als Wahrheit über die Einrichtung der Welt behaupten. Sie, lieber Herr Schütte, treffen deshalb für meine Begriffe mit ihrem Verdacht, der Widerstand gegen Haneke sei ein Widerstand gegen ein "unerlaubtes ästhetisches, narratives, dramaturgisches System" die Sache zwar nicht ganz genau auf den Punkt. Aber in der Tat: Über alle ästhetischen, narrativen, dramaturgischen Probleme hinaus haben Michael Hanekes Filme eine Tendenz, das, was ich als innerstes Gesetz der Kunst begreife, mit Starrsinn und Bösartigkeit zu leugnen. Sie kämpfen gegen dieses ihr innerstes Gesetz. Und sie gewinnen, das ist das besonders Enttäuschende, diesem Kampf, den sie verlieren müssen, noch nicht einmal eine in sich wieder spannende Form ab.
Mit besten Grüßen, und Dank für Ihre Geduld,
Ekkehard Knörer
was mich an Ihrer Replik auf meine Kritik an Hanekes Film am meisten ärgert - und sie ärgert mich in der Tat -, sind Ihre Unterstellungen. Die muss ich erst einmal beiseite räumen, bevor ich auf den Kern der Sache, also das ästhetische System Hanekes komme und die Gründe für meine Kritik daran und insbesondere an seinem jüngsten Film "Das weiße Band" - und von da dann sogar noch auf etwas viel Grundsätzlicheres, nämlich mein Credo als Kritiker.
Es ist mir wohl bekannt, dass meine Argumente gegen Haneke aus der Rezeptionsgeschichte des Regisseurs durchaus vertraut klingen. Tatsächlich habe ich meine Kritik nicht zuletzt als Versuch begriffen, die problematischen Aspekte seiner Kunst - zum Beispiel durch die Kontrastierung mit Lars von Trier - einmal möglichst scharf zu konturieren. Das bot sich beim "Weißen Band" an, weil der Film erstens weithin über den grünen Klee gelobt wurde und wird und mir andererseits ein von der Haneke-Malaise ganz besonders stark bestimmter Film scheint.
Ich fühle mich nicht darum sehr zu Unrecht in den Topf eines angeblichen deutschen Anti-Haneke-Konsenses geschmissen, besonders unangenehm daran dann noch der Psychose-Vorwurf als aparte Würze. Im übrigen halte ich es sowieso für die unfeine Art, jemanden, dessen Urteil einem nicht passt, erst mal nicht beim Argument zu nehmen, sondern ihm ein Herdenverhalten zu unterstellen, das dann zu allem Überfluss auch noch national - von psychopathologisch zu schweigen - zugerechnet wird. Und davon dann noch einmal abgesehen, halte ich Ihre Diagnose einer generalisierten Haneke-Verachtung hierzulande nicht nur im aktuellen Fall für falsch, weil mindestens undifferenziert. Sehr wohl erinnere ich mich an begeisterte Stimmen auch aus Deutschland zu mehr oder minder allen Haneke-Filmen seit "Bennys Video", seinem Durchbruch zu mindestens nationaler Beachtung.
Haneke war gewiss ein Regisseur, der die Kritik immer gespalten hat - an Befürwortern hat es aber, anders als Sie behaupten, niemals gefehlt. Ich verweise exemplarisch auf Andreas Kilbs Kritik in der Zeit zu "Bennys Video" (11.6.1993), der Untertitel "Michael Hanekes verstörendes Meisterwerk" sagt schon alles. Auch das ganze Arsenal der Pro-Argumente findet sich bereits in Kilbs Text. Und dass sich die Argumente seit Jahr und Tag gleichen und der Hut immer älter wird, muss ja nicht an der Borniertheit der Kritiker liegen. Es hat wohl eher damit etwas zu tun, dass die Hanekesche Ästhetik seit Jahr und Tag eine ähnliche ist - von den einen bewundert, von den anderen verachtet und im Ergebnis von den meisten, je nach Film, als mal mehr und mal weniger überzeugend betrachtet. Das sehe ich übrigens selber so und verweise darauf, dass ich andere Haneke-Filme, namentlich "Die Klavierspielerin" und "Cache", trotz meiner massiven und grundsätzlichen Probleme mit dem Regisseur, in positiverem Licht sehe als "Das weiße Band" (oder "Bennys Video" oder "Funny Games"). Kurzum: Der Hut, den Sie mir aufsetzen, der steht mir nicht, und die Suppe, in die Sie mich ungefragt reinrühen, esse ich nicht.
***
Und damit zum Kern der Sache: Michael Hanekes Ästhetik. Wahrscheinlich sind wir in der Beschreibung in einem Punkt nicht uneins. Beide sehen wir - wie er selbst - einen starken ethischen Impuls in Hanekes Kino. Er selbst leugnet nicht seine aufklärerischen Absichten - und wenn man ihn und die Filme da auch nur ein wenig ernst nimmt, wird man sagen dürfen: Er möchte, dass die Zuschauer klüger werden durch das, was sie in seinen Filmen sehen, erleben und, ja, erleiden. So allgemein formuliert, hätte ich noch nicht einmal etwas dagegen. Ich bin ein Freund der Aufklärung, auch in der Kunst, und ich halte es für alles andere als verwerflich - anders als etwa die Fragesteller im aktuellen Spiegel-Interview -, wenn ein Regisseur nicht Beruhigung und Unterhaltung als oberstes Ziel seines filmischen Tun und Trachtens begreift.
(Wobei, möglicherweise muss man das tatsächlich dazusagen, ich gegen Unterhaltung auch nichts habe. Vielmehr ist mein einziges Dogma, durchaus typisch aufklärerisch, die Dogmenkritik: Als Kritiker stelle ich jedes Ding nach Möglichkeit in den Rahmen, in den es gehört. Weder das Strenge noch das Luftige, weder das Obszöne noch das Heilige, weder die Kunst noch das Entertainment, weder das Hochkontrollierte noch das Aus dem Ruder Gelaufene, weder das Verstiegene noch das Populäre finde ich per se gut oder schlecht. Es ist einerseits immer der Einzelfall, auf den es ankommt. Ein Film kann auf grandiose Weise aus dem Ruder laufen, aber auf genauso großartige Weise auch überaus kontrolliert komponiert sein. Ich kann Primitives toll finden und Sublimes, Gewalt und Vergeistigung, Intellektualität und Somatik und so weiter, ist ja klar, worauf ich hinauswill.)
Diese Klärung scheint mir nötig, weil sie deutlich macht, auf welcher Ebene ich Haneke kritisiere. Nicht dafür, dass seine Filme streng sind oder hoch kontrolliert oder humorlos. Sondern dafür, auf welche Weise sie streng sind (nämlich: verbissen) und kontrolliert (nämlich: kontrollfetischistisch) und humorlos (nämlich: gegen die Freiheit gerichtet, die dem Humor innewohnt). Sehr erstaunt bin ich allerdings im Licht meines Textes zu "Das weiße Band", ein sehr wichtiges Argument gegen Haneke in Ihrer Erwiderung nun als Argument für ihn anzutreffen. Ich zitiere: "Ich gebe zu, dass ich mich nicht nur im Alltag, sondern erst recht in der Kultur besser aufgehoben und animiert sehe, wenn ich mich als (Mit)Produzent, statt als traktierter Konsument angesprochen sehe & fühle: im Film so gut wie in der Literatur."
Eben das, so mein Einwand gegen Hanekes Filme, ist doch nicht der Fall. Sie sind totalitär, weil sie gerade nicht auf das Mitdenken, die Freiheit des Betrachters zu eigenem Fühlen und Dünken, kurzum: auf die Mitproduktion, auf die Offenheit eines Prozesses hinauswollen, sondern auf die Konsumtion - also: auf das Schlucken der bitteren Arznei, die da wieder und wieder verabreicht wird. Sie verstehen sich in genau diesem Sinn, dabei bleibe ich, als "Schauprozesse": Das Ergebnis, die Lehre, die Moral von der Geschichte möchten Hanekes Filme lückenlos festlegen und kontrollieren. Und was mich dann erst recht ärgert, ist die Selbstgerechtigkeit, mit der Haneke immer wieder eine textuelle Offenheit behauptet, deren Fehlen nicht nur das "Weiße Band" so ärgerlich macht. Was Haneke offen lässt, ist nicht offen, sondern eben offen gelassen - und das heißt: auch das Offene ist genau konturiert, bereits eingetragen ins Bild.
Gute Gelegenheit, auf den Ich-Erzähler zu kommen. In dem nämlich verkörpert sich das für meine Begriffe am besten. Erzähltheoretisch sind ein Ich-Erzähler und ein auktorialer Standpunkt sehr wohl vereinbar (der törichte Stanzel hat da manch Unheil angerichtet) - und insbesondere sind sie das, wenn das Ich, das da spricht, im Rückblick, also nicht als die in der Erzählung dann selbst auftretende Figur, berichtet. Den Eindruck, dass der Lehrer als Erzähler in "Das weiße Band" etwas offen lässt, gewinne ich allerdings gar nicht. Dafür ist die ideologiekritische - von mir als ätiologische bezeichnete - Moral von der ganzen Geschichte doch allzu offenkundig. Die Unsicherheit, von der der Ich-Erzähler da spricht, erscheint mir als reine und also falsche Behauptung. Und dieser Sachverhalt selbst, wie gesagt, als ganz und gar typisch für Hanekes größte Untugend: Er nötigt dem Betrachter sein Weltbild auf, er unterstellt ihm (und aller Welt) eine prinzipielle Unfreiheit, von der er dann (similia similibus curantur) nur durch die spezifische Form von "Vergewaltigung", als die Haneke seine Filme begreift, befreit werden kann. Wenn es dem Regisseur gelingt, dieses - sein erklärtes! - Programm durchzuziehen, kommen mit schöner Regelmäßigkeit so totalitäre wie selbstgerechte Filme heraus, "Funny Games" etwa oder "Das weiße Band". In anderen Fällen gelingt ihm die Schließung nicht (ganz), manchmal gerät ihm das Ganze zum Vexierbild mit "innerem Widerspruch" und dann wird es doch recht interessant, siehe "Cache".
***
Auf einen Absatz in Ihrer Replik möchte ich noch zurückkommen, weil er ins Zentrum der ästhetischen Fragestellung und damit auch über die üblichen, etwas vordergründigen Vorwürfe des Didaktischen und Totalitären bei Haneke hinaus- und in die Tiefe des Grundsätzlichen führt. Ich zitiere diesen Absatz:
"Ja, mein Gott, lieber Herr Knörer, sind Sie denn von allen guten Geistern verlassen? Was Sie an Hanekes Arbeiten inkriminieren, ist doch das innerste ästhetische Gesetz von Kunst & von Handwerk, wo alles an seinen Platz gehört und dies der Autor haargenau selbst bestimmt: ob es ein Tischler, ein Schriftsteller oder ein Filmregisseur ist!"
Tatsächlich bin ich, lieber Herr Schütte, von allen guten Geistern verlassen und sehe das anders. Ein Tisch ist kein Film und kein Buch. Ein Tisch erfüllt eine klare Funktion (gut oder schlecht), ein Film tut das nicht. Ein Tisch, der nicht steht, ein Stuhl, auf dem man nicht sitzen kann, sind ein Tisch und ein Stuhl, die nichts taugen. Wenn ich etwas als ästhetisches Artefakt betrachte, dann stelle ich es in einen anderen Rahmen. (Da kann ich, q.e.d. Duchamp, freilich auch einen Tisch und einen Stuhl hineinstellen.) Das Artefakt hat nicht a priori eine Funktion, keinen Gebrauchszweck, kennt keine Vorschrift und steht, etwas pathetisch gesagt, über dem Gesetz. Oder: Sein innerstes Gesetz lautet eben, dass sich ein Moment des Offenen und Unkontrollierbaren nicht austreiben lässt. Weder durch seinen Autor noch durch seinen Interpreten ist ein Kunstwerk ein- für allemal festzuschreiben. Das genau heißt es, würde ich sogar sagen, etwas, und sei es etwas das aussieht, wie ein Stuhl oder Tisch, ein Kunstwerk zu nennen.
Das heißt aber auch: Ich kann ein Werk - sagen wir: "Cache", sagen wir: "Inglourious Basterds" - gegen die Intentionen, die sein Schöpfer gehabt hat (oder: gehabt zu haben glaubt oder behauptet), verteidigen. Es steht immer zuerst für sich. Es ist, in einem noch anderen Wort: immer zuerst Text. Alles steht selbstverständlich immer in Kontexten, aber nicht so, dass sie den Text in einsinniger Weise determinieren. Seien diese Kontexte: der Autor, seine Intention oder sein Unbewusstes, die Sprache, die Gesellschaft, die Geschichte, Strukturen, die Theorie, die Ökonomie, die Episteme oder was immer an Determinismen man sich im Lauf der Ästhetikgeschichte so alles hat vorstellen können. Dies Momente sind immer im Spiel, aber nie so, dass sich der Text selbst je stillstellen ließe. Texte sind mithin Formen, aus denen die Möglichkeit von Ereignissen niemals auszuschließen ist, die sich darum der Kontrolle auch ihres Autors entziehen; sie sind Formen, die, jetzt im emphatischen Sinn der Dekonstruktion formuliert, der "Lektüre" zugänglich sind. Ganz wie das Leben selbst, dem sie darin auch gleichen.
So weit, so grundsätzlich. Soll heißen: Wer anderes behauptet, liegt in meinem Verständnis falsch. Daraus folgt aber etwas Entscheidendes für mein ästhetisches Urteil: Ich habe eine Präferenz - und zwar eine, die ich für aus dem "innersten Gesetz" der Kunst begründet halte -, für Filme, Bücher, Performances, Kunstwerke etc. pp., die innere Widersprüche nicht leugnen. Die, um es jetzt nicht auf den Begriff des Widerspruchs festzulegen: jene Momente, die sich jedweder Kontrolle entziehen, also "Ereignisse", also "Lektüre", mindestens zulassen. Die nach Formen für diese Momente der Freiheit sogar suchen. Das kann in durchaus strengen Formen der Fall sein, sagen wir, weil sie mir gerade einfallen und weil ich sie so liebe, in den Filmen von Angela Schanelec oder Hong Sang-soo. (Strenge Formen sind, gegen den ersten Anschein, sogar besonders geeignet dafür, weil sie das Moment des Widerstands, das zu dem der Freiheit gehört, gleich mit sichtbar machen.)
Ein Buch, ein Film, die so tun, als hätten sie alles im Griff, als wäre es möglich, alles an haargenau den richtigen Platz zu stellen, als könne man den Rand des Werks mit Nadel und Faden vernähen, sind dagegen ein Selbstwiderspruch. Zwar also ein Widerspruch, aber ein schlechter und ideologischer: Sie eröffnen nichts, sondern verschließen sich der Freiheit, die in ihrem Innersten wohnt. Es gibt die unterschiedlichsten Arten, sich der Freiheit zu öffnen, sie reichen ganz sicher von Hitchcock bis Kiarostami und an beiden Enden darüber hinaus (bei Kubrick beginne ich in Ihrer Beispielreihe freilich zu zögern; auch, horribile dictu, bei manchen Filmen der Straubs). Lars von Trier schätze ich dafür, dass er in vielen - nicht allen! - seiner Filme den Widerspruch auf allen Ebenen offensiv sucht. Ja, das ist oft ein heilloses Durcheinander, aber es ist das eine - so meine Behauptung - bei aller Bösartigkeit das Leben in letzter Instanz bejahende Heillosigkeit. Nochmal anders: Lars von Trier ist seinem Naturell nach durchaus totalitär - aber in seinen besten Filmen fliegen die Fetzen, weil da ein Kampf des Totalitären und Auktorialen gegen sich selbst zum Austrag kommt.
Haneke aber ist für mich ein Geist, der stets verneint. Seine Filme sind Exerzitien, die die Freiheit leugnen und, schlimmer noch, aus ihrem Inneren auszutreiben versuchen - und diese ihre Verneinungslust dann als Wahrheit über die Einrichtung der Welt behaupten. Sie, lieber Herr Schütte, treffen deshalb für meine Begriffe mit ihrem Verdacht, der Widerstand gegen Haneke sei ein Widerstand gegen ein "unerlaubtes ästhetisches, narratives, dramaturgisches System" die Sache zwar nicht ganz genau auf den Punkt. Aber in der Tat: Über alle ästhetischen, narrativen, dramaturgischen Probleme hinaus haben Michael Hanekes Filme eine Tendenz, das, was ich als innerstes Gesetz der Kunst begreife, mit Starrsinn und Bösartigkeit zu leugnen. Sie kämpfen gegen dieses ihr innerstes Gesetz. Und sie gewinnen, das ist das besonders Enttäuschende, diesem Kampf, den sie verlieren müssen, noch nicht einmal eine in sich wieder spannende Form ab.
Mit besten Grüßen, und Dank für Ihre Geduld,
Ekkehard Knörer
Kommentieren