Intervention
Offen gelegte Diskussionen
Von Peter Truschner
21.05.2024. Juliane Liebert und Ronya Othmann haben in einem Zeit-Artikel offengelegt, wie bei dem Internationalen Literturpreis des Hauses der Kulturen der Welt entgegen den Versprechungen des Hauses nicht die literarische Qualität obsiegte, sondern Ideologie. Dafür sind sie vom Betrieb scharf angegriffen worden. Eine Verteidigung der beiden Autorinnen.In der aktuellen Ausgabe der Zeit haben die Autorinnen Juliane Liebert und Ronya Othmann über den für sie unerfreulichen Verlauf einer Jurysitzung am Berliner Haus der Kulturen der Welt (HKW) im Zuge der Verleihung des "Internationalen Literaturpreises" berichtet. Liebert und Othmann stießen sich vor allem daran, dass die Vergabe - anders, als in den Statuten vorgesehen - nicht nach dem Kriterium literarischer Qualität, sondern im Abgleich mit gängigen identitätspolitischen Narrativen erfolgte. Die betreffenden Jury-Mitglieder haben - so Liebert - erst gar nicht versucht, das zu verbergen, und sie stattdessen beschieden, dass sie "als weiße Frau gar nichts zu sagen hat". Andere Jury-Mitglieder bestreiten, diesen Satz gesagt zu haben, wie das Haus der Kulturen in einer "Richtigstellung" vom heutigen Dienstag darlegt. Viele Behauptungen in dem Zeit-Artikel seien unrichtig, heißt es da: Auch "die Darstellung, die Abstimmungen über Shortlist und Gewinner seien das Ergebnis einer identitätspolitischen Entscheidungsfindung, in der Schwarze Autor*innen gegenüber 'weißen' bevorzugt würden, ist falsch. Richtig ist, dass es auch zu politischen Diskussionen kam; aber ausschlaggebend war die literarische Qualität der Texte."
Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Othmann-Liebert-Artikels hatte es von Seiten des Betriebs sofort Kritik gehagelt. FAZ-Redakteur Andreas Platthaus monierte die Verletzung des Jury-Geheimnisses. Nele Pollatschek beschied Othmann und Liebert in der SZ durch die Blume, sie sollten sich mal nicht so haben, ihr heutiges Dasein als Schriftstellerinnen hätten sie auch nur identitätspolitischen Aktivistinnen wie den Suffragetten zu verdanken.
Juliane Liebert hat sich in der Berliner Zeitung nochmal bemerkenswert klar gegen die Vorwürfe gewehrt (Unser Resümee): "Wir haben versucht, das Problem intern zu klären, und das HKW darauf angesprochen. Anschließend hat das HKW erst auf subtilen Druck hin überhaupt das Gespräch mit uns gesucht, und dann den Rest der Jury belogen. Das waren eben keine 'normalen' Machtspielchen, Hahnenkämpfe und Lobbykonkurrenzen, wie sie in jeder Jury vorkommen. Sondern es war die offene Missachtung des Primats der Literatur. Über die man anschließend die Öffentlichkeit belügt, wohlgemerkt."
Der heftigste Angriff war von der Literaturfunktionärin Insa Wilke im Freitag erfolgt. Es lohnt sich, diese Erregung in Textform genauer anzuschauen.
Wilke behauptet, es stehe "ein schwerer Vorwurf" im Raum. Inwiefern? Dass am HKW kulturpolitische Hegemonie im Sinne der vom Haus vertretenen Narrative und Diskurse waltet, ist nichts Neues. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, sondern längst Business as Usual an international bedeutenden Kulturinstitutionen und Kunsthochschulen. Insofern kann der Artikel gar nicht "diffamierend" sein, und schon gar nicht "das HKW beschädigen", das ein unzerstörbarer Millionen-Tanker deutscher Hochkultur ist. Betriebsmäßig subventioniert von Kunstministerium und Auswärtigem Amt, werden Programm-Formate noch mal üppig gefördert, die "Transmediale" etwa vom Berliner Senat, der Europäischen Union, der Bundeszentrale für Politische Bildung und dem Medien Board Brandenburg.
Wenn Bonaventura Ndikung 2025 als Chefkurator der "Sao Paulo Biennale" tätig ist, kratzt diese "Diffamierung" nicht nur in Brasilien genau niemand.
Nachdem sie noch mal die "Perfidie" der Angelegenheit betont, behauptet Wilke, dass eine "Notwendigkeit (…) für eine Gesellschaft, die Regeln braucht", darin besteht, dass "Jury-Mitglieder darauf vertrauen können, dass von ihren Diskussionen nichts nach außen dringt". Was einigermaßen skurril ist, da Wilke als einstige Vorsitzende des Bachmann-Preises in Klagenfurt eine Veranstaltung leitete, die zeigt, dass offen gelegte Diskussionen dem Publikum nicht nur zumutbar, sondern von ihm äußerst erwünscht sind.
"Die Politisierung der Literaturkritik schnürt der reinen Literatur die Luft ab", konstatiert Wilke, um später zu behaupten, dass es "eine Illusion" ist, zu glauben, man könne als Jury "rein literarisch urteilen, würde keine Literaturpolitik betreiben".
Wie man bei dieser Konstellation überhaupt zu Urteilen über "reine Literatur" kommen kann, bleibt rätselhaft. Anstatt sich wie "Othmann und Liebert auf die Suche nach dem Gral des besten Buches zu machen", tut man mit Blick "auf gesellschaftliche Entwicklungen" besser daran "machtpolitische Strukturen" im Literaturbetrieb "wahrzunehmen und zu verändern". Wie Pollatschek in der SZ sieht Wilke hier eine Parallele zur Frauenbewegung (eine Patrone, die sich offensichtlich immer im Colt befindet), und setzt sie im Sinne der "Sichtbarmachung" in Zusammenhang mit dem Vorgehen der HKW-Jury - als ob ausgerechnet Feministinnen der ersten Stunde zwei jungen Autorinnen, die aus innerer Notwendigkeit einen "Regelbruch" (Wilke) begehen, mit Forderungen nach mehr"Anstand" kommen würden, wie Wilke das in der Überschrift und noch mal am Ende ihres Artikels tut.
Eine Anekdote noch als Sahnehäubchen: Auf ihrem Instagram-Account wurde Juliane Liebert noch mit einer Variante der Nazi-Keule konfrontiert. Die Kuratorin Anna Jäger beschuldigte sie, rechtem Kulturkampf zuzuarbeiten und verantwortlich dafür zu sein, dass in der rechten Zeitung Junge Freiheit von Rassismus gegen Weiße die Rede ist. Jäger gehört zum kuratorischen Team von Savvy Contemporary, einem Berliner Kulturverein, der von Bonaventure Ndikung gegründet wurde.
Auch hier zur betrieblichen Einordnung: Allein für ein einmaliges Joint Venture-Projekt mit der Berliner panke.gallery erhielt Savvy Contemporary 2021/22 vom Berliner Senat eine Förderung in Höhe von 257.600 Euro. Noch mal in Ruhe für alle KünstlerInnen, die sich in Berlin kein Atelier mehr leisten können, mehrere Jobs gleichzeitig annehmen müssen, um ihre Kunst ausüben zu können, oder als allein erziehender Elternteil politisch überhaupt von allen verlassen sind: zweihundertsiebenundfünfzigtausendsechshundert Euro.
Und ob man es glaubt oder nicht: Savvy Contemporary besitzt tatsächlich die Chuzpe, auf der vereinseigenen Website um Spenden zu bitten, da "unsere finanzielle Lage als unabhängiger Kunst-Raum prekär ist".
Wenn Platthaus, Pollatschek und Wilke sich anstrengen, würden sie im Berliner Kulturbetrieb auf ganz andere "Skandale" stoßen als ausgerechnet die Zivilcourage zweier Autorinnen, die sich an ihr eigentliches Gegenüber erinnern - die Öffentlichkeit -, und ihr das schenken, was es für sie in Deutschland nur ganz selten gibt: Transparenz.
Peter Truschner
Unmittelbar nach der Veröffentlichung des Othmann-Liebert-Artikels hatte es von Seiten des Betriebs sofort Kritik gehagelt. FAZ-Redakteur Andreas Platthaus monierte die Verletzung des Jury-Geheimnisses. Nele Pollatschek beschied Othmann und Liebert in der SZ durch die Blume, sie sollten sich mal nicht so haben, ihr heutiges Dasein als Schriftstellerinnen hätten sie auch nur identitätspolitischen Aktivistinnen wie den Suffragetten zu verdanken.
Juliane Liebert hat sich in der Berliner Zeitung nochmal bemerkenswert klar gegen die Vorwürfe gewehrt (Unser Resümee): "Wir haben versucht, das Problem intern zu klären, und das HKW darauf angesprochen. Anschließend hat das HKW erst auf subtilen Druck hin überhaupt das Gespräch mit uns gesucht, und dann den Rest der Jury belogen. Das waren eben keine 'normalen' Machtspielchen, Hahnenkämpfe und Lobbykonkurrenzen, wie sie in jeder Jury vorkommen. Sondern es war die offene Missachtung des Primats der Literatur. Über die man anschließend die Öffentlichkeit belügt, wohlgemerkt."
Der heftigste Angriff war von der Literaturfunktionärin Insa Wilke im Freitag erfolgt. Es lohnt sich, diese Erregung in Textform genauer anzuschauen.
Wilke behauptet, es stehe "ein schwerer Vorwurf" im Raum. Inwiefern? Dass am HKW kulturpolitische Hegemonie im Sinne der vom Haus vertretenen Narrative und Diskurse waltet, ist nichts Neues. Es ist auch nichts Ungewöhnliches, sondern längst Business as Usual an international bedeutenden Kulturinstitutionen und Kunsthochschulen. Insofern kann der Artikel gar nicht "diffamierend" sein, und schon gar nicht "das HKW beschädigen", das ein unzerstörbarer Millionen-Tanker deutscher Hochkultur ist. Betriebsmäßig subventioniert von Kunstministerium und Auswärtigem Amt, werden Programm-Formate noch mal üppig gefördert, die "Transmediale" etwa vom Berliner Senat, der Europäischen Union, der Bundeszentrale für Politische Bildung und dem Medien Board Brandenburg.
Wenn Bonaventura Ndikung 2025 als Chefkurator der "Sao Paulo Biennale" tätig ist, kratzt diese "Diffamierung" nicht nur in Brasilien genau niemand.
Nachdem sie noch mal die "Perfidie" der Angelegenheit betont, behauptet Wilke, dass eine "Notwendigkeit (…) für eine Gesellschaft, die Regeln braucht", darin besteht, dass "Jury-Mitglieder darauf vertrauen können, dass von ihren Diskussionen nichts nach außen dringt". Was einigermaßen skurril ist, da Wilke als einstige Vorsitzende des Bachmann-Preises in Klagenfurt eine Veranstaltung leitete, die zeigt, dass offen gelegte Diskussionen dem Publikum nicht nur zumutbar, sondern von ihm äußerst erwünscht sind.
"Die Politisierung der Literaturkritik schnürt der reinen Literatur die Luft ab", konstatiert Wilke, um später zu behaupten, dass es "eine Illusion" ist, zu glauben, man könne als Jury "rein literarisch urteilen, würde keine Literaturpolitik betreiben".
Wie man bei dieser Konstellation überhaupt zu Urteilen über "reine Literatur" kommen kann, bleibt rätselhaft. Anstatt sich wie "Othmann und Liebert auf die Suche nach dem Gral des besten Buches zu machen", tut man mit Blick "auf gesellschaftliche Entwicklungen" besser daran "machtpolitische Strukturen" im Literaturbetrieb "wahrzunehmen und zu verändern". Wie Pollatschek in der SZ sieht Wilke hier eine Parallele zur Frauenbewegung (eine Patrone, die sich offensichtlich immer im Colt befindet), und setzt sie im Sinne der "Sichtbarmachung" in Zusammenhang mit dem Vorgehen der HKW-Jury - als ob ausgerechnet Feministinnen der ersten Stunde zwei jungen Autorinnen, die aus innerer Notwendigkeit einen "Regelbruch" (Wilke) begehen, mit Forderungen nach mehr"Anstand" kommen würden, wie Wilke das in der Überschrift und noch mal am Ende ihres Artikels tut.
Eine Anekdote noch als Sahnehäubchen: Auf ihrem Instagram-Account wurde Juliane Liebert noch mit einer Variante der Nazi-Keule konfrontiert. Die Kuratorin Anna Jäger beschuldigte sie, rechtem Kulturkampf zuzuarbeiten und verantwortlich dafür zu sein, dass in der rechten Zeitung Junge Freiheit von Rassismus gegen Weiße die Rede ist. Jäger gehört zum kuratorischen Team von Savvy Contemporary, einem Berliner Kulturverein, der von Bonaventure Ndikung gegründet wurde.
Auch hier zur betrieblichen Einordnung: Allein für ein einmaliges Joint Venture-Projekt mit der Berliner panke.gallery erhielt Savvy Contemporary 2021/22 vom Berliner Senat eine Förderung in Höhe von 257.600 Euro. Noch mal in Ruhe für alle KünstlerInnen, die sich in Berlin kein Atelier mehr leisten können, mehrere Jobs gleichzeitig annehmen müssen, um ihre Kunst ausüben zu können, oder als allein erziehender Elternteil politisch überhaupt von allen verlassen sind: zweihundertsiebenundfünfzigtausendsechshundert Euro.
Und ob man es glaubt oder nicht: Savvy Contemporary besitzt tatsächlich die Chuzpe, auf der vereinseigenen Website um Spenden zu bitten, da "unsere finanzielle Lage als unabhängiger Kunst-Raum prekär ist".
Wenn Platthaus, Pollatschek und Wilke sich anstrengen, würden sie im Berliner Kulturbetrieb auf ganz andere "Skandale" stoßen als ausgerechnet die Zivilcourage zweier Autorinnen, die sich an ihr eigentliches Gegenüber erinnern - die Öffentlichkeit -, und ihr das schenken, was es für sie in Deutschland nur ganz selten gibt: Transparenz.
Peter Truschner
9 Kommentare








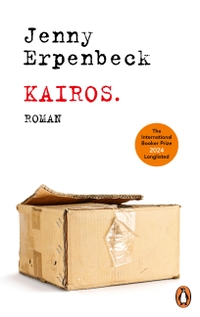 Jenny Erpenbeck: Kairos
Jenny Erpenbeck: Kairos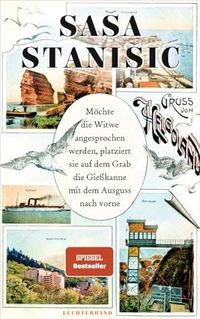 Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne
Sasa Stanisic: Möchte die Witwe angesprochen werden, platziert sie auf dem Grab die Gießkanne mit dem Ausguss nach vorne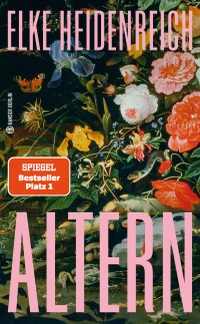 Elke Heidenreich: Altern
Elke Heidenreich: Altern Jenny Erpenbeck: Heimsuchung
Jenny Erpenbeck: Heimsuchung