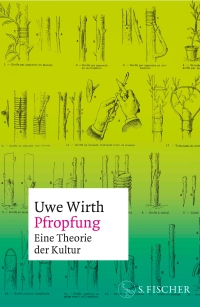Essay
Wir kennen sogar die Antworten
Von Daniele Dell'Agli
22.05.2017. Andres Veiels "Beuys" wirbt in der geschlossenen Ästhetik eines virtuosen Filmessays für die offene Ästhetik von Beuys' "Sozialen Plastiken". Die eigentliche soziale Plastik wäre heute das Netz, das jedem die Möglichkeit bietet, kreativ zu werden: Aber was ist, wenn am Ende Werke bleiben?"Beuys" - heißt lapidar der neue Film von Andres Veiel. Und damit scheint alles gesagt: es geht um den vor 31 Jahren verstorbenen deutschen Künstler Josef Beuys. In seiner schmucklosen Kürze soll der Titel auf einen Film nicht nur über, sondern auch mit und womöglich für Beuys einstimmen. Doch Lapidarität hat ihre Tücken. Alles Lapidare ist, seiner Etymologie entsprechend, steinern. Als lapidar gelten altrömische Grabinschriften wie NFFNSNC1. Ein Lapidarium ist als Ansammlung von steinernen Artefakten Inbegriff jener Art von Musealisierung, die Beuys zeitlebens gemieden oder bekämpft hat. Der Film will denn auch das Gegenteil eines Denkmals sein, er will uns einen lebendigen und mehr denn je aktuellen Beuys zeigen. Er hätte gut einen offensiven Titel vertragen, etwa: "Wer hat Angst vor Josef Beuys?"
Dass dieses filmische Porträt kein gewöhnlicher Dokumentarfilm und mehr als ein ambitionierter Filmessay ist, konnte man den Kritiken nach der Uraufführung auf der Berlinale bereits entnehmen und wer sich ins Kino aufmacht, ist gut beraten, die entsprechende, professionell kompilierte Wikipedia-Seite zu konsultieren, die alles Wissenswerte versammelt, von den gesichteten Archivbeständen (20.000 Fotos, 400 Stunden Video-, 300 Stunden Audiomaterial) über das beachtliche Repertoire der eingesetzten Filmtechnik bis hin zu einem Leitfaden für die dramaturgische Abfolge der Szenen und der darin gezeigten Werke. Basales Vorwissen schadet in diesem Fall nicht, denn Veiel erzählt Beuys nicht, er zeigt ihn - seine Aktionen, seine Werke, seine Auftritte - und er verzichtet darauf, dem Zuschauer die Ordnung des Gezeigten narrativ, chronologisch, thematisch oder etwa durch ein kommentierendes Voice-over vorzugeben. Dieser muss seine eigene assoziative Logik bemühen, um das kaleidoskopische Bild zusammenzusetzen.
Immerhin gibt es eine leitmotivische Strukturierung: jede Episode nimmt ihren Ausgang von einem Gedächtnistableau, auf dem Veiel sein Material ausbreitet - zahllose dokumentarfilmische Momentaufnahmen, zu Standbildern fixiert, horizontal wie vertikal in Kontaktabzügen angeordnet. Darüber schwebt die Kamera und gleitet wie ein Raubvogel über der Meeresoberfläche, unter der sich die schimmernden Umrisse zahlloser Beutefische abzeichnen, um dann im Sturzflug hinabzutauchen, das ausgewählte Foto zu vergrößern und zum Leben des dahinter verborgenen Filmausschnitts zu erwecken. Schwenk und Zoom sind jedoch für gewöhnlich Techniken on location oder auf dem Set, nicht am Schneidetisch oder am digitalen Schnittplatz. Dass eine Montage sich an die mise-en-scène von dokumentarischem Material versucht, hat man so auch noch nicht gesehen. Damit erzeugt der Regisseur - der seinen brillanten Technikern (Olaf Voigtländer und Stephan Krumbiegel) weitgehend freie Hand ließ - eine Dynamik, die suggeriert, dass diese historischen Dokumente gleichsam Jahrzehnte lang die Luft angehalten und in einer Art Duldungsstarre nur darauf gewartet haben, an Bord unserer Gegenwart geholt zu werden.
Dieses ausgeklügelte und cinéastisch überaus reizvolle Verfahren tendiert allerdings dazu - eine vermutlich unbeabsichtigte Nebenwirkung - die essayistische Dokumentation in einen experimentellen Spielfilm zu verwandeln. Ein Eindruck, der durch die implizite Erzählweise verstärkt wird, die auf unkommentiertes Zeigen und damit auf Präsenz statt Information setzt. Und auch der (abgesehen von den Buschtrommeln zur Uni-Revolte) unaufdringlich-filigrane Soundtrack akzentuiert Stationen eines Episodendramas eher als Kapitel eines realen Lebenslaufs. Ohne dem Zuschauer je aufzudrängen, was er fühlen soll, aber auch ohne seinen Empathiestrom je versiegen zu lassen - auch dies per se eine erstaunliche Leistung - stimmt die Musik (Ulrich Reuther, Damian Scholl) ihn auf eine paradoxe Haltung zu den spröden Schwarzweißaufnahmen ein, die man vielleicht als innige Befremdlichkeit charakterisieren könnte: besonders die Aktionen der sechziger und siebziger Jahre erfahren eine Auratisierung, die sie in weite Ferne rückt, obwohl sie uns zugleich unmittelbar daran teilnehmen lässt.
Die mittlere, nüchtern objektivierende und zugleich informierende Distanz von Dokumentarfilmen, auch essayistischen, ist von Veiel auch nicht intendiert: sein begnadeter Hauptdarsteller agiert entweder rastlos vital mit den rätselhaften Gebärden eines Aliens oder glüht nach, verletzlich und vertraut, in den ruhigen Momenten der Erschöpfung. Und immer einsam. Mal ist es die Einsamkeit eines politischen Einzelkämpfers, dann die eines unverstandenen Künstlers und immer schwingt die des tragischen Helden mit, der sich stellvertretend für die tumbe Gesellschaft opfert. Unabhängig von der Frage, inwieweit diese Einsamkeit besonders den späten Beuys - Professor ohne Lehrstuhl, Volkstribun ohne Volk, Künstler ohne Werk - tatsächlich umgab, resultiert sie im Porträt zwangsläufig aus der dramaturgischen Loslösung seiner Figur vom historischen Kontext.
Diese ambivalente Hauptrolle macht Beuys streckenweise die Montage streitig, wenn sie als solche erkennbar wird als Puls und Rhythmus bestimmender Akteur des Films. Worauf man sich als Zuschauer jeweils einlassen kann, ist letztlich eine Frage des Tempos im Bildwechsel selbst: je langsamer desto mehr Beuys, je schneller desto mehr Montage. Die zunächst noch irritierenden Bruchstellen werden allerdings - im Konzert mit anderen raffinierten Filmtechniken wie Split Screen oder Trickfilmanimationen - seriell zu einem suggestiven Bilderfluss verkettet, der dem Film zwar eine hohe formale Geschlossenheit beschert, tendenziell aber die Transparenz wieder rückgängig macht, mit der er das Archivmaterial geöffnet und den Zuschauer komplizenhaft am Auswahlverfahren beteiligt hatte. Denn das rasante glide-and-pick verrät nichts über die Motive und Zwänge, die Zweifel und die auktorialen Entscheidungen, die den Entstehungsprozess begleitet haben. Gesprächsweise erzählt der Regisseur in Interviews dann bereitwillig vom Zustandekommen der einen oder anderen Sequenz und ich stelle mir vor, was die Zwischenschaltung gemeinsamer Überlegungen des Teams aus dem Off innerhalb des Films bewirkt hätte. Dass sie den Kontext einer homogenen Faszinationsgeschichte gesprengt hätten, ist nämlich keineswegs ausgemacht. In jedem Fall aber hätten solche reflexiven entr'actes dem Zuschauer geholfen, die unendliche Mühe dieser Bearbeitung zweiter Potenz in ein Verhältnis zur leichthändigen Eleganz des Resultats zu setzen.
Wenn es legitim ist, an einem formal, stilistisch und konzeptuell derart elaborierten Filmkunstwerk Kritik anzumelden, dann nur im Hinblick auf seinen Anspruch, die Aktualität von Josef Beuys zu erweisen. Dann lautet die Frage schlicht: kann man mit einer geschlossenen Ästhetik für eine offene werben? Und was könnte im Transfer von einer visuellen Kunst zur anderen eine Öffnung für das Überspringen des Funkens sein, wenn man bedenkt, dass die Ungeduld filmischer Beobachtung sich denkbar schlecht dafür eignet, den für Beuys zentralen "Protestcharakter der Materie" (Klaus Heinrich) und ihrer langsamen Metabolismen einzufangen? Wie könnte die Präsenz eines anderen Mediums oder einer anderen Zeitschicht die Wahrnehmung für das heute Anschlussfähige von Beuys Ansatz sensibilisieren?
Veiel war sich des Problems durchaus bewusst und hat wohl auch deshalb zum einen an "das Haptische analoger Fotokunst" (Kontaktbögen, Verwitterungsprozesse) erinnern wollen, was, wie angedeutet, vom Sog der virtuosen Montagetechnik mehr geschleift als in seiner Widerständigkeit spürbar gemacht wird. Zum anderen markiert die Konterkarierung des graustufigen Archivmaterials mit den warmbraun ausgeleuchteten talking heads zwar einen Zeitsprung, die Schilderungen tragen allerdings wiederum nur zur Charakterisierung einer extravaganten Persönlichkeit bei. Analysen oder Begriffe, die eine Außenansicht von Beuys' Provokationen, den Krisensymptomen der damaligen Kunstszene oder Einschätzungen des zeitgeschichtlichen Hintergrunds2 erlaubt hätten, fallen nicht. Veiel vermeidet alles, was auch nur im entferntesten belehrend wirken könnte und verlässt sich ganz auf die faszinierende Ausstrahlung seines Sujet. Der Verzicht auf jedweden orientierenden Kommentar aber entlässt den Zuschauer am Ende elektrisiert, bildgesättigt, filmberauscht - und sprachlos. Mag sein, dass ein Bild mehr sagt als tausend Worte. Aber wahr wäre der ausgelutschte Spruch nur mit seinem Komplement: ein Begriff bringt tausend Bilder zum Sprechen.
Es entbehrt nicht einer kunsthistorischen, genauer: einer wirkungsgeschichtlichen Ironie, wenn wir 2017 im kommentarabstinenten Filmporträt eines Künstlers, der schon zu Lebzeiten wie kaum ein anderer Arnold Gehlens Diktum von der Kommentarbedürftigkeit der modernen Kunst nicht zuletzt durch wortreiche Selbstkommentare bewahrheitet hatte, nun erleben, wie ausgerechnet dieser Künstler von besagtem Philosophen 1970 auf einer Podiumsdiskussion herausfordert wird: "Warum haben Sie nicht Kinderwagen genommen?" Gehlen spielte auf das berühmte Rudel (VW-Bus mit herausquellenden filzbepackten Schlitten) an und Beuys wechselte sogleich auf die performative Ebene, um sich schlagfertig, aber ohne auf die Frage (und die mit ihr ausgelegte Falle) einzugehen, die Lacher des Publikums zu sichern. Für ihn war dieser Auftritt ohnehin bereits ein Rückzugsgefecht vor seinem Abschied von einer werkbasierten Kunst und der Proklamierung des "erweiterten Kunstbegriffs", in dessen Namen er zwei Jahre später auf der Documenta 5 statt eines neuen Werks ein "Büro für direkte Demokratie" vorstellte, in dem 100 Tage lang über die Zukunft politischer Partizipation debattiert wurde.
Den Mitschriften der damals geführten Gespräche,3 die eine neue Phase in Beuys Entwicklung eröffneten, kann man entnehmen, wie obsessiv er sich mit dem Zusammenhang von Kreativität, Kapital und Demokratie beschäftigt hat und dass er die richtigen Fragen formulierte, wie Veiel, der dessen Engagement aus den Filmarchiven rekonstruiert, im Presseheft erläutert.4 Man spürt aber auch durchgehend die Ohnmacht unscharfer Begriffe, die mit unausgewiesenen Prämissen arbeiten. Nun ist es nicht Sache eines Künstlers, präzise zu argumentieren, und nachvollziehbar ist auch, dass ein Künstler sich Novalis' Bestimmung der Einbildungskraft als produktives Vermögen des Subjekts, Wirklichkeit zu erschaffen, zu einer Lizenz kreativer Gestaltung umdefiniert; aber was ist damit gewonnen? Die "unsichtbare Skulptur" beginne im Denken, beim Sprechen, doziert der Meister - und ende in einer vergeistigten Materie, die man Form nennt: wem außerhalb der Kunst soll diese Philosophie zur Orientierung dienen? Die Social Sculpture Research Unit der Oxford University bietet unter der Leitung der Beuys-Schülerin Sally Sacks sogar Studiengänge an, auf denen man lernen kann, den "schöpferischen Ausdruck als Mittel politischer Aktivität" zu begreifen - als ob das nicht zum Beispiel Hausbesetzer auf der ganzen Welt (um nur sie zu nennen) ohnehin schon tun, spontan und selbstredend ohne anthroposophische Anleitung.
Mit der inflationären Aufblähung ihres Umfangs verlieren Begriffe nicht nur an Trennschärfe, sondern auch an operativer Brauchbarkeit und damit an Attraktivität. Sie bleiben nur solange im Spiel, wie das Charisma ihres Erfinders für sie wirbt und potenzielle Interessenten zu begeistern vermag. Danach führen sie ein Eigenleben ganz nach Gutdünken ihrer Nutzer. Von Rosemarie Trockels "Jedes Tier ist eine Künstlerin" (ein Schweinehaus auf der Documenta X) ist es dann nur ein Wimpernschlag bis zu Karlheinz Stockhausens Verklärung des Twin-Tower-Attentats zum "größten Kunstwerk, das es im Kosmos gibt". So unberechenbar springen Assoziationen, wenn sie derart vage terminologisch angefüttert werden. Anders gesagt: man überschreitet Grenzen nicht, indem man sie für inexistent erklärt, auch nicht in der Welt des Geistes.
Beuys habe schon zu seiner Zeit die richtigen Fragen zum Finanzsystem gestellt, resümiert Veiel überrascht seine Archivrecherchen. Wir sehen und hören den Künstler warnen vor der sich verselbständigenden Macht des Geldes. Gut. Aber wie (und warum eigentlich) soll der Impuls, diese Macht zu brechen ausgerechnet von der Kunst ausgehen? Während auf der Athener Documenta viele richtige Fragen gestellt wurden, haben die Brüsseler Eurokraten den Griechen weitere Einsparungen von 3,6 Milliarden Euro aufoktroyiert.
Wir kennen alle die richtigen Fragen, wir kennen sogar die Antworten. Aber niemand ist bereit, etwas für ihre Umsetzung zu tun. Desgleichen scheint das Internet alle Kriterien für die größte denkbare "soziale Plastik" zu erfüllen gemäß der massendemokratischen Utopie von Brechts Radiotheorie ("Jeder Empfänger ist ein Sender", 1930). Doch während ein kleiner Prozentsatz der Akteure in den sozialen Netzwerken die Anonymität des virtuellen Raums dazu nutzt, die niedersten menschlichen Affekte und Gesinnungen zu mobilisieren, tauscht sich die überwältigende Mehrheit über Banalitäten von nicht zu überbietender Redundanz aus.
Damit wird das zentrale, auch im Film nicht fehlende Bekenntnis von Beuys vollends als reines Wunschdenken erkennbar: "Jeder Mensch ist ein Wesen, das kreativ sein kann, wenn ihm die Möglichkeit, kreativ zu sein, geschaffen wird." Tatsache ist, dass zu allen Zeiten in allen Kulturen immer nur sehr wenige Menschen - egal unter welchen Bedingungen - Neues erschaffen haben, das modellhaft, wegweisend oder wenigstens stilbildend für ihre oder eine kommende Zeit wurde. Es gibt offenbar eine anthropologische Trägheit, eine energetische Schwelle, die die Menschen daran hindert, in einem emphatischen Sinne je nach dem kreativ oder kriminell zu werden (nur so macht die alte Analogie zwischen Künstler und Verbrecher Sinn), eine Trägheit, die unter den saturierten Bedingungen spätkapitalistischer Komfortzonen ihr optimales Soziotop gefunden zu haben scheint. Alle Appelle (zuletzt von Peter Sloterdijk: Du musst dein Leben ändern ), gegen diese Inertia die womöglich schlummernden Potentiale der Selbststeigerung, Selbstverschwendung, Selbstverbrennung zu entfesseln, kommen daran gemessen einer grotesken Überforderung gleich.
Nach seinem Eindruck von der Beuys-Werkschau 1980 im New Yorker Guggenheim Museums befragt, gibt ein Besucher zur Antwort: "Wie Überreste von einer Baustelle." Ratlosigkeit ist auch ein Anfang und Baustellen bieten einer offenen Ästhetik jede Menge Ansatzpunkte. Beuys wusste selber darum, dass er die Frage nach dem Sinn der Kunst offen lassen muss: "Die Kunst ist nicht dazu da, unsere Wohnungen zu dekorieren. Die Kunst ist eine Waffe gegen den Feind, sagt Picasso. Die Frage ist: wer ist der Feind." Raoul Peck hatte es da einfacher in seinem ebenfalls auf der Berlinale (Panorama) gezeigten dokumentarischem Filmessay I am not your negro. Während er den Feind und damit sein Thema (Rassismus in den USA) von der ersten bis zur letzten Sekunde genau im Blick hat und das autobiographische Material von James Baldwin daraufhin inszeniert, scheint Veiel seines erst zu suchen in dem Maße, da Beuys, dem er bewundernd attestiert, permanent wie ein Hase "Haken zu schlagen", sich als Projektionsfläche für (kunst-)politische Diskurse oder Programme entzieht. Das bewahrt ihn aber auch davor, dieser erratischen Erscheinung das Fremde zu nehmen.
 Copyright: zeroonefilm / Ute Klophaus
Copyright: zeroonefilm / Ute Klophaus
Nun hat Veiel zwar in jenem Beuys, der aus der Kunst (wo er zu Weltruhm gelangt war) aufgebrochen war, um das politische Establishment (wo ihn niemand haben wollte) aufzumischen, das größere Aktualisierungspotential gesehen und dementsprechend sein Archivmaterial fokussiert. Und sein Film endet konsequent mit einem Ausblick auf 7000 Eichen, Beuys größtes Projekt, das auf unabsehbare Zeit weiterhin das Gesicht einer ganzen Stadt prägen wird und dessen beispiellose Erfolgsgeschichte nicht zuletzt darauf beruht, dass sein Konzept (Stadtverwaldung statt Stadtverwaltung) sich in wenigen Sätzen gleichsam von selbst erklärt. Doch neben den berühmten Aktionen und Installationen leuchten auch immer wieder Momentaufnahmen weniger bekannter früher Aquarelle und Mischtechniken auf, die weder rätselhaft noch kommentarbedürftig, vielmehr unmittelbar evident und in ihrer Art unvergleichlich sind. Etwa das Aufschrecken in der Nacht (1962), eine zum Piktogramm verdichtete Leidensikone lebendigen Begrabenseins - und dank des schmalen Ausstiegsschachts darin eine Waffe gegen den inneren Feind namens Depression. Kunst, die sich ganz traditionell "nur" an das jeweilige individuelle Gegenüber richtet, gewiss, diesem jedoch Medium von Selbsterkenntnis und Sensibilisierung für einen freieren Umgang mit den eigenen Zwängen sein kann.
Soziale Plastiken im vulgärdemokratischen Sinn des Wortes kann tatsächlich jeder machen; organisierte Interventionen im öffentlichen Raum sicher noch manche; unsterbliche Werke von existenzieller Dramatik jedoch immer nur jeweils einer. Jeder Mensch ein Künstler? Das Postulat gehört auf den Index. Es verstößt gegen das erste Gebot einer postreligiösen Ethik, das da lautet: Du sollst keine falschen Hoffnungen wecken!
Daniele Dell'Agli
1 Non fui, fui, non sum, non curo: Erst war ich nicht, dann war ich, jetzt bin ich nicht, hab keine Sorgen.
2 Um nur einige korrelierende Daten zu nennen: 1971 Aufhebung der Goldpreisbindung, Beginn der unkontrollierten Vermehrung des Papiergeldes und Deregulierung des Finanzsektors. Ebenfalls 1971 Beginn der Greenpeace-Aktionen, die erst vor Alaska und 1973 vor dem Mururoa-Atoll zu einem Stopp der Atomwaffentests führten. Hinsichtlich Fantasie, Logistik, wissenschaftlicher Recherche und Wagemut bis heute vorbildlich im Sinne der von Beuys proklamierten "Sozialen Plastik"; 1972 Bericht des Club of Rome über die "Grenzen des Wachstums".
3 Clara Bodemann-Ritter (Hg.): Joseph Beuys. Jeder Mensch ein Künstler. 1975 Ullstein-Verlag.
4 Die Gestaltbarkeit der Welt. Regienotizen von Andres Veiel. In: Beuys. Presseheft der Internationalen Berliner Filmfestspiele (Direktdownload über Google).