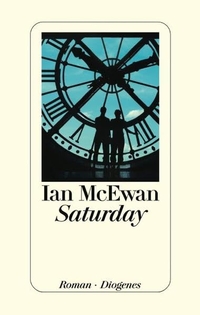Saturday
Roman
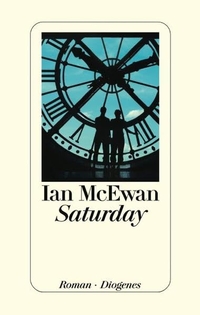
Diogenes Verlag, Zürich 2005
ISBN
9783257064940
Gebunden, 387 Seiten, 19,90
EUR
Klappentext
Aus dem Englischen von Bernhard Robben. Henry Perowne, 48, ist ein zufriedener Mann: erfolgreich als Neurochirurg, glücklich verheiratet, zwei begabte Kinder. Das einzige, was ihn leicht beunruhigt, ist der Zustand der Welt. Es ist Samstag, und er freut sich auf sein Squashspiel. Doch an diesem speziellen Samstag, dem 15. Februar 2003, ist nicht nur die größte Friedensdemonstration aller Zeiten in London. Perowne hat unversehens eine Begegnung, die ihm jeden Frieden raubt?
Rezensionsnotiz zu
Frankfurter Rundschau, 29.07.2005
Beeindruckt zeigt sich Christian Thomas von Ian McEwans neuem Roman, einer "grandiosen Studie über eine mentale Haltung, die an den bürgerlichen Tugenden und Sicherheiten einen Halt findet". Diese Haltung sieht er idealtypisch in McEwans Protagonisten Henry Perowne verkörpert, einem Neurochirurgen mit wohlgeordnetem Leben: er hat eine solide Ehe, ist intellektuell wie emotional ausgeglichen, spielt Squash, fährt einen Mercedes 500 S und begegnet, trotz gelegentlicher Zweifel und Unsicherheiten, der Bedrohung Londons durch den Terrorismus mit erstaunlicher "mentaler Robustheit". Die Konstruktion des Romans - die Handlung spielt an einem einzigen Tag, dem 15. Februar 2003, an dem in London über eine Millionen Menschen gegen den Irak-Krieg demonstrierten - findet Thomas gewaltig. Die nüchternen Diagnosen auf die Londoner Aussichten, die McEwan seinen Protagonisten Perowne anstellen lässt, nötigen dem Leser seines Ansicht nach "Furcht und Mitleid" ab. Schließlich gehöre zu den "fundamentalen Einsichten" von "Saturday", dass der urbane Organismus von London dem islamistischen Terror wie einer Fügung ausgeliefert sei. Thomas resümiert: "Mit beträchtlicher Tragödienwucht erzählt McEwan von der Latenzphase einer schrecklichen Erwartung jenseits aller Zuversicht."
Rezensionsnotiz zu
Die Zeit, 28.07.2005
Ulrich Greiner kann sich nicht helfen. Gewiss, Ian McEwans Roman "Saturday" sei ebenso "spannend" wie "virtuos", aber zufrieden ist er trotzdem nicht. Der Samstag im Leben des Londoner Neurochirurgen Henry Perowne, der immerhin eine Operation, einen Besuch bei seiner dementen Mutter, eine Antikriegsdemonstration, einen Überfall und mehr beinhaltet, sei großartig beschrieben und mit einer "geradezu aristotelischen Einheit von Ort, Zeit und Handlung" in Szene gesetzt. Trotzdem fühlt sich Greiner nach der Lektüre wie ein Variete-Besucher, der voller Verblüffung perfekten Zaubertricks beigewohnt hat, aber dann die Vorstellung "mit leerem Kopf" verlässt. McEwan beherrsche das schreiberische Handwerk perfekt, jedes Sujet, sei es Gehirnoperation oder Squash-Spiel, könne er besser beschreiben als jeder Spezialist. Aber die Form verdränge hier den Gehalt, meint Greiner. Wirklich große Schriftsteller hätten in ihren Werken - oft unbeabsichtigt - Fragezeichen hinterlassen, die bei McEwan fehlen, der nichts Innovatives hervorbringe, sondern nur "dem literarischen Common Sense die Krone aufsetzt". Das sei schon viel, gibt Greiner zu, aber er möchte anmerken, "dass es nicht alles ist".
Rezensionsnotiz zu
Süddeutsche Zeitung, 22.07.2005
Schlichtweg grandios findet Ijoma Mangold diesen Roman, mit dem Ian McEwan seiner Ansicht nach ein unglaubliche Provokation gelingt: Er feiert auf selten selbstzufriedene Weise das private Glück der westlichen Mittelklasse. Die Handlung spielt an einem Samstag, dem schönsten Tag der Woche, im Leben des Neurochirurgen Henry Perowne, der sich weder seine Ehe, noch seinen Konsum noch seinen Spaß am Squash-Spiel verderben lassen will. Nicht von der Politik, nicht von der Weltlage, nicht von terroristischer Bedrohung - und auch nicht von der negativen Ästhetik, die ein Glück in der Ehe für literarischen Schund hält. "Lieber einkaufen als beten", sagt sich Perowne in "polemisch-herausfordernder Unschuld", in der Mangold auch das ideologische Programm dieses bei aller Privaten Idylle durch und durch politischen Romans: Dem Kampf der Fundamentalisten mit ihrem Anspruch auf letzte Wahrheiten können westliche Relativisten eh nicht aufnehmen, erklärt Mangold den Gedanken, aber einen anderen Beweis können sie führen: Dass ihr Leben glücklicher macht. Ganz besonders an einem Samstag. Ian McEwan hat geschafft: "Dieses Buch ist kein Gottes-, es ist ein Glücksbeweis."
Rezensionsnotiz zu
Neue Zürcher Zeitung, 20.07.2005
Ian McEwans vorheriger Roman "Abbitte" sei ein "literarisches Meisterwerk" gewesen, "Saturday" dagegen sei schlicht und einfach "missglückt", urteilt Rezensent Uwe Pralle und überlegt, wie es bei diesem Autor dazu kommen konnte. Ursprünglich habe McEwan wohl nur vom "Familienglück" eines saturierten Mannes in seinem Alter erzählen wollen, mutmaßt der Rezensent, um wieder einmal literarisch gekonnt die unheimlichen Schichten des Alltagslebens freizulegen. Dann aber hätten die politischen Ereignisse um den 11. September und den Irak-Krieg, die der Autor ursprünglich nur als "Kontrastmittel" benötigt habe, sein Thema "überwuchert". So sei im Kontrast zu einem literarischen ein "politischer Roman" entstanden, folgert Pralle, der in vielem "konstruiert und disproportional" wirke. Als eine Art 24 Stunden Bewusstseins-Protokoll eines 48-jährigen Neurochirurgen, kurz vor dem Irak-Krieg, beziehe sich der Roman zwar literarisch auf große Vorbilder wie "Ulysses" oder "Mrs. Dalloway", sei aber so geschwätzig wie nie zuvor ein Roman von McEwan. Noch unter der Dusche brausten nichts anderes als die Gemeinplätze "vergilbter Leitartikel" und die Diskurse der internationalen "Sorgengemeinschaft". Erst auf Seite 377, bedauert der Rezensent, zeige der räsonierende Held "Einsicht", eigentlich doch kein "Gesellschafstheoretiker" zu sein.
Rezensionsnotiz zu
Die Tageszeitung, 14.07.2005
Mit den Terroranschlägen auf London wurde der Roman "Saturday" von Ian McEwan von der Wirklichkeit eingeholt, konstatiert Susanne Messmer, die sich vorstellen kann, dass es für den britischen Autor enttäuschend ist, wenn sein Buch nun vor allem als "Voraussage des 7. Juli" gelesen werden wird. Der Roman beschreibt einen Tag im Leben des Gehirnchirurgen Henry Perowne eineinhalb Jahre nach dem 11. September; während er seinen Beschäftigungen nachgeht und sich an seiner perfekten Ehe und seinen wohlgeratenen Kindern freut, werden immer wieder Reflexionen und Rückblenden eingeschoben, in denen Henry über sich und die von Terrorismus bedrohten Weltlage nachdenkt, fasst die Rezensentin zusammen. Die "Bedrohung" ist aber nur die Folie, auf der den Lesern ein "sattes Kind der Wohlstandsgesellschaft" vorgeführt wird, so Messmer weiter, die die "blütenweiße Vollkommenheit" dieses Lebens kaum erträglich fände, wenn nicht auch immer wieder Zweifel des Helden artikuliert würden. Auch wenn sich Henry als Identifikationsfigur anbietet, bleibt für die Rezensentin nach der Lektüre ein "schales Gefühl" zurück, weil sie den Protagonisten in seiner "Unerschütterlichkeit" allzu "gradlinig" findet. Insgesamt wirkt dieses "kleine Universum", das "nie aus der Kurve fliegt" auf Messer "manchmal fadenscheinig und faltenlos".
 Julian Barnes: Abschied(e)
Julian Barnes: Abschied(e)