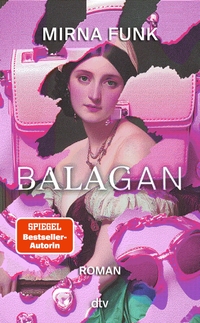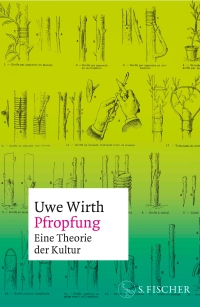Im Kino
Kosmopolitische Grazie
Die Filmkolumne. Von Karsten Munt
17.04.2024. In "Civil War" entwirft Alex Garland die Vision eines kommenden amerikanischen Bürgerkriegs. Konkrete Informationen darüber, wie so etwas aussehen könnte, werden freilich nur häppchenweise verteilt. Im Zentrum steht nicht der Krieg selbst, sondern der journalistisch abgebrühte Blick auf den Krieg.
Ein Räuspern. Der Präsident der Vereinigten Staaten (Nick Offerman) bereitet seine Stimme auf eine große Rede vor. Es herrscht Bürgerkrieg, so viel wissen wir. Doch auf das Räuspern folgt nicht der Eröffnungsmonolog, der die dazugehörigen W-Fragen beantwortet. Tatsächlich brabbelt der Mann, der sich, wie der Film später einwirft, in einer unrechtmäßigen dritten Amtszeit befindet, eine lange generische Durchhalte-Parole in die Kamera, die keinen Kontext oder gar ideologisches Fundament preisgibt. Genau so möchte es Filmemacher Alex Garland haben. "Civil War" mag als Dystopie vermarktet worden sein, die aktuelle demokratiefeindliche Tendenzen Amerikas ins Drastische weiterdenkt. Der eigentliche Film aber gibt sich betont undurchsichtig. Ein paar Häppchen werden freilich ausgeworfen: Das FBI wurde aufgelöst, die Front verläuft bei Charlottesville, die Truppen der modernen Seccessionists Texas und Kalifornien (man möchte schließlich nicht zu konkret an eine politische Gegenwart anknüpfen) stehen kurz davor, Washington D.C. ins Artilleriefeuer nehmen zu können. Genug Anspielungen also, um diejenigen zu ködern, die "Civil War" als mahnende Polit-Dystopie ernst nehmen möchten, aber eben doch nicht zu viele, um Garland auf eine andere Perspektive (womöglich sogar eine politische), als die des intellektuellen Fragestellers festnageln zu können.
"Civil War" ist kein Film über das Leid, das der Krieg bringt, sondern ein Film über das Betrachten des Leids. Die Protagonistinnen sind entsprechend weder Kombattanten noch zivile Opfer des Kriegs. Lee (Kirsten Dunst) ist Kriegsfotografin: zu abgeklärt, um sich für das politische Gebrabbel zu interessieren; zu abgeklärt, um die obligatorische Kevlar-Weste an der Front zu tragen; zu cool, um nicht jeden posttraumatischen Stress in der Badewanne wegmeditieren zu können, zu abgestumpft, um sich von einem Selbstmordattentat, das nur wenige Meter neben ihr geschieht, erschüttern zu lassen. Eine junge Amerikanerin, die sich, mit Sternenbanner in der Hand, mitten in Brooklyn selbst in die Luft sprengt, ist Garlands Version der Susan-Sontag-These: wenn Kriegsbilder überhaupt irgendwo eine Wirkung zu entfalten vermögen, dann zu Hause.

Nah genug dran sein muss das Leid. Das meint weniger die Nähe der Kamera zur Gräueltat, die sie aufzeichnet, als vielmehr den Ort und die Beteiligten dieser Gräuel. Für Lee ist der Bürgerkrieg in der Heimat schlicht ihr Karrierehöhepunkt. Ein quasi-sportlicher Wettkampf mit dem Ziel, das wirkliche Antlitz des großen Menschheitsverbrechen namens Krieg zu dokumentieren. Ein Wettkampf, der Garland wieder und wieder dazu dient, betont beiläufig mit dem Finger auf die amerikanische Medienlandschaft zu zeigen. Ein Gestus, der besonders deswegen frustrierend ist, weil der Road-Trip, zu dem Lee und ihre Wegbegleiterinnen aufbrechen, mitunter durchaus das Potenzial aufweist, an Sujet-verwandte Genreklassiker und ihre Schnörkellosigkeit anzuknüpfen; sei es der subversive Blick auf die zerstörerischen hypermaskulinen Dynamiken einer militanten Gruppe in Walter Hills "Southern Comfort" oder die reaktionäre Exploitation-Guerilla-Fantasie in John Milius' "Red Dawn". Garland aber möchte seinen Film sichtbar als thinking man's Genrestück verstanden wissen. "Civil War" positioniert sich jedoch nicht zur politischen Realität "am Boden", sondern wirft vom Treppenabsatz aus Fragen ein - rhetorische Fragen, versteht sich. Der Vibe des Films ist der eines passiv-aggressiven Tweets: provozierend genug, um Resonanz zu fordern; ungebunden genug, um direkt für den nächsten ausgetauscht zu werden.

Nah dran sind wir trotzdem. Der Road-Trip, den Lee mit Kollege Joel (Wagner Moura) und dessen Anhang unternimmt, führt direkt an die Front. Im Schlepptau des weltmännischen Rock-n'-Roll-Journalisten, der altgedient ist wie die Protagonistin, aber statt ihrer kosmopolitischen Grazie ein gutmütiges Hallodri-Charisma ausstrahlt, reisen der längst über den Ruhestand hinaus gediente Sammy (Stephen McKinley Henderson) und das gänzlich unerfahrene Rookie-Küken Jessie (Cailee Spaeny). Die 857 Meilen in Richtung Hauptstadt haben es in sich: vom "kleinen" Schusswechsel auf einer Art Campus-Gelände bis zum Häuserkampf in Washington D.C., bei dem Panzer, Kampfhubschrauber und Infanterie das Weiße Haus ins Visier nehmen; von der klassischen Lynchjustiz bis zum kalkbedeckten Massengrab.
Ein wirkliches Interesse daran, die Stationen zu einem fiktiven Amerika werden zu lassen, das mehr ist als Stichwortgeber für diskursive Sticheleien, hat Garland nicht. Alles nimmt pflichtbewusst seinen Platz ein. Allen voran die uniformierten Voyeure, die - ein letztes Mal Susan Sontag - entdecken, dass das echte Leben tatsächlich ein Melodrama und die Kamera tatsächlich eine Waffe ist, die Opfer fordern wird. "Civil War" rückt sich die Kriegsreporterinnen und Kombattanten als allegorische Bauernopfer zurecht, für - ja für was eigentlich? Ein lautes Räuspern.
Karsten Munt
Civil War - USA 2024 - Regie: Alex Garland - Darsteller: u.a. Kirsten Dunst, Wagner Boura, Cailee Spaeny, Nick Offerman, Stephen McKinley Henderson - Laufzeit: 109 Minuten.
Kommentieren